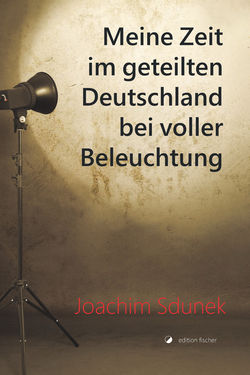Читать книгу Meine Zeit im geteilten Deutschland bei voller Beleuchtung - Joachim Sdunek - Страница 7
Die Politik und ich
ОглавлениеMein Vater war Jahrgang 1926 und gehörte zu der Generation von jungen Leuten, die nach dem Krieg eine neue Orientierung suchten. Er hatte das Kriegsende zwar noch als Soldat erlebt, war aber nicht traumatisiert wie sein älterer Bruder. Meinem Vater schien es sinnvoll, sich für den sozialistischen Aufbau des Landes zu engagieren. Der Sozialismus mit seinen Zielen war für viele Menschen nach dem Krieg erstrebenswert.
Die große Politik der Siegermächte hatte zwei deutsche Staaten entstehen lassen. Deutschland gehörte nicht mehr sich selbst, es hatte verspielt und wurde fremdbestimmt.
Der naturgemäße Unterschied zwischen meinem Vater und mir war, das er die Jahre nach der Gründung der DDR echt und in Farbe erlebt hatte. Aus meiner Sicht war ich bis Anfang der Siebzigerjahre zwar nicht unpolitisch, aber eher Opposition. Das hat Jugend wohl so an sich. Wenn es einem gut geht, riskiert man gerne mal eine große Klappe.
Ich wurde in meinem Elternhaus nie zu einer angepassten politischen Haltung gezwungen. Im Gegenteil, ich war offen, ehrlich und frei.
Mein Vater kam in meiner Erinnerung nie wie andere Väter zu normalen Feierabendzeiten nach Hause. Er kam spät abends und auch oft mit Kollegen und Freunden, die dann bis spät in die Nacht diskutierten. Für uns Kinder war das nicht so gut, denn wir mussten ja am nächsten Morgen zur Schule.
Diese nächtlichen Politdiskussionen führten bei mir nicht dazu, dass ich Politik gut fand. Eine gewisse Neugier stellte sich aber ein.
Als Kind und heranwachsender Jugendlicher bekam ich nicht wirklich den Aufbau des Staatswesens der DDR mit.
Gesellschaftswissenschaften sind Wissenschaften, die man nicht im Labor erforschen kann. Das bedeutet aber nicht, dass einem die Experimente nicht genauso um die Ohren fliegen können wie im Labor.
Der 17. Juni 1953 war der erste Beweis dafür. Es beteiligten sich 1 Million Menschen an den Demonstrationen und es gab 55 Tote. Die Arbeiterschaft demonstrierte für freie Wahlen, gegen zu hohe Arbeitsnormen bei zu geringem Lohn und Lebensmittelmarken.
Der 17. Juni machte auch klar, dass ausschließlich die Sowjetunion in ihrem besetzten Gebiet das Sagen hatte. Der Aufstand wurde mit sowjetischen Panzern zusammengeschossen. Es gab in der DDR niemals einen Politiker an der Spitze, der je etwas ohne die Genossen in Moskau entscheiden konnte.
Die Vorbereitungen, ein Gebiet nach sowjetischem Vorbild aufzubauen, hatten schon vor Kriegsende begonnen. Aus der Sowjetunion kamen 70 geschulte deutsche Politkader, die Schlüsselpositionen beim Neuaufbau des Landes einnehmen sollten.
Unter ihnen die Gruppe um Walter Ulbricht für den Raum Berlin, die Gruppe Anton Ackermann in Sachsen und die Gruppe Sobottka für Mecklenburg/Vorpommern.
Die politisch Aktiven mussten immer die absolute Treue zur Sowjetunion garantieren. Innerhalb der SED gab es von Beginn an Überlegungen für einen besonderen deutschen Weg zum Sozialismus.
Anton Ackermann verfasste schon 1948 seine Schrift »Der deutsche Weg zum Sozialismus«. Er wurde gedrängt, diese Schrift schon im September 1948 zu widerrufen.
Der Einzige, der einen nationalen Weg zum Sozialismus gehen konnte war Josip Broz Tito in Jugoslawien. Tito sagte sich 1948 von Stalin los.
Die Gründung der SED wurde auf Drängen Moskaus vorangetrieben. Es sprach viel dafür, aus KPD und SPD eine einheitliche Partei zu schaffen. Die Probleme dieser Vereinigung waren in den Anfangsjahren aber immer wieder Diskussionsstoff in der SED. Mit dem Zauber der Parteidisziplin und dem Kampf für eine gerechte Sache, bekam man das aber in den Griff.
In meinem Bewusstsein gab es funktionierende Strukturen in der DDR. Es gab ein gutes Gesundheitswesen, ein Sozialversicherungswesen, in das jeder einzahlte, ein einheitliches Bildungswesen und Ausbildungswesen. Bemerkenswert ist, dass in meinem Geburtsjahr 1952 Universitäten, Akademien, Hochschulen und Ausbildungsstätten aller Art schon wieder funktionierten.
In meiner Familie haben alle Cousins und Cousinen nach ihrer Facharbeiterausbildung noch eine Zusatzausbildung bzw. ein Studium absolviert. Ein Cousin war Facharbeiter, Ingenieur und Diplomsportlehrer. Er machte eine Karriere als Trainer. Ein anderer war Meister in der Tier- und Pflanzenproduktion. Unter meinen Cousinen gab es eine Lehrerin, eine Medizinerin und studierte Betriebsökonomen.
In meiner Heimatstadt Rostock entstand der Überseehafen als große Gemeinschaftsleistung der DDR-Bevölkerung. Es wurden in der ganzen Republik Steine dafür gesammelt. Es wurde das Ostseestadion mit Hilfe der Rostocker erbaut. Der Schiffbau begann in Serie und in Massen zu produzieren. Die großen Seefahrtsbetriebe des Fischkombinates Rostock und der Deutschen Seereederei erlangten weltweite Bedeutung.
Die Fischer waren vom Nordpol bis zum Südpol unterwegs. Die Deutsche Seereederei hatte das umfassendste Liniennetz in Europa. In der Spitze wurden mit 203 Schiffen Häfen in mehr als 100 Ländern angelaufen. Diese Reederei war in ihrer Struktur und ihrem Charakter einzigartig in der Welt.
Solche und ähnliche Entwicklungen vollzogen sich in der gesamten DDR.
Das gilt für die Stahlindustrie im brandenburgischen Eisenhüttenstadt, die aus dem Boden gestampft wurde, für die Chemieindustrie im Raum Halle und für das größte Braunkohleveredlungswerk der Welt »Schwarze Pumpe«.
Die Wismut AG war eine sowjetisch-deutsche Aktiengesellschaft. Die DDR war der viertgrößte Uranlieferant der Welt. Dieses Uran diente ausschließlich der sowjetischen Atombombe.
Das Gleichgewicht der Atommächte USA und Sowjetunion war in der Zeit von großer Bedeutung.
Der Kohlebergbau und die Erzgewinnung funktionierten in diesem an Rohstoffen armen Land.
Die Abwesenheit von Krieg ist einfach wunderbar. Es gibt wirtschaftliche Erfolge, Fehleinschätzungen und Fehler, die korrigiert werden können. Die Dynamik des Lebens bleibt allgegenwärtig. Ein größeres Geschenk kann man den Menschen nicht machen.
Im Hintergrund dieses friedlichen Aufbaus blieben die beiden deutschen Staaten aber besetzte Gebiete. Vordergründig interessiert die Menschen, dass sie arbeiten können, dass sie satt und zufrieden sind.
In den Staaten, die sowjetisch besetzt waren, gab es immer ein Denken über den Tellerrand hinaus.
Im Jahr 1968 begann der sogenannte »Prager Frühling«. Das war ein neues Denken, das von der Staatsführung der CSSR ausging. Ein nationaler Weg zum Sozialismus. Es dauerte nicht sehr lange, bis die sowjetischen Panzer dagegen vorgingen.
Ich machte im Sommer 1968 meine Ferienarbeit als Zimmermädchen im Hotel »Warnow«.
Diese Arbeit bekam ich durch eine Freundin. Jungen als Zimmermädchen gab es sonst nicht.
Ich verteilte die Seltersflaschen auf den Zimmern, fuhr die Schmutzwäsche in den Keller, verteilte neue Wäsche, bezog Betten und ging den Zimmerfrauen zur Hand.
Unter dem Hotelpersonal waren auch Köche und Kellner aus der CSSR. Sie beendeten alle sofort ihre Arbeit und fuhren nach Hause.
Ein tschechischer Gast hatte den Stecker seines Rasierapparates gewaltsam in die Schukosteckdose gesteckt und bekam ihn nicht mehr heraus. Die Zimmerfrauen riefen mich zu Hilfe. Ich umwickelte mein Taschenmesser mehrfach mit Papier und schnitt das Kabel durch. Der Gast war nicht nur wegen seines Rasierapparates in heller Aufregung. Er wollte schnellstens das Hotel verlassen und nach Hause fahren.
Die Jahre meines Heranwachsens waren hochinteressant.
Es gab in Rostock die Ostseewoche, die alle Ostseeanrainerstaaten einlud. Der Ostseeraum, das sogenannte Baltikum, ist schon immer ein wichtiger Wirtschaftsraum gewesen. Für die DDR ging es um internationale Anerkennung.
Mein Vater begleitete oft Delegationen aus Polen. Manchmal hatte ich den Eindruck, er könne Polnisch sprechen. Er kannte sicherlich einige Worte, die sich mit zunehmendem Alkoholgenuss in eine Sprache wandelten. Unter solchen Bedingungen konnte er auch Finnisch.
Die Ostseewoche war jedenfalls ein buntes Treiben.
1972 kam es zum Grundlagenvertrag zwischen beiden deutschen Staaten und 1975 gab es die Helsinkier Konferenz. Die internationale Anerkennung der DDR war faktisch seit 1971 vollzogen. Es gab Botschaften in aller Welt und ausreichend Arbeit auf diesem Gebiet. Diese Zeit war eigentlich nicht für Kleindenker und Dogmatiker geeignet. Sie eröffnete tolle Möglichkeiten auf allen Gebieten. Leider wurde sie von einem völlig überhöhten Sicherheitsdenken begleitet, das in den Folgejahren immer stärker werden sollte. Die DDR war leistungsstark und sie konnte international mithalten. Sie kam nicht von irgendwo her. In der DDR gab es schließlich Traditionen der deutschen Wirtschaft, des deutschen Ingenieurwesens und der deutschen Arbeiterschaft. Sie stand in der Tradition deutscher Akademiker und Ärzte. Die Charité Berlin hatte ihren Weltruhm zu DDR-Zeiten ja nicht verloren. Das Bauhaus Weimar/Dessau wurde auch nicht geschlossen. All das gehörte zum Stolz dieses Landes.
Die Schlussakte der Helsinkier Konferenz erlaubte Reisefreiheit, Tourismus und Kulturaustausch für jeden Bürger der 35 Unterzeichnerstaaten. Die Menschen in der DDR forderten die Rechte und Freiheiten dieser Helsinkier Schlussakte immer stärker ein.
Von der Unterschrift unter diese Akte bis zur praktischen Umsetzung verging natürlich viel Zeit.
Im Jahr 1975 wurde ich als Soldat zum Grenzdienst eingezogen. Die Tragweite der politischen Rahmenbedingungen war keinem meiner Mitsoldaten klar. Wir waren Soldaten und wollten so schnell wie möglich wieder nach Hause. Die Zeit von 1½ Jahren läuft aber nach der Uhr ab und nicht nach dem Wunsch.
Die Ausbildung war körperlich anspruchsvoll. Jeder Dicke wurde dünn und muskulöser und jeder Dünne wurde muskulöser.
Auf die politische Ausbildung wurde auch viel Wert gelegt und es war nicht alles Blödsinn, was man vermittelt bekam.
Ich hatte mittlerweile einige Bücher gelesen, darunter die großen Franzosen Balzac, Hugo und Zola. Ich wagte mich an Karl Marx und Friedrich Engels. Engels Werk »Der Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen« rang mir schon vom Titel her höchstes Interesse ab. Ich avancierte also zu einem philosophischen Spinner.
Die Philosophie ist die Wissenschaft von den allgemeinen Gesetzmäßigkeiten des menschlichen Lebens. Sie wird aber auch als »die Religion der Ungläubigen« bezeichnet.
Die Grenze zwischen den beiden deutschen Staaten war nicht nur dazu da, DDR-Bürger am Verlassen der DDR zu hindern. Sie war die Grenze zwischen zwei Welten. Jeder, der diese Grenze direkt überwinden wollte wusste, dass er sterben konnte. Ein Umweg war auf jeden Fall ungefährlicher.
Familienzusammenführung, Eheschließungen, auch wenn fingiert, Ausreiseanträge und Freikäufe waren eine Möglichkeit. Personen des öffentlichen Lebens mit zu kritischer Haltung konnte schon mal ein kostenfreies Übersiedeln in die BRD angeboten werden. Bei einer Eheschließung mussten natürlich die Ausbildungskosten in DM bezahlt werden. Ausreiseanträge wurden oft sehr zögerlich bearbeitet und wurden auch von Schikanen begleitet. Alle Personen, die beruflich die Möglichkeit hatten, konnten gefahrlos wegbleiben. Dazu gehörten z. B. Seefahrer, Künstler, Sportler, Wissenschaftler, Außenhandelsmitarbeiter und Reisekader aller Art. Die Zahl der Personen, die das nutzten, hielt sich in Grenzen.
Die DDR verkaufte im innerdeutschen Handel von 1963 bis 1989 33.755 politische Häftlinge, Agenten und 250.000 Ausreisewillige für 3,5 Milliarden DM. Der Mittelsmann für diese Abwicklungen war der Ostberliner Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Vogel. Er besaß das Vertrauen beider deutscher Seiten auf Regierungsebene.
Während meiner Armeezeit gab es zwei Fälle, die mich bis ins Mark erschütterten.
Der Fall Werner Weinhold: Ein Mann, der 54 Autodiebstähle ausführte, während seiner Bewährungszeit ein Sittlichkeitsdelikt beging und relativ spät doch noch zu den normalen Landstreitkräften der NVA eingezogen wurde. Er wurde fahnenflüchtig und setzte sich mit Munition, einem Fahrzeug und seiner Maschinenpistole ab.
Das gesamte Grenzregime war in Alarmbereitschaft. Die Postendichte war sehr hoch in dem Bereich, wo er letztlich durchbrach. Es war der 19. Dezember 1975, es war Vollmond und es lag Schnee. Die Sicht war wie am Tag. Weinhold stand im Waldstreifen und sah vor sich zwei Grenzsoldaten. Er schoss beiden in den Rücken und lief durch. Die Grenzsoldaten hatten ihre Waffen noch nicht mal entsichert. Beide Grenzsoldaten starben an ihren Schussverletzungen.
Man kann alles in Deutschland an Recht und Unrecht bemühen, diese Tat ist mit Nichts zu rechtfertigen. Weinhold wurde nicht an die DDR ausgeliefert.
Der zweite Fall, Michael Gartenschläger: Der 1961 17-Jährige zündete eine LPG-Feldscheune an und protestierte so gegen den Mauerbau. Die DDR war kein Staat, der sich auf der Nase herumtanzen ließ. Gartenschläger wurde in einem Schauprozess zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Die Bundesrepublik Deutschland kaufte Gartenschläger 1971 für 40.000 DM frei.
Gartenschläger war kein gutes Geschäft. Er demontierte am 1. April 1976 die erste Mine des Typs SM 70an den Grenzsicherungsanlagen.
Ich war in dieser Nacht zur Alarmgruppe eingeteilt. Die bestand aus vier Mann, die nach ihrem Grenzdienst von acht Stunden normalerweise im Bunker schlafen konnten. Es gab keine Hängematten, sondern Federböden von normalen Bettgestellen, die jeweils zu zweit übereinander in einer Betondecke verschraubt waren.
Im Halbschlaf bekam ich mit, dass eine Minenauslösung signalisiert wurde, aber keine Detonation erfolgte. Diese Minen wurden oft durch Wild ausgelöst. Bei Tagesanbruch fuhr eine Motorradstreife zur angezeigten Stelle. Auf der Westseite des Zauns stand eine Leiter und eine Mine fehlte. Das unüberwindliche Minensystem war geknackt.
Die erste Reaktion der Generalität war, Scheinwerfer parallel zum Grenzverlauf aufzustellen. Batterien von 180 Ah und 12-V-Suchscheinwerfer waren nicht leicht zu transportieren.
Am 23.April fehlte eine weitere Mine.
Der normale Grenzsoldat fragt sich: »Was ist hier los?«
Wir wurden in die zweite Reihe beordert und in der ersten Reihe waren Sonderkräfte im Einsatz.
In der Nacht zum 1. Mai sollte die dritte Mine abgebaut werden. Es war die Todesnacht des Michael Gartenschläger.
Die Staatssicherheitsleute, die diese Sache erledigten, konnten in späteren Jahren nicht nach bundesdeutschem Recht verurteilt werden. Es konnte nicht zweifelsfrei geklärt werden, wer zuerst geschossen hatte.
Uns Grenzsoldaten des Abschnittes wurde der Vorgang geschildert.
Gartenschläger war schwarz gekleidet und seine sichtbare Haut war mit Ruß eingefärbt. Er stieg auf eine Leiter und machte sich an die Arbeit.
Gartenschläger wurde ordnungsgemäß angerufen. Er zog seine Pistole und schoss in die Richtung. Die Sonderkräfte eröffneten das Feuer und Gartenschläger starb.
Der Gebrauch der Schusswaffe war für Grenzsoldaten klar geregelt. Der Grenzverletzer wird angerufen, dann erfolgt ein Warnschuss, bevor gezieltes Feuer eröffnet werden kann.
Wir wurden zur Geheimhaltung verpflichtet und die Dienstzeit ging weiter.
Es wurde uns nicht erklärt, wie sich die Staatssicherheitsleute und Gartenschläger punktgenau an der Stelle treffen konnten.
Im Zuge der Entspannungspolitik zwischen Ost und West wurde dieses Minensystem entfernt.
Im Herbst 1976 war mein Wehrdienst beendet.
Ich begann an Land als Elektriker in der Schiffsreparatur zu arbeiten. Wir reparierten die Fahrzeuge der Bagger-, Bugsier- und Bergungsreederei. Die Werkstätten waren aber der Deutschen Seerederei angeschlossen.
Ich wollte nahtlos von der Hochseefischerei zur Handelsflotte, um mir die Welt anzuschauen. Auf meinen Streifzügen durch die DDR vor meiner Armeezeit lernte ich eine Perle von Mädchen kennen. Wir heirateten noch während meiner Armeezeit.
Ursprünglich wollte ich mit meiner Frau gemeinsam zur See fahren. Diese Fälle kannte ich aus der Hochseefischerei. Bei der Deutschen Seerederei gab es die Möglichkeit, dass Ehefrauen für begrenzte Zeit mitreisen konnten. Diese Maßnahme sollte den Familien eine gewisse Erleichterung bringen.
Es war von mir mehr als naiv, für uns als kinderloses Ehepaar so einen Plan zu haben. Wir haben nie versucht, diesen Plan umzusetzen, da es tausend andere Dinge gab, die wir erledigen mussten.
In meinem Leben wurde ich mehrfach angesprochen, Mitglied der SED zu werden. Es war mir einfach lästig. Ich hatte viele gute Leute kennengelernt, die Mitglied dieser Partei waren.
In meiner Arbeitswelt gab es auch genügend Dinge, die man verbessern sollte. Als mich niemand mehr fragte, ging ich aus freien Stücken auf einen Parteisekretär zu und stellte den Antrag auf Parteimitgliedschaft.
Wenn man aus Überzeugung in eine Partei geht, kann man allerdings auch in Zweifel geraten und enttäuscht werden. Das geht Kirchenmitgliedern, die an Gott glauben, auch nicht anders.
Auf jeden Fall wurde ich ein Jahr später von unserem Parteisekretär der Grundorganisation, Karl Mantei, zu einem Gespräch eingeladen. Er fragte mich, was ich denn für meine Zukunft noch für Pläne hätte. Ich verwies auf mein früher ausgeschlagenes Ingenieurstudium.
Karl Mantei meinte, ich könnte das in Ilmenau auf dem Industrieinstitut machen, um später in leitender Position zu arbeiten.
Der Gedanke gefiel mir. Ich machte meine Unterlagen fertig und übergab sie ihm.
Karl Mantei war ein Parteifunktionär, der mit allen Wassern gewaschen war. Nach kurzer Zeit erklärte er mir, dass die Genossen in Ilmenau bemängelten, das ich keinerlei politische Vorbildung hätte. Ich sollte nun erst einmal für ein Jahr auf Parteischule.
Heute weiß ich, dass meine Unterlagen nie in Ilmenau ankamen. Karl Mantei brauchte einen jungen Genossen, den er auf die Parteischule delegieren konnte.
Für mich bestand die Frage, nach A nun auch B zu sagen. Das Studium in Ilmenau war noch mein Ziel.
Karl Mantei wollte mir offensichtlich ein gutes Gefühl vermitteln, indem ich zum Stapellauf eines Schiffes eingeladen wurde. Ich kam nach Hause und sagte meiner Frau, dass ich am nächsten Tag zum Stapellauf müsse. Sie darauf: »Oh Gott, du hast ja gar keinen Trainingsanzug.«
Ein anderes Mal wurde ich zu einer Ausfahrt mit Bockwurst und Erbseneintopf auf dem Schiff »Ostseeland« eingeladen. Auf dieser Ausfahrt 1978 war der Fliegerkosmonaut Sigmund Jähn anwesend. Er hatte seine Arbeitshandschuhe und einige kleinere Utensilien dabei. An den Arbeitshandschuhen konnte man sehen, dass das Umsteigen von einer Raumkapsel in eine Raumstation und dann wieder zur Landung in die Kapsel handfeste Arbeit war. Sigmund Jähn war ein sehr angenehmer und kompetenter Gesprächspartner.
Ich wurde also Student an der Parteischule. Meine Mitstudenten waren unter anderen eine Lehrerin, eine Verkäuferin, ein Kapitän, ein Busfahrer und ein Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit Berlin. Eine bunte Mischung also.
Damit die Studenten der Gesellschaftswissenschaft nicht vergessen, wie harte Arbeit schmeckt, fuhren die Parteischüler traditionell zur Kohlernte auf die Insel Rügen. Im Herbst ist es schon empfindlich kalt und nass. Die Kohlreihen auf den Feldern reichten bis zum Horizont. Viele Frauen mussten aufgeben. Die Arbeit war einfach zu schwer.
Mein Mitstudent Giesbert, im Range eines Offiziers der Staatssicherheit, meldete sich auch krank. Er durfte nach Hause fahren.
Nach meiner Einstellung muss man bei harter körperlicher Arbeit den Punkt überwinden, an dem es scheinbar nicht mehr weiter geht.
Giesbert und ich studierten und irgendwie mochten wir uns beide nicht. Während meines Studiums erfuhr ich durch einen Mitstudenten, dass ich eine hauptamtliche Funktion in der FDJ übernehmen sollte. Diese Position hatte dieser Mitstudent früher inne. Mein Studium in Ilmenau war also Geschichte.
Bevor man mit mir persönlich sprach, eskalierte die Situation zwischen mir und Giesbert gegen Ende des Studiums. Ich schlug Giesbert vor, dass wir eine neue Partei gründen sollten, auf der Grundlage der Ideen von Rudolf Bahro und Robert Havemann. Rudolf Bahro saß mittlerweile im Gefängnis und Robert Havemann stand unter Hausarrest. Ich kritisierte und provozierte in einem Rundumschlag. Es gab zu dieser Zeit keine besseren Männer, mit denen man innerhalb der SED so provozieren konnte.
Es scharrten sich noch andere Mitstudenten um uns und trauten ihren Ohren und Augen nicht. Giesbert ermittelte mich als Partei- und Republikfeind. Er schrieb noch in der Nacht einen Bericht an seine Dienststelle in Berlin und an die Schulleitung.
Ich erklärte frei und offen gegenüber der Schulleitung, wie es soweit kommen konnte. Das waren erfahrene Leute, die nur noch die Köpfe schüttelten. Ein Lehrer bezeichnete mich unter vier Augen als Politganoven. Er tat dies freundlich, aber bestimmt und hatte den Nagel auf den Kopf getroffen. Zu retten war ich aber nicht.
Es gab ein Parteiausschlussverfahren, das mit einer Stimme Mehrheit für mich ausging. Ich blieb Mitglied der SED und wurde zurück in die Produktion delegiert.
Wer nur knapp ein solches Verfahren überstanden hatte, genoss eine gewisse Narrenfreiheit und brauchte kein Blatt mehr vor den Mund zu nehmen. Für meine spätere Arbeitswelt war das genau richtig.
Meine wirtschaftliche und politische Karriere war damit beendet. Ich war im Sozialismus einen Tag arbeitslos, weil keiner auf mich vorbereitet war.
In den Reparaturwerkstätten der Seereederei gab es eine Elektrowerkstatt mit einer Personalstärke von 25 Mann. Dieses Personal von Individualisten galt im Sinne eines sozialistischen Kollektivs als unregierbar. Ich übernahm 27-jährig diese Werkstatt als Werkstattleiter und Meister. Man hatte also eine Aufgabe für mich gefunden.