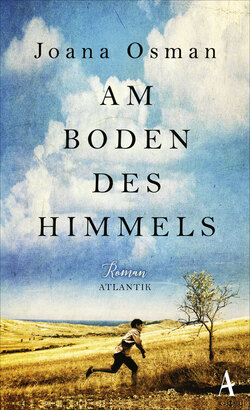Читать книгу Am Boden des Himmels - Joana Osman - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Eins Traum
ОглавлениеAlles was wir sehen oder zu sein scheinen
Ist nur ein Traum in einem Traum
Edgar Allan Poe, »Ein Traum in einem Traum«
Das letzte große Ereignis in der Stadt Kfar Jalah geschah Anfang der achtziger Jahre, als Ibrahim Marwadi seinen Bruder mit einem Olivenbaum tötete. Sie hatten sich um ein Stück Land gestritten, das sie gemeinsam bewirtschaften sollten, und eines Sonntags im Mai raste der eine Bruder wutentbrannt mit seinem Toyota gegen den morschen Stamm des Baumes, der umfiel und den anderen Bruder dabei so unglücklich am Kopf traf, dass er zu Boden ging und starb.
Die Stadtväter werteten den Vorfall als Unfall, doch die Einwohner meiden seither den Olivenhain und nehmen lieber den Umweg über die Hügel.
Normalerweise ist es hier ruhig. So ruhig, dass man hören kann, wie die reifen Aprikosen auf die Straße fallen, wo ihr Duft die Wespen anlockt. Tatsächlich ist Kfar Jalah eines der verschlafensten Örtchen des ganzen Landes, natürlich abgesehen von den regelmäßigen Scharmützeln, Demonstrationen und Ausschreitungen während des ein oder anderen Krieges, die aber, ob ihrer Häufigkeit, keiner mehr zählt.
Im Sommer kann es hier so heiß werden, dass der Lack auf den Autos Blasen wirft, und der Himmel nimmt manchmal eine seltsame schwefelgelbe Farbe an. Die Einwohner sind überzeugt, dass Kfar Jalah der heißeste Ort an der Grenze zwischen Israel und den Palästinensergebieten ist und achten deswegen darauf, um die Mittagszeit kein Metall anzufassen, da es einem die Haut an den Fingern versengen kann.
Die Luft in dieser Stadt ist so feucht und drückend, dass manche Seelen den Ort nicht verlassen können. Anstatt zum Himmel aufzusteigen und das Licht zu suchen, klammern sie sich an einen Fremden, lassen sich direkt über ihm nieder und folgen den Spuren, die seine Schuhsohlen im Sand hinterlassen. Die Kreuzfahrer, die die Stadt im Mittelalter einnahmen, haben das am eigenen Leibe erlebt. Sie kamen in die Stadt, um so viele Unschuldige zu töten, wie sie nur konnten, doch dann wurden sie die Geister ihrer Opfer nicht los, die in ihre Herzen und ihre Köpfe krochen und sie verrückt machten. Seither wechselte die Stadt unzählige Male Namen und Besitzer, doch die Seelen all derer, die auf gewaltsame Weise zu Tode kamen, ob durch Olivenbäume, Säbel, Gewehrkugeln oder Granaten, wandern noch immer zwischen den Bananenbäumen umher, verbergen sich hinter den fächerartigen Blättern und seufzen beim Duft der frisch geernteten Früchte.
***
Layla Al-Riadh lebt seit ihrer Geburt vor siebenundzwanzig Jahren an diesem Ort. Gleich oben, im ersten Haus auf dem Hügel, das mit dem Zitronenbaum im Garten. Ihr Zimmer ist der heißeste Raum des Hauses, eine kleine Kammer, die nach Süden hinausgeht, dorthin, wo die Obstplantagen liegen. Den ganzen Tag über dringen Lärm und Staub und der Geruch von reifen Feigen in ihr Zimmer, sodass sie sich nicht konzentrieren kann, selbst wenn sie es mit aller Kraft versucht.
Layla wünschte, sie würde nicht träumen. Sie wünschte, sie wäre taub und blind, dann würden ihre Träume vielleicht nur vom warmen Wind handeln, oder vom Gefühl von Sand auf ihrer Haut, wenn die Lastwagen den Straßenstaub aufwirbeln.
Nach Mitternacht, wenn die Temperatur so weit gefallen ist, dass man anfangen könnte, an Schlaf zu denken, wäscht sie die Wäsche. Unten im Hof, wo die Eidechsen furchtlos über die Mosaikfliesen huschen, erhitzt sie einen Topf mit Wasser, lässt Waschmittel zulaufen und sieht zu, wie die Wolken aus Seifenlauge langsam bis auf den Grund sinken. Dann legt sie ihre Seidenschals und die bestickten Baumwolltücher hinein, die so fein sind, dass sie wie Luft durch ihre Finger gleiten. Zu fein, um sie in der Maschine zu waschen. Zu fein, um ihr Gewicht zu spüren.
Doch nachdem die Wäsche gewaschen und zum Trocknen auf die Leine gehängt wurde, kommen die Träume.
Eine Frau geht über das Bett, watet durch die gebleichten Laken. Sie ist in einen abgetragenen Mantel gehüllt, neben sich ein kleines Mädchen. Die kleinen Fußspuren gesellen sich zu den großen, die beiden gehen durch eine Stadt, ihre Füße hinterlassen Spuren im weißen Schnee. Die Frau hat die Hand auf den Kopf des kleinen Mädchens gelegt, der mit einer dicken Mütze bedeckt ist. »Halte meine Hand gut fest«, sagt die Frau in einer fremden Sprache. »Wir haben einen weiten Weg vor uns.« Das ist nicht die Stimme von Sabah, Laylas Mutter, und doch weiß Layla, dass die große Frau mit den braunen Augen ihre Mutter ist. Laylas kleine weiße Hand, die schon fast blau vor Kälte ist, wandert zu ihrer Brust, zupft und zerrt am Stoff des zu dünnen Mantels. Und plötzlich bleibt die Mutter stehen.
»Lass das!«, sagt sie, und ihre Stimme ist hart vor Angst. Doch in Laylas Hand liegt bereits ein Stern, zwei perfekte Dreiecke aus gelbem Stoff.
Als Layla im hellen Tageslicht ihres palästinensischen Dorfes aufwacht, sind ihre Hände eiskalt.
***
Es gab wohl einige Vorzeichen, die die Ereignisse ankündigten, man hat sie bloß nicht richtig gedeutet. Da war zum einen dieser merkwürdige trockene Wind im April, der von Süden her kam, über die Felder wehte und jeden noch so winzigen Tropfen Wasser aus dem Boden saugte, bis sich tiefe Risse durch die durstige Erde zogen. Dann war da die Errichtung eines neuen Checkpoints, genau an der Grenze zu Abu Hosseins Olivenhain. Abu Hossein, der wegen des Stacheldrahtes nicht mehr an seine Bäume kam, schrie und schimpfte wie ein Verrückter, aber sein Gebrüll stieß auf taube Ohren. Stattdessen wurde ihm unsanft ein Gewehrkolben in die Rippen gestoßen und man hieß ihn, nach Hause zu gehen und den Mund zu halten. Seither sieht er von ferne zu, wie seine Bäume langsam vertrocknen und murmelt eine Verwünschung nach der anderen.
Es war auch um diese Zeit, als eine fremde Frau im Dorf gesichtet wurde, eine Jüdin. Weil sie alt war und verwirrt, ließen die Dorfbewohner sie in Ruhe, obgleich es einige Kinder gab, die hinter ihr herliefen und ihre ausgestreckten Zeigefinger an die Köpfe hielten, als ob es Hörner wären und dazu unanständige Reime sangen. Der Verrückten schien das nicht aufzufallen oder vielleicht war es ihr auch egal, denn sie fuhr damit fort, die Leute zu fragen, ob sie einen Jungen namens Simon gesehen hätten, so groß, wobei sie die Hand etwa einen Meter über dem Boden schweben ließ. Am Ende verschwand die alte Frau über die Hügel, zurück in ihr Kibbuz, von wo sie gekommen war.
Mit Sicherheit waren das Zeichen, und sicher geschahen in anderen Gegenden noch viele weitere, doch dieses außer Rand und Band geratene Land liefert nun einmal so viele Zeichen, die alle auf das Ende der Welt hindeuten, dass niemand ihnen noch Beachtung schenkt.
Die schlichte Wahrheit ist, dass diese Geschichte, die mit ihren übernatürlichen Merkwürdigkeiten das Leben so vieler Menschen auf so seltsame Weise verändern sollte, an einem sehr normalen Montagmorgen begann.
***
Layla ist schlecht gelaunt aufgewacht, und als sie das Redaktionszimmer des Radiosenders Al-Qamar betritt, wo sie als Reporterin arbeitet, verschlechtert sich ihre Laune noch weiter. Al-Qamar ist der einzige arabische Radiosender in der Region Haifa, und Layla braucht über eine Stunde zur Arbeit, doch immerhin hat sie einen Job. Die Themen bei Al-Qamar wiederholen sich von Woche zu Woche, diese Woche ist es Fußball, dann gibt es noch eine Castingshow und natürlich die bevorstehende Wahl, bei der es ohnehin wieder nur Verlierer geben wird.
Layla weiß, ihr Chef wird sie zum Modelcasting schicken, bei dem sie magere junge Frauen mit Spatzenhirnen interviewen soll, deren einziger Lebenszweck darin besteht, in Kleider zu passen, die für Zwölfjährige konzipiert wurden. Das sei ein Frauenthema, sagt ihr Chef, und wie jeder sehen kann, ist Layla eine Frau, und damit wäre dann ja alles klar. Dabei hätte es so viele interessantere, aktuelle Themen gegeben. Da war zum Beispiel die hitzige Debatte über den Mangel an Frauenrechten in der arabischen Gesellschaft, die vor allem von denjenigen geführt wurde, die davon nichts verstanden. Laylas Idee war es gewesen, investigativ nachzuforschen, wie viele der selbsternannten Feministen regelmäßig das örtliche Bordell besuchten, doch ihr Vorschlag wurde abgelehnt, vermutlich um die Privatsphäre derjenigen zu schützen, die in jenem Etablissement Stammgäste waren.
Als sie beim Radio anfing und ihre Eltern deswegen einen Anfall bekamen, wollte Layla unbedingt über Dinge berichten, die politisch relevant waren. Sie wollte Reportagen machen, die die Menschen aufrütteln, aber stattdessen geht sie nun in den Aufnahmeraum und spricht den Verkehrsfunk. Nach dem Wetter schaltet sie das Mikro aus und nimmt die Kopfhörer ab. Missmutig starrt sie durch die Scheibe in den Regieraum, wo Amir, ihr Boss, bereits ungeduldig wartet.
Amir el-Din ist der Chef des Radiosenders Al-Qamar – viel weiter nach oben kann man als Palästinenser in Israel nicht kommen. Sein Name bedeutet Prinz, und entsprechend seiner Bedeutung verhält er sich auch. Obwohl sich die Mitarbeiter viele phantasievolle Namen für ihn ausgedacht hatten, die sie hinter seinem Rücken benutzten, nennen ihn die meisten Leute in seiner Gegenwart doch nur beim Vornamen. Als Palästinenser mit israelischer Staatsbürgerschaft machte er in seiner Jugend einen beispiellosen Schritt und trat aus purem Opportunismus in die israelische Armee ein. Dort trainierte er sich, neben einer gewissen militärischen Härte, auch einen gewaltigen Bizeps an. Außerdem besitzt er seit dieser Zeit die Fähigkeit, große Mengen Bier zu trinken – auch eine Eigenschaft, die ihn in den Augen von Laylas Familie unmöglich macht. Sein Bauch hat sich dadurch entsprechend vergrößert, sodass ihm häufig ein Hemdzipfel aus der Hose hängt, wenn er seinen Mitarbeitern Vorträge hält, was, neben Bier trinken, zu seinen Lieblingsbeschäftigungen zählt. Und so kollert er jeden Morgen schwerfällig den Flur hinunter, um jemanden zur Schnecke zu machen. Amir ist normalerweise ein gutgelaunter Mensch, der seine berufliche Karriere dadurch erlangt hat, dass er gut gelaunt jedem seiner Konkurrenten und Kollegen in den Rücken gefallen ist. Doch heute hat er einen unzufriedenen Ausdruck im Gesicht, der ihm ein leicht froschartiges Aussehen verleiht.
Seufzend steht Layla auf. Sie weiß nur zu gut, dass es fast unmöglich ist, eine andere Festanstellung zu finden und dass sie schon alleine deswegen nicht kündigen wird, um sich vor ihrer Familie keine Blöße zu geben. Ein Teil des Problems besteht darin, dass ihr nie eine passende Erwiderung einfällt, wenn die Nachbarn fragen, wann sie endlich heiraten wird. Im nächsten Herbst wird sie achtundzwanzig, und so langsam gehen ihr die Argumente aus. Eine Karriere beim Radio, auch wenn sie nur mittelmäßige Reportagen über Schönheitswettbewerbe oder die derzeitige Wasserknappheit in Ramallah schreibt, ist immerhin etwas.
Die Kollegen in der Redaktion mögen Layla. Sie wirkt ernst, sogar wenn sie lacht, hat lange dunkle Haare, einen großen Mund und keine Ahnung davon, dass sie schön ist. Als sie in den Regieraum kommt, grinst Maroon, der Techniker, sie aufmunternd an. Entgegen seiner sonstigen Gewohnheit wünscht ihr Boss ihr einen guten Morgen und erwähnt die Castingshow mit keinem Wort. Stattdessen klopft er mit seinem Kugelschreiber gegen seine Handfläche und fängt an, im Zimmer auf und ab zu gehen.
»Fahr nach Galiläa, da hat es irgendein Wunder gegeben. Nimm Maroon mit, er soll die Aufnahmen machen.«
»Was denn für ein Wunder?«
»Was weiß denn ich, irgendein Wunder eben. Irgendjemand hat einen verdammten Engel gesehen oder so etwas. Jedenfalls brauche ich eine Reportage über ein Wunder, Reshet Aleph hat es auch schon gebracht.«
Natürlich ist Israel das Land mit den meisten Wundergläubigen der Welt, jedenfalls gemessen an der Einwohnerzahl. Andauernd versucht sich irgendwo jemand als Prophet, es gibt selbsternannte Heiler, die die Gebrechen der Gläubigen mittels Handauflegen lindern, am Jordan tunken Priester Kranke wie Gesunde ins Wasser, und jedes Jahr wird in Jerusalem mindestens ein Verrückter aufgegriffen, der, nur mit einer Stoffwindel und einer selbstgebastelten Dornenkrone bekleidet, ein Holzkreuz durch die Gassen schleppt oder vor der Klagemauer verkündet, er sei der Messias. Das ist ganz normal, immerhin ist das hier das Heilige Land, und die Bevölkerung, egal ob jüdisch, christlich oder muslimisch, kommt nicht ohne ihre tägliche Dosis Wahnsinn aus. Schon immer hat dieses Land das Monopol für Irrationalität und Übersinnliches besessen, doch wenn Amir ausgerechnet jetzt eine Reportage über ein Wunder haben möchte, dann nur deswegen, weil das Thema gerade so in ist. Einige Jahre zuvor erlebte das Land die jüngsten Auswüchse der New-Age-Welle mit ihren Propheten, Engelsflüsterern, Ufo-Gläubigen und Geistheilern, und überall eröffneten obskure Reiki-Praxen und Esoterik-Buchhandlungen, in denen entrückt aussehende Menschen ihre Heilsbotschaften erläuterten – und all das in einem Land, in dem sich Leute wegen Glaubensfragen regelmäßig an die Gurgel gehen. Layla würde lieber zum Schönheitswettbewerb gehen, als in Galiläa nach einem Wunder zu suchen, aber sie ist klug genug den Mund zu halten, ihre Anweisungen entgegenzunehmen und sich darauf zu beschränken, innerlich mit den Augen zu rollen.
»Hast du vielleicht irgendwelche Anhaltspunkte für mich? Einen Namen? Eine Adresse? Irgendwas?«
»Nein. Fahr doch einfach nach Tiberias und frag nach dem Wunder. Was weiß ich; wenn du einen Kerl mit Flügeln siehst, mach ein Interview, oder denk dir irgendwas aus. Aber beeil dich, in der Freitagssendung bringen wir es groß als Feature.«
Seit ihrem Uni-Abschluss vor vier Jahren hat Layla beim Radio gearbeitet. In all der Zeit hatte sie weniger als ein halbes Dutzend Verabredungen, da sie fast jeden Annäherungsversuch bereits im Keim erstickt. Inzwischen stellt Layla fest, dass sie oft müde und gereizt ist. In letzter Zeit ist sie so angespannt, dass sie stets ein dumpfes Pochen hinter der Stirn fühlt, und ihre Nackenmuskeln fühlen sich an wie Drahtseile. Wenn sie nachts schwitzend aus einem ihrer Albträume aufschreckt, weil ihr der Rücken wehtut, oder wenn sie sich einsam fühlt, dann ruft sie sich in Erinnerung, wie hart sie dafür gearbeitet hat, unabhängig zu sein. Sie verdient ihr eigenes Geld, sie sorgt dafür, dass ihre Familie das Haus abbezahlen kann, und auch wenn sie kaum etwas zurücklegen kann, so kommen sie doch über die Runden. In erster Linie deswegen hat sie studiert und den Job in der Redaktion angenommen. Sie ist vielleicht nicht wie alle anderen, aber was spielt das schon für eine Rolle? Wenigstens ist sie nicht verrückt. Zum Teufel, dann geht sie eben nach Galiläa und sucht nach einem verdammten Wunder. Immerhin ist das besser, als zu Hause zu sitzen und darauf zu warten, dass eines geschieht.
***
Maroon fährt mit heruntergelassenen Scheiben und hat Iron Maiden auf volle Lautstärke gedreht. Er bezeichnet sich selbst als arabischen Anarchisten und träumt davon, mit seiner eigenen Band auf Tour zu gehen, aber hab erst mal die Kohle dafür, erklärt er Layla, die nicht zuhört. Seine Band nennt sich »The Living Dead«, und genauso fühlt sich Layla im Moment. Möglicherweise liegt es an dem Sound, der ihr in den Ohren schmerzt oder an der selbstgedrehten Zigarette von Maroon, deren Geruch sie verrückt macht. Sie hat schlecht geschlafen und dunkle Ringe unter den Augen, und das weiß sie auch. Sie hat wieder vom Schnee geträumt und von Krähen, die von Mauern auffliegen, hoch hinauf in den kalten weißen Himmel. Im Traum lief sie vorbei an langen Reihen maroder Backsteinhäuser, auf deren Dächern Schnee lag. Ihre nackten Füße tappten durch den Schnee, blau gefroren und taub vor Kälte. Sie war allein auf der Straße, gesäumt von schwarzen Baumgerippen, Stacheldraht und alten, abweisenden Gebäuden. Da hörte sie einen Schuss und dann noch einen und dann nichts mehr. Doch hinter einer Hausecke, vor einer schwarzen Wand färbte sich der weiße Schnee hellrot.
Noch immer spürt Layla Kälteschauer über ihre Haut rieseln, obwohl es draußen sicher mehr als dreißig Grad sind. Sie hasst diese Träume, aus denen sie mit klopfendem Herzen und zusammengebissenen Zähnen aufwacht. Sie hasst den Sog, in den sie gezogen wird, unfähig aufzuwachen, unfähig sich zu bewegen. Wenn sie in solchen Nächten einschläft, dann hört sie ein Rauschen in den Ohren, laut und monoton, und sie kann sich nicht daraus befreien. In diesem Zustand zwischen Wachen und Schlafen kann sie sich nicht rühren, nicht mal den kleinen Finger. Sie kann nur daliegen, bewegungslos auf dem Rücken, und ist diesem Rauschen ausgeliefert, das sich anhört wie tausend fallende Steine. Und dann fällt auch sie, tiefer und tiefer, mit bewegungslosen Gliedern, fällt mitten hinein in den Albtraum aus Schnee und Blut.
Die Sonne scheint unbarmherzig auf die Landstraße und hat die Hügel Galiläas gelbbraun gebrannt wie Tongefäße. Als sie in Tiberias ankommen, ist es Mittag geworden. Die Sandsteinhäuser reflektieren die Hitze, und vom See her weht eine schwülheiße Brise. Auf den Straßen ist nicht viel los, nur ein paar fliegende Händler sind unterwegs und natürlich die üblichen Touristengruppen, die sich Vorträge über den See Genezareth auf Spanisch, Englisch und Russisch anhören. Maroon und Layla parken in einer Seitenstraße vor einem Geschäft, das Zubehör für Wassersport verkauft. Über dem Eingang hängen bunte Schwimmreifen und aufblasbare Delfine, denen ein dümmliches Grinsen aufgemalt wurde. Der Laden daneben verkauft religiöse Devotionalien, ein Stapel Kippas liegt auf einem Regal, und daneben baumeln Rosenkränze an einem Gestell und klimpern leise im Wind. Layla steigt aus dem Wagen und streicht sich die Haare aus dem Gesicht. Sie weiß schon jetzt, dass dieser Ausflug ein fruchtloses Unterfangen sein wird, es wird ewig dauern, und am Ende werden sie doch mit leeren Händen zurück in die Redaktion kommen. Trotzdem überprüft sie ihre Notizen und befestigt ihren Presseausweis an ihrer Bluse.
Maroon hat sich schon das Aufnahmegerät über die Schulter gehängt und ist bereit. Gemeinsam laufen sie die Straße hinunter in Richtung See, dort wo die Boote am Hafen anlegen und wo es nach Fisch und gebratenen Maiskolben riecht.
***
Die Menschen im Nahen Osten sind Hitze gewohnt, die einem die Schuhe versengt und wie heißer Atem ins Gesicht weht. Aber diesmal war es anders.
Es war das richtige Wetter für Waldbrände, Sandstürme und Krieg, und alle wussten das. Als die Temperatur bei vierzig Grad angelangt war, verschmolzen die Stunden, bis man nicht mehr sagen konnte, welche Tageszeit es war oder welcher Tag. Wer morgens aus dem Haus ging, musste feststellen, dass der Asphalt unter den Füßen schmolz, und wer sich mittags ins Freie wagte, dem konnte binnen Sekunden schwarz vor Augen werden.
Es war eine Zeit, in der so ziemlich alles schiefging, was schiefgehen konnte. Liebende stritten sich in überhitzten Schlafzimmern, wildfremde Menschen beschimpften sich auf Parkplätzen, Messer wurden gezückt und Steine wurden geworfen. Freundschaften, von denen man dachte, sie würden die Zeit überdauern, wurden mit einem einzigen unbedachten Wort zerstört. Die wenigen Leute, die schlafen konnten, wurden von schlimmen Albträumen geplagt, und alle anderen tranken eisgekühlten Kaffee und starrten trübsinnig in den gleißenden Himmel.
Bei einem solchen Wetter waren Halluzinationen wirklich nichts Ungewöhnliches. Lior Orly, der noch nie in seinem Leben Visionen gehabt hatte, nicht einmal in den wilden Jahren seiner Jugend, als Drogen zum Alltag gehörten, fing an, Dinge auf den Straßen von Tel Aviv zu sehen. Ein Paar rote Damenschuhe mitten in der Bograshov Street, eine Rolle Stacheldraht auf dem Rothschild Boulevard, und einmal erblickte er sich selbst einige Hundert Meter entfernt auf dem Highway, ein gespenstisches Aufleuchten seiner eigenen Gestalt. Er erschrak zu Tode und wäre beinahe in einen entgegenkommenden Laster gerast, wäre dessen Fahrer nicht so geistesgegenwärtig gewesen auszuweichen. Danach musste Lior am Straßenrand halten und in eine Papiertüte atmen, damit er nicht hyperventilierte. Es war nicht nur die Hitze, die allen so zusetzte, es war auch dieser seltsame schwefelige Geruch in der Luft, der durch die Straßen zog und das Atmen schwer machte.
Lior ist kein Träumer, das ist er nie gewesen. Er ist auch kein Mensch, der unbedachte Äußerungen fallen lässt und gewiss ist er niemand, der abergläubisch ist. Im Grunde genommen ist er nicht mal sicher, ob er überhaupt gläubig ist und vermutlich ist genau das das Problem, denkt er, als er sein Auto abschließt und in Richtung Hafen geht. Es ist so furchtbar heiß, dass ihm der Schweiß aus allen Poren rinnt, obwohl er nichts weiter trägt als Shorts und ein ausgeblichenes T-Shirt mit einem Aufdruck von den Ramones.
Lior hat den Sommer nie gemocht, und wenn es etwas wie eine Sommerdepression gibt, dann hat er das. Außerdem hasst er Tiberias, er hasst die ganze nach Fisch stinkende Stadt mit ihren uralten Gräbern und mitsamt ihren Bewohnern. Als er am Hafen ankommt, erblickt er nacheinander einen schwarzen Hund, der ihn anstarrt, ein kleines Mädchen, das mit Mantel und Fäustlingen an der Straßenecke steht (das kann mit Sicherheit nicht real sein, so viel ist ihm klar) und einen kleinen blauen Vogel, der vor ihm in der Luft schwebt. Lior versucht nicht, das Ding anzufassen, er wendet den Kopf ab und hofft, dass wenigstens der Hund echt ist. Er ist es. Sein Bellen folgt Lior, als er die abgetretenen Stufen zur Wohnung seines Vaters hinaufsteigt, der in einem recht heruntergekommenen Haus mit Blick auf den See wohnt.
Als er die Wohnung betritt, steht sein Vater Mordechai am Fenster und starrt missmutig nach draußen. Sein Bart ist längst ergraut, und in sein Gesicht haben sich tiefe Linien eingegraben, obwohl seine Schläfen noch immer schwarz sind. Seltsam, denkt Lior, bei ihm selbst ist es genau umgekehrt. Mit dreißig bekommt Lior büschelweise graue Haare, die so wenig zu bändigen sind, dass sie nach allen Seiten hin abstehen, doch sein Gesicht ist faltenlos und sieht aus wie das seiner Studenten. Sein bester Freund Dror hat ihm gesagt, dass die Frauen auf so einen Look stehen, doch Lior fühlt sich einfach nur alt damit.
Die Sache mit den Haaren ist nicht das Einzige, was Lior von seinem Vater unterscheidet. Der alte Herr verlässt selten sein Zimmer, und wenn, dann nur, um in die Synagoge zu gehen. Manchmal besucht er auch den Markt, um Äpfel und Datteln zu kaufen, doch größere Menschenansammlungen meidet er. Lior hingegen verbringt so wenig Zeit in seiner Wohnung in Tel Aviv, die er sich mit Dror teilt, dass er sich mitunter fragt, ob sich die exorbitante Miete überhaupt lohnt, und zum Essen besucht er meist den Imbiss an der Ecke, wo es frische Falafel und Zwiebelringe gibt, die in heißem Fett ausgebacken werden.
Während Mordechai sich bereit macht, um zu beten, geht Lior in die Küche, die spartanisch eingerichtet ist, genau wie der Rest der Wohnung. Auf dem Herd steht ein Topf mit kalter Suppe, auf der weißliche Fettaugen schwimmen, und an der Wand hängt ein noch tropfendes Nudelsieb an einem Haken. Zweimal im Monat besucht Lior seinen Vater, um ihm Essen zu bringen und ihm Gesellschaft zu leisten, und jeden Monat ist Mordechai abweisender und mürrischer als den davor. Seit sich seine Eltern vor siebzehn Jahren getrennt haben, hat sich sein Vater voll und ganz dem Studium der Thora gewidmet und wurde in dem Maße wunderlicher und mürrischer, wie sein Bart länger wurde. »Dein Vater hasst die Menschen im Grunde nicht«, pflegt seine Mutter zu sagen, »er kann sie nur nicht leiden.« Daraufhin backt sie für gewöhnlich einen Strudel oder ein paar Honigkuchen, die sie sorgfältig in Papier einwickelt, damit sie saftig bleiben. Als Lior heute den Kuchen auspackt, um ihn auf den einzigen intakten Teller zu legen, bemerkt er, dass die Luft sich verändert hat. Noch immer ist es heiß und so trocken, dass ihm die Augen tränen, doch nun ist da ein zuckriger Duft, der selbst den Geruch von Staub und Einsamkeit verdrängt, der sich in der Wohnung festgesetzt hat. Lior hat den Kuchen im Verdacht, der mit Honig und Sirup gesüßt ist, doch als er das Fenster öffnet, wird der Duft intensiver, so als hätte jemand eine Handvoll Zimt in den Wind gestreut.
Als das Gemurmel aus dem Wohnzimmer verstummt ist, bringt Lior seinem Vater ein Tablett mit seinem Imbiss, doch Mordechai rührt das Essen nicht an. Stattdessen sitzt er angespannt auf seinem Sessel und knetet die Hände im Schoß.
»Keinen Hunger heute, Aba?«, fragt Lior, und dann erst scheint Mordechai ihn wirklich wahrzunehmen. Er fasst seinen Sohn ins Auge und bemerkt, wie gut er aussieht. Schlank und sehnig wie er selbst in dem Alter. Aber das spielt keine allzu große Rolle, denn die Zeiten sind schlecht, und das sagt er seinem Sohn auch.
»Die Zeiten sind schlecht, mein Sohn«, sagt er. »Aber das wird sich bald ändern, die Zeichen stehen günstig. Du musst endlich anfangen, dein Leben in den Griff zu bekommen. Lebe nach der Schrift. Besuche die Synagoge. Und hör endlich auf, diese albernen Klamotten zu tragen, du siehst vollkommen meschugge aus.«
Mürrisch wendet Mordechai den Blick ab und starrt aus dem Fenster in den blauen Himmel, als erwartete er, dort Scharen von Cherubim zu sehen. Als sein Sohn sich schließlich verabschiedet und die Wohnung verlässt, steht Mordechai noch immer an derselben Stelle, den Blick fest auf den Himmel gerichtet.
***
Als Lior, erschöpft von diesem Besuch, nach draußen auf die Straße tritt, ist die Hitze fast mit Händen zu greifen. Augenblicklich bilden sich Schweißflecken unter seinen Achseln, und weiße Flecken tanzen vor seinen Augen. Im ersten Augenblick ist er von der Sonne derart geblendet, dass er die vielen Menschen nicht bemerkt, die sich auf der Hafenpromenade drängen. Ein Gewirr von Stimmen hängt in der Luft. Der Hund, der ihn noch immer verfolgt, fängt an zu bellen. Lior hat keine Ahnung, was eigentlich vor sich geht, aber da er von allen Seiten angerempelt wird, beschließt er, sich einfach treiben zu lassen. Am Ende der Straße, da wo die Mauern grün vor Algen sind und alte Boote in den Wellen dümpeln, hat sich eine Menschenmenge gebildet.
»Was ist denn hier los?«, fragt Lior einen alten Mann in einem gestreiften Hemd, der am Straßenrand steht.
»Eine Schlägerei!«
»Eine Schlägerei?«
»Ja, das sagte ich doch. Hören Sie nicht zu, Mann?« Unwirsch wendet der Mann sich ab und reckt den Hals, um besser sehen zu können.
»Nein, ein Wunder ist passiert!«, mischt sich eine dicke Frau in einem blauen Kleid ein.
»Was denn für ein Wunder? Ist der Likud zurückgetreten oder was?«, der Mann tippt sich an die Stirn.
»Sehr witzig, Sie Komiker«, antwortet die Frau ungehalten. »Ein Engel ist gesehen worden. Schon mehrmals!«
Lior fragt sich langsam, ob Wahnsinn womöglich ansteckend ist. »Für mich persönlich ist es ja schon ein Wunder, dass ich es heute Morgen überhaupt aus dem Bett geschafft habe, aber das meinen Sie wohl nicht, oder? Vielleicht war’s ja ein Scherz oder ein Werbegag, dieser Engel«, schlägt er hilfreich vor.
»Das hätte man doch gemerkt, Sie Trottel, denken Sie nicht, dass man das gemerkt hätte? Schauen Sie sich doch nur um! Hören Sie doch!«
»Ich höre nichts.«
»Eben!«
Da erst bemerkt es Lior. Anders als bei einer solchen Menschenmenge zu erwarten, herrscht eine nahezu andächtige Stille. Die Wellen schlagen leise an die Kaimauer und von ferne ist Verkehrslärm zu hören, doch ansonsten ist die Straße so ruhig, wie es nur Orte sein können, an denen es kurz zuvor hoch hergegangen ist. Ein paar Touristen filmen die Szene und wirken dabei mehr gelangweilt denn interessiert. Lior bemerkt einige Soldaten, die leise und vorsichtig patrouillieren. Auf ihren Gesichtern liegt eine Anspannung, als ob sie erwarteten, jeden Augenblick von einem Stein im Genick getroffen zu werden, doch in den Gesichtern vieler Umstehender spiegelt sich Entrücktheit wider. In ihren Augen liegt eine Sanftheit, die Lior noch nie zuvor an Menschen gesehen hat. Sie sehen aus, als hätte man ihre Seelen besänftigt.
***
Als Layla und Maroon am Hafen ankommen, ist die Menge gerade dabei, sich zu zerstreuen. Im Schatten der Häuser stehen Gruppen von Leuten, die sich leise unterhalten.
»Und wo ist jetzt dein Engel?«, fragt Maroon, während er umständlich an seinem Aufnahmegerät herumfummelt.
»Ich weiß es doch auch nicht«, sagt Layla und klingt dabei ungehaltener als beabsichtigt. Sie ist erschöpft, obwohl es gerade erst Mittag ist.
In der Luft hängt eine angespannte Ruhe, die die Aufregung der vorigen Stunden nur mühsam überdeckt. Layla erblickt einen Trupp Soldaten, die mit Gewehren im Anschlag die Straße beobachten.
»Hier ist etwas sehr Merkwürdiges passiert«, stellt sie fest.
Maroon und Layla sehen sich um. Vor ihnen geht ein kleiner Junge über die Straße – vorsichtig, als fürchtete er, mit seinen Schritten Lärm zu verursachen.
»He, du da!« Maroons Stimme durchbricht die Stille. Der Junge dreht sich um und geht treuherzig auf die beiden Journalisten zu. Bei näherem Hinsehen entpuppt er sich als ein mageres Kerlchen von etwa zehn Jahren mit einem lebensklugen Blick und großen schwarzen Augen wie ein Kalb. Die Hitze hatte beträchtlich zugenommen, doch dem Jungen schien sie nichts auszumachen.
»Möchten Sie ein Interview?«, fragt er auf Hebräisch und entblößt grinsend eine Zahnlücke. »Ich kann Ihnen eins geben, wenn Sie wollen, kostet auch nix. Aber ich will namentlich erwähnt werden, ich heiße Omar. Sind Sie von der Zeitung?«
»Vom Radio«, antwortet Layla auf Arabisch, während Maroon mit den Augen rollt.
Omar, dem der Sprachwechsel keinerlei Probleme zu bereiten scheint, nickt gut gelaunt und deutet auf den Pier. »Sehen Sie die Soldaten da? Die sind hier, weil es gerade fast eine Messerstecherei gab.«
»Eine Messerstecherei?«
»Ja, das sagte ich doch gerade.«
Layla, die beschlossen hat, dass ein Interview mit einem kaugummikauenden Knirps ihrem Boss gerade recht geschieht, bedeutet Maroon, das Aufnahmegerät einzuschalten.
Kaum hat Omar das Mikrophon unter der Nase, platzt die Geschichte wie ein Wasserfall aus ihm heraus. »Also alles fing damit an, dass Ahmed von der Tankstelle, er kommt übrigens aus Afula, aber seine Eltern leben nicht mehr, also Ahmed geriet mit einem Soldaten in Streit, weil er ihn einen dreckigen Besatzer genannt hat, aber das darf man Ahmed nicht übel nehmen, der ist manchmal so. Und dann wurde der Soldat wütend und stieg aus dem Wagen, mit gezücktem Gewehr müssen Sie wissen, und auf einmal waren da richtig viele Leute und schwupp, da flog schon ein Stein und dann ging es erst richtig los. Das mit dem Stein, das war einer von Ahmeds Brüdern oder Cousins oder so. Jedenfalls zogen die von der IDF ihre Knarren, ich dachte, jetzt knallt’s gleich. Und dann war da plötzlich so ein Kerl, der hatte ein Messer und rannte damit auf den Soldaten zu, so richtig wütend, aber wissen Sie was? Wissen Sie was dann passierte?«
»Nein, was denn?«
»Nix. Auf einmal wurde alles ganz still. Haben Sie mal eine Muschel an Ihr Ohr gehalten? So eine aus dem Meer?«
»Ja, erzähl weiter.«
»Also ich war erst einmal unten am Meer, aber so hörte sich das an, wenn man nix mehr hört, außer den Wellen. Na und der Mann mit dem Messer, der wurde plötzlich ganz ruhig. Wissen Sie, er guckte den Soldaten ganz seltsam an und warf dann das Messer weg. Und das Komischste war der Soldat, ich meine diese Typen sind ja immer irgendwie komisch, aber der war noch ganz jung und so, und auf einmal fängt der fast an zu flennen und macht so zwei Schritte auf den anderen zu. Und dann haben sie sich umarmt.«
»Sie haben sich umarmt?«
»Jawohl, Sayeda. Das haben sie getan und dann saßen sie auf der Straße wie zwei Schwule und klammerten sich aneinander fest. Nee, das stimmt nicht, da war nichts Verliebtes dran. Das war richtig – wie sagt man – heilig, wissen Sie?«
»Heilig?«
»Ja, wie ein Wunder. Haben Sie schon mal einen Soldaten einen Palästinenser umarmen sehen? Ich nicht. Also vorhin, das war das erste Mal, dass ich so was sah. Fast hätte ich auch geheult, aber ich bin nicht schwul.« Omar steckt sich geschäftig den Saum seines abgetragenen T-Shirts in die Hose.
»War das das Wunder, von dem alle reden?«
»Glaub schon.«
»Aber wurde nicht angeblich ein Engel gesichtet?«
»Ein Engel? Ja, klar. Schon mehrmals.«
»Und wie sieht er aus?«
»Weiß nicht, hab ihn nie gesehen.«
Mit diesen Worten dreht sich Omar um und schickt sich an zu gehen. »Ich muss los«, ruft er über seine mageren Schultern zurück, »man sieht sich!«
Nachdenklich blickt Layla ihm nach.
»Das war das nutzloseste Interview, das wir je geführt haben«, stellt Maroon fest und steckt sich eine Zigarette an. »Der Bursche hat uns doch vollkommen verarscht.«
»Irgendwas ist hier aber vorgefallen«, sagt Layla, noch immer gedankenverloren. »Etwas sehr Merkwürdiges.«
***
Als Lior die beiden Journalisten sieht, die unschlüssig herumstehen, beschließt er, sich aus dem Staub zu machen. Ihm liegt nichts daran, sich interviewen zu lassen, außerdem möchte er endlich raus aus der Hitze. Aber da dreht sich die Frau um, und Lior kann nicht anders, er muss sie einfach anstarren. Es ist wie verhext, aber er glaubt, sie zu kennen. Etwas in seiner Wahrnehmung hat sich verändert, er hört die Stimmen der Menschen um ihn herum nicht mehr und fühlt nicht mehr die Hitze auf seiner Haut. Alles, was er wahrnimmt, ist sein eigener Herzschlag und das Rauschen seines Blutes in den Ohren. Mit einem Mal wird er sich seines eigenen Körpers unangenehm bewusst, er spürt, wie der klebrige Schweiß in seinen Achselhöhlen juckt und wie sich Speichel im Mund sammelt. Er versucht zu schlucken, doch seine Kehle ist von der Hitze so ausgetrocknet, dass er ebenso gut Sand schlucken könnte. Er hat diese Frau nie zuvor gesehen, doch als sich ihre Blicke für den Bruchteil einer Sekunde treffen, ist es, als würde plötzlich alles an seinen Platz rücken. Das Gefühl währt nur einen kurzen Augenblick, doch als sie sich umdreht und geht, fühlt sich Lior einsamer, als er es je zuvor in seinem Leben war.
***
Seine Mutter ist in der Wohnung. Er weiß es, noch ehe er ihre Stimme hört, die wie eine Maschinengewehrsalve durch die Räume dringt. Sein Mitbewohner wirft ihm einen hilfesuchenden Blick zu, doch Lior weiß, wenn seine Mutter einmal in Fahrt ist, ist sie nicht so schnell zu bremsen.
»Ich musste sie reinlassen«, flüstert Dror ihm zu, »sie hätte sonst den ganzen Tag lang draußen gestanden und die Nachbarn belästigt.« Dror kennt sich mit älteren Damen aus, schließlich ist seine eigene Großmutter Maryam bald neunzig Jahre alt und wirr wie ein Albatros, doch Liors Mutter ist ein besonderer Fall.
Lior kann sehen, dass sein Mitbewohner die Wohnung aufgeräumt hat. Der übliche Berg Wäsche ist von der Mitte des Zimmers in eine Ecke gewandert, und das schmutzige Geschirr ist aus der Spüle verschwunden. Lior fragt seine Mutter, ob sie etwas trinken möchte und natürlich möchte sie. Tee. Zwei Löffel Zucker. Als er den Küchenschrank öffnet, dämmert ihm, wohin das schmutzige Geschirr verschwunden ist.
»Ich musste improvisieren«, raunt Dror entschuldigend. »Sie stand schon vor der Tür, als ich sie gehört habe.«
Das ist das Problem mit seiner Mutter, sie kündigt ihre Besuche nie an, und dann steht sie plötzlich da, ehe man auch nur die Zeit gehabt hat, das Geschirr zu spülen oder sich eine gute Entschuldigung einfallen zu lassen.
Er schiebt einige klebrige Kaffeebecher und Schalen voll eingetrockneter Cornflakes zur Seite und tastet blind nach der Packung Beuteltee. Als das Teewasser aufgesetzt ist, macht sich Lior ein Bier auf, was seine Mutter dazu bringt, missbilligend mit der Zunge zu schnalzen.
»Soso, jetzt fängst du also auch schon an. Genau wie dein Vater früher.«
»Womit fange ich an?«
»Du trinkst! Mitten am Tag!«
»Es ist doch nur ein Bier, Mama.«
»Oh vey! Nur ein Bier. Das sagen sie alle. Ich weiß ganz genau, wohin das führen wird. Genau damit fängt es immer an. Nur ein Bier und danach noch eines, und ehe man sich’s versieht, fangt ihr an herumzuhopsen, singt Lieder und weckt die Kinder auf.«
»Hier gibt es überhaupt keine Kinder.«
»Und warum nicht, möchte ich wissen? Das hier ist auch kein geeigneter Ort für ein Kind. Viel zu klein. Und überall liegt Schmutz. Schmutz!«
Das letzte Wort sagt sie so laut, dass Lior die Augen schließt.
»Warum heiratest du nicht, Junge?«
Lior macht die Augen wieder auf und betrachtet die Kondenstropfen auf der Flasche so eingehend, als wären sie seine guten Freunde.
»Ich sage es dir, du jüdischste aller Mütter. Weißt du, es ist so: Ich gucke zu gerne den Mädchen auf den Hintern. Und wenn man erst einmal verheiratet ist, ist es damit aus und vorbei.«
Seine Mutter starrt ihn eine Weile aus zusammengekniffenen Augen an. »Du bist so ein seltsamer Junge«, sagt sie. »Ich wünschte nur, du würdest endlich hier sauber machen.«
Lior lehnt sich zurück und faltet die Hände über der Brust, obwohl er sich lieber die Faust in den Mund stecken würde, um nicht laut zu schreien. »Mutter«, sagt er, »das ist so, als würdest du Noah bitten, die Fensterläden seiner Arche zu schließen, weil es regnet.«
»Werden Sie nicht frech, junger Mann«, gibt seine Mutter zurück. »Ich mache mir Sorgen wegen deines Vaters. Falls es dich interessiert.«
»Was ist mit unserem alten Eremiten?«, will Lior wissen. »Vorhin machte er mir einen ganz munteren Eindruck. Wir haben über Mode geplaudert und ein wenig über die Unwägbarkeiten der Politik. Er wirkte durchaus optimistisch, was ich daran festmache, dass er mich nur einmal beschimpft hat.«
»Lass doch die dummen Witze, Lior. Du weißt doch, wie er ist. Aber ich bin tatsächlich in Sorge.«
»Das sagtest du schon. Und weswegen bist du in Sorge?«
»Engel.«
»Was?«
»Engel. Dein Vater glaubt neuerdings an Engel.«
»Ist der Glaube an Engel nicht Teil des ganzen religiösen Getues?«, fragt Lior. »Ich meine, er glaubt ja auch daran, dass Gott nicht will, dass wir uns am Sabbat die Hände schmutzig machen. Wusstest du beispielsweise, dass er sich am Freitagmorgen das Klopapier für den Sabbat bereitlegt, weil Papier abreißen als Arbeit gilt? Wusstest du das?«
»Nur weil dein Vater die Thoragesetze befolgt, heißt das nicht, dass er verrückt ist. Aber die Sache mit diesem Engel ist was anderes.«
»Wieso ist das was anderes?«
»Weil es nicht um Engel an sich geht«, sagt seine Mutter, »sondern um einen bestimmten Engel. Dein Vater denkt, der Messias wird kommen.«
»Was ist daran neu?«
»Er denkt, er wird bald kommen. Jetzt sofort.«
»Und was hat dieser Engel damit zu tun?«
»Dein Vater denkt, er ist der Vorbote. Hat er was gegessen?«
»Ob er was gegessen hat? Warum ist es wichtig, ob er was gegessen hat, wenn er doch dabei ist, den kümmerlichen Rest seines Verstandes zu verlieren?«
»Werd nicht frech. Du weißt doch, wie er ist. Er lebt eben in seiner eigenen Welt. Willst du wissen, was ich denke? Willst du’s wissen?«
»Du wirst es mir doch sowieso erzählen, was macht es da also für einen Unterschied, ob ich …«
»Ich glaube wirklich – und das meine ich ernst – dass dein Vater nach diesem Engel sucht. Er sucht ja ständig nach all diesen Zeichen. Er ist so schrecklich empfänglich für solche Dinge. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was mit ihm nicht stimmen könnte.«
»Was mit ihm nicht stimmt? Du liebe Güte, wo soll ich anfangen?«
»Du kennst deinen Vater so gut wie ich ihn kenne. Das solltest du jedenfalls, er ist immerhin dein Vater. Von mir nimmt er ja keinen Ratschlag an. Ich bin für jeden in dieser Familie nur eine Last.«
Liors Mutter nimmt einen Schluck Tee, wobei sie das Kunststück fertigbringt, zugleich vorwurfsvoll und resigniert auszusehen.
»Was also willst du, dass ich tue?«, fragt Lior.
»Alles, was ich will ist, dass du ein Auge auf ihn hast«, gibt seine Mutter zurück und streicht sich würdevoll eine Haarsträhne aus der Stirn. »Falls du dafür Zeit erübrigen kannst.« Sie klopft mit einem langen, rot lackierten Fingernagel gegen Liors Bierflasche und zieht die Augenbrauen hoch. »Bei all dem Stress den du hast.«
»Ein Auge, zwei Augen – ich werfe so viele Augen auf ihn, wie du willst«, seufzt Lior.
»Engel«, schnaubt seine Mutter, als sie sich anschickt zu gehen. »Ausgerechnet Engel.«
***
»Mein Bruder lebt noch, aber vor dem Ramadan bringen sie ihn um«, versichert Omar dem Polizisten, der ihn verständnislos anstarrt.
»Woher hast du denn diesen Scheiß?«
»Von Yvonne, und die hat es aus den Teeblättern.«
»Und wer zur Hölle ist Yvonne?«
»Na, Yvonne eben. Sie kommt aus Jaffa. Sie ist gut. Wenn Sie wollen, bringe ich Sie mal hin, die liest Ihnen die Zukunft, da schlackern Ihnen nur so die Ohren!«
Der Polizist, dem nichts ferner liegt, als eine arabische Möchtegern-Hexe aufzusuchen, schnaubt unwillig und bringt dann sein Gesicht ganz nah an das von Omar. »Hör mal, Kleiner, wenn du mir nicht sofort sagst, wer diesen Aufstand angezettelt hat, dann landest du schneller bei deinem Bruder, als dir lieb ist. Und wer weiß, vielleicht könnt ihr dann euren Ramadan zusammen feiern. Im Knast kommt sicher die richtige Stimmung auf, meinst du nicht?«
Der Polizist lacht kehlig über seinen eigenen Witz, doch Omar verzieht keine Miene.
»Ich hab euch doch gesagt, ich weiß es nicht. Wann lasst ihr meinen Bruder frei?«
»B’chaim lo! Wenn dir die Sonne aus dem Arsch scheint, du kleiner Scheißer. Und jetzt hau ab!«
Chaim Levy wischt sich mit einem Taschentuch den Schweiß vom Nacken und steckt sich dann eine Zigarette an. Er ist seit über dreißig Jahren im Dienst, und nie war es ein schlimmeres Elend mit diesen verfluchten Arabern. Die machen, was sie wollen. Solange sie sich einfach in ihren kleinen Terrorzellen zusammenrotteten, waren sie irgendwie noch kontrollierbar, aber gegen diese spontanen Ausbrüche von Gewalt ist selbst der Shin Bet machtlos. Kein Mensch weiß, wann einem von ihnen wieder die Sicherung durchbrennt, und dann gibt es wieder Witwen und Mütter, die heulen, weil einer ihre Ehemänner, Söhne oder Töchter erstochen hat. Und da nützt es auch nichts, wenn einer von ihnen zusammenbricht und sein wertloses Leben bereut, die Zeiten sind schlecht und die nächste Intifada nur eine Frage der Zeit.
Als Chaim achtzehn Jahre alt war, joggte er jeden Morgen zehn Kilometer und stemmte Gewichte, bis sein Oberkörper so gestählt war, dass sich die Muskeln an seinem Bauch wölbten wie Panzerketten. Seine Fäuste waren so hart, dass er damit gegen Eisen schlagen konnte, ohne sich zu verletzen, aber trotzdem ging er eines Abends los und kaufte sich ein Bowie-Messer. Eines mit einer guten stählernen Klinge, die auch heute noch so scharf ist, dass er sie in einem metallenen Futteral aufbewahren muss. Er säubert das Messer mit Spiritus und einem weichen Baumwolltuch, und jedes Mal wenn er das tut, gibt ihm das ein grimmiges Gefühl der Zufriedenheit. Es gibt genau zwei Dinge, die ihm heilig sind. Das eine ist sein Land, das andere ist sein Hund Loretta, ein Dobermann-Mischling mit schlechtem Charakter und ebenso schlechtem Atem. Für diese beiden würde er töten, was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum er nach seinem Wehrdienst in der Armee geblieben ist. In seiner Grundausbildung war Chaim der disziplinierteste von allen, und bis heute macht ihm im Messerwerfen niemand etwas vor. Er kann mit seinem Messer auf zwanzig Schritt Entfernung den winzigen Docht einer Kerze durchtrennen, und das Herz eines Gegners bei Dunkelheit zu treffen, würde ihm keinerlei Probleme bereiten. Er empfindet es als persönliche Beleidigung, dass dieser verdammte Araber einen seiner Männer ausgerechnet mit einem Bowie-Messer angreifen wollte. Wenn er ihn verletzt oder getötet hätte – all das wäre zu verschmerzen gewesen. Aber offensichtlich hat dieser vereitelte Angriff seinem Soldaten den Verstand geraubt, denn er behauptet seither, der Angreifer habe ihm nichts tun wollen und sei in Wahrheit ein Engel gewesen, ein Engel mit dem Zorn eines Heiligen. Alleine der Gedanke an das schwachsinnige Geschwätz des Soldaten lässt in Chaim die Wut hochkochen.
Verärgert schließt er seinen Streifenwagen auf und lässt seinen massigen Leib auf den Fahrersitz fallen. Am liebsten würde er sie alle in Vorbeugehaft nehmen, all die gemeingefährlichen arabischen Terroristen und ihre kleinen naseweisen Brüder, doch schon jetzt sind die Gefängnisse übervoll. Aber er soll verdammt sein, wenn in seiner Amtszeit und in seinem Revier der nächste Aufstand ausbräche. Bei Gott, das würde er zu verhindern wissen.
***
Omar ist so arm, dass er sich nicht mal einen Nachnamen leisten kann, jedenfalls sagt ihm das jeder. Seit sein Bruder verhaftet wurde, schläft Omar mal bei diesem, mal bei jenem Verwandten, isst, was ihm angeboten wird und stiehlt, was er sonst so braucht. Ab und zu ergattert er einen Job und hilft bei der Obsternte, pflückt Oliven und sortiert Mangos und Bananen für ein paar Groschen oder ein Abendessen. Einmal hat er einen Sommer lang Granatäpfel ausgepresst, bis seine Finger eine dunkle, fast schwarze Farbe angenommen hatten und aussahen, als wären sie von getrocknetem Blut bedeckt. In letzter Zeit aber arbeitete er als Laufbursche für einen mürrischen Sesamkringelbäcker aus Tiberias. Es ist ein Job, den er bereits satthat, seit er ihn begonnen hat, was auch der Grund dafür ist, warum er lieber am Hafen herumhängt und mit den Füßen über der Kaimauer baumelt, anstatt die Kringel zu verkaufen. Trotz seiner zehn Jahre ist Omar es gewohnt, sich um sich selbst zu kümmern. Und so wundert sich niemand, als er an jenem Abend, dem Abend des Wunders, einfach verschwindet. Eigentlich hat er nicht vorgehabt, das Weite zu suchen, denn in der nächsten Woche hätte er einen lukrativen Job in einer Gärtnerei in Aussicht gehabt, doch das Verhör mit dem Polizisten macht ihm zu schaffen. Mit der Polizei kommt Omar schlecht klar, so viel steht fest. Zwar ist er so abgebrüht, dass er sich mit einem Messer in die Hand stechen könnte, ohne auch nur zu zucken, und wenn ihm eine schwere Obstkiste auf die nackten Zehen fällt, sagt er nicht einmal aua, doch vor Kerlen in Uniform muss man sich in Acht nehmen, das ist ihm klar. Im Alter von vier Jahren hat Omar beide Eltern verloren. Sein Vater, ein Autohändler aus Kfar Kanna, starb bei einer Razzia. Es war ein Unfall, sagten die Soldaten. Seine Mutter, von Natur aus mit keiner guten Konstitution gesegnet, starb nur wenige Monate später. Sie ist an gebrochenem Herzen gestorben, dessen ist sich Omar sicher. Am Ende waren nur noch sie beide da, er und Majed, sein Bruder, der zwölf Jahre älter ist als er. Majed war einer der Leute, zu denen alle aufsehen. Ein echter Anführer, klug und charmant, und Omar betete ihn an. Als Majed das erste Mal verhaftet wurde, zwei Wochen nach seinem siebzehnten Geburtstag, hatte er eine Brechstange, fünfzig Gramm Marihuana und dreihundertfünfzig Schekel in bar bei sich, was ihn auch dann verdächtig gemacht hätte, wenn nicht gerade ein Kiosk auf der Hauptstraße von Tiberias aufgebrochen worden wäre. Mit der Verhaftung seines Bruders begann Omars mühsame Reise durch seine weitverzweigte Verwandtschaft, während Majed seine Zeit abwechselnd auf der Straße und im Gefängnis zubrachte. In den nächsten Jahren sollte er noch zwei weitere Male wegen kleinerer Diebstahldelikte verhaftet werden, doch bei seiner letzten Verhaftung ging es um mehr. Sie schleppten ihn fort in ein Gefängnis für potenzielle Terroristen und schlossen die Tür hinter ihm, womöglich für immer. Das war vor vier Monaten, und seither hat Omar beschlossen, er sei nun erwachsen und in der Lage, für sich selbst zu sorgen. Dieser Selbsterhaltungstrieb hat ihn auch an diesem Nachmittag dazu gebracht, den nächstbesten Lastwagenfahrer um eine Mitfahrgelegenheit nach Jerusalem zu bitten, wohin er nun auf dem Weg ist, eingezwängt zwischen Kisten voller Äpfel und grüner Paprika.
Als Omar in Jerusalem von der Ladefläche des Lasters springt, ist es dunkel geworden. In der Dämmerung kann er die Mauern der Altstadt ausmachen und über ihm die Zinnen des Damaskustors. Die Besucherströme sind verebbt, die Stufen vor dem Tor sind, bis auf ein paar Tauben und Katzen, die ihnen auflauern, leer. Die Stadt, die sich über ihm erhebt, leuchtet im Licht der funzeligen Laternen so majestätisch wie eh und je, nur hat sie in letzter Zeit ein wenig an Glanz verloren, durch allzu viele Touristen und allzu große historische Ernüchterung.
Omar hat den Mann nicht kommen hören, und als er seinen Griff im Nacken spürt, reißt ihn der Schreck in die Wirklichkeit zurück, sodass er im ersten Moment nicht weiß, wo er ist.
»Hab ich dich, du kleine Ratte. Rück sofort meine Geldbörse raus, sonst rufe ich die Polizei, du elender verdammter Dieb!«
»Ich hab Ihre scheiß Geldbörse nicht, Sie Penner, nehmen Sie Ihre Hände von mir!«
»Das kann jeder sagen, aber von euch Schmarotzern lasse ich mich nicht beklauen!«
»Ich bin Tourist!«
»Tourist, dass ich nicht lache! Ich rufe jetzt die Polizei, du kleiner Mistkerl!«
Doch Omar hat sich bereits aus dem eisernen Griff gewunden, und eine ohnmächtige, blinde Wut erfüllt ihn. Er wirft sich nach vorne, schlägt in die Dunkelheit und plötzlich kollert der Mann die Stufen hinunter, fluchend und zeternd, und Omar rennt davon, so schnell ihn seine mageren Beine tragen. Nach wenigen Metern hat er das Tor erreicht und stürzt so schnell durch die spärlich beleuchteten Gassen, dass ihm erst nach einiger Zeit klar wird, dass er die Kippa des Mannes noch immer in der Hand hat. Er muss sie ihm versehentlich vom Kopf gerissen haben. Schnell schüttelt er das zerquetschte Ding ab und wirft es in den nächsten Rinnstein.
Die Schwüle des Tages ist von den dicken Mauern aufgesogen worden und nun, in der Nacht, strahlen die uralten Steine eine erstickende Mischung aus Hitze und Vergangenheit ab, die das Atmen und das Herz schwer macht. Eine Weile folgt Omar zwei beseelten Pilgern, die die späte Stunde für einen romantischen Spaziergang nutzen, und hält sich unauffällig in deren Windschatten bis ihn die Müdigkeit übermannt und er einfach stehen bleibt und sich die Augen reibt. Aus den wenigen Cafés, die er passiert, riecht es nach Abendessen, doch Omar hat kein Geld und keine Lust, sich etwas zu stehlen. So hockt er sich einfach in einen Hauseingang, fischt eine Zigarette aus seiner hinteren Hosentasche und fängt an, Rauchringe zu blasen. Er ist so vertieft in diese Tätigkeit, dass er den Mann nicht bemerkt, der sich neben ihn gestellt hat, und als er angesprochen wird, reißt Omar den Kopf hoch.
»Was ist los mit dir?« Der Mann trägt eine Galabiya und eine Brille mit Goldrand und hat freundliche Augen.
»Sie haben meinen Bruder eingesperrt, und mich werden sie sicher auch bald einsperren.«
»Wie alt bist du?«
»Zehn.«
»Dann dürfen sie dich nicht einsperren, du bist minderjährig. Da sind die Menschenrechtsorganisationen ziemlich strikt dagegen. Obwohl man nie weiß, was denen so einfällt, nicht wahr?«
»Ich habe einen Mann die Treppe runtergeschmissen.«
»Wie das?«
»Mit voller Wucht.«
Der Mann setzt sich neben ihn und betrachtet ihn von der Seite, während er seine Brille poliert. »Für einen so kleinen Bengel bist du ziemlich gerissen, weißt du das?«
»Ich weiß«, sagt Omar. »Haben Sie vielleicht noch eine Zigarette?«
»Bist du nicht ein bisschen jung zum Rauchen?«
»Glaub ich nicht.«
»Was ist mit deinen Eltern?«
»Die sind tot.«
»Inna L’illahi wa inna illeyih rajun – Wir gehören Allah und zu Allah kehren wir zurück. Mögen sie in Frieden ruhen. Dann bist du also ganz alleine?«
»Ja, aber das macht mir nix.«
»Ich heiße Youssef Aboud, mir gehört der Teppichladen dort vorne.«
»Ich heiße Omar, mir gehört fast nix, aber wenn Sie mich bei sich schlafen lassen, dann klopfe ich Ihnen alle Teppiche aus und fege den Laden und mache alles, was Sie sonst noch erledigt haben wollen. Ich bin handwerklich echt gut, kann super mit dem Hammer und so umgehen, wissen Sie. Also was sagen Sie? Deal?«
»Wenn du auch nur einen meiner Teppiche anrührst, werde ich dir deinen Hintern versohlen, bis du nicht mehr sitzen kannst und von Hämmern und sonstigem Werkzeug lässt du gefälligst die Finger, ich verkaufe da drinnen nämlich auch Geschirr. Ich brauche aber einen Laufburschen, der der Kundschaft Tee serviert und die Warenlieferungen vom Parkplatz in den Laden trägt. Wenn du deine Sache gut machst, bist du engagiert. Gegen Kost und Logis. Einverstanden?«
»Tamam, alles klar!«, sagt Omar und schlägt ein.
***
Nun, da Layla, barfuß und erhitzt, auf ihrer Dachterrasse sitzt, ist die Vergangenheit so nah wie die Gegenwart. Den ganzen Tag über, während sie in Tiberias war, hat sie das Gefühl gehabt, unter einer Glaskuppel zu leben. Die Hitze, die Soldaten, selbst der kleine Junge – all das nahm sie wie durch einen dicht gewobenen Schleier wahr; ein Schleier, so dick wie eine Wand aus Panzerglas. Sie hörte und sah alles, tat ihre Arbeit, doch bei alledem war sie nie richtig anwesend. Ihre Sinne waren auf etwas anderes gerichtet, auf einen anderen, weit entfernten Ort, wo der Schnee in dicken Flocken fällt, um Asche und Blut zu überdecken. Sie ist auch jetzt an diesem Ort, obwohl sie eigentlich Gemüse fürs Abendessen putzen sollte. Es gibt Sheikh el Mahshi, mit Reis gefüllte Auberginen, aber so wie es aussieht, wird das Essen noch eine Weile auf sich warten lassen, denn unten vor dem Haus steht eine kleine gebeugte Frau mit einem Rollator und starrt zu ihr hinauf. Die Frau schiebt ihren Wagen noch näher an das Haus heran, und Layla kann sehen, dass sie ein altmodisches geblümtes Baumwollkleid und weiße Frotteeslipper trägt und viel älter ist, als es von weitem den Anschein hatte. Ihre weißen Haare sind mit irgendetwas gefärbt, womöglich Henna, was aber nur zur Folge hat, dass sie eine merkwürdige rosa Farbe angenommen haben, so wie die Wolken, die jetzt im Sonnenuntergang purpurn leuchten. Die Frau parkt ihre Gehhilfe sorgfältig neben den Eingangsstufen und blickt angestrengt nach oben. Layla stutzt. Sie kennt jeden aus dem Dorf, doch diese Frau hat sie nie zuvor gesehen. Sie hat keine Ahnung, woher sie gekommen ist, womöglich ist sie aus irgendeinem Heim ausgebüxt und findet den Weg zurück nicht mehr. Aller Wahrscheinlichkeit nach kommt sie aus dem Kibbuz unten am Hang, dort wo die hohen Mauern einem jegliche Sicht versperren. Seufzend steht Layla auf und beugt sich über die Brüstung.
»Shalom! Efshar la’azor lach? Wie kann ich Ihnen helfen?«, ruft sie hinunter. Ihr Hebräisch ist perfekt und poliert wie ein Flusskiesel, schließlich hat sie lange genug zwischen Israelis studiert, und trotzdem schleicht sich, wie immer wenn sie die Sprache spricht, ein bitterer Geschmack in ihren Mund. Doch die alte Frau scheint wie am Boden festgeklebt. Ihre arthritischen Finger umklammern die Griffe ihres kleinen Wägelchens, und sie macht keine Anstalten, sich zu rühren.
Mit einem weiteren Seufzer macht Layla kehrt und hastet die Treppen hinunter. Die Frau ist Jüdin und alt, und obwohl Layla keinem ihrer Nachbarn zutrauen würde, einer alten Frau etwas zuleide zu tun, so ist ihr kleines arabisches Dorf kaum ein geeigneter Ort für eine verwirrte Lady aus einem Kibbuz. Außerdem hat sie keine Lust auf die misstrauischen Fragen der Dorfbewohner, wenn diese bemerken, dass eine komische kleine Jüdin bei ihnen vor der Tür steht.
Als Layla vor ihr steht, bemerkt sie, dass die Frau klare wasserblaue Augen hat, die unschuldig und leicht entrückt in die Welt blicken.
»Haben Sie meinen Mann gesehen?«, fragt die Frau, und Layla ist überrascht, wie hoch und kindlich ihre Stimme klingt.
»Ihren Mann? Nein, wie sieht er denn aus?«
»Wir wollten heute nämlich tanzen gehen, wissen Sie? Mein Mann führt mich jedes Wochenende zum Tanzen aus.«
Layla, die bezweifelt, dass ihre Besucherin auch nur zu einem langsamen Walzer imstande wäre, fasst die Frau am Arm, um sie zu stützen. Ihre Haut fühlt sich an wie knisterndes Seidenpapier, dünn und trocken. Sie muss mindestens achtzig Jahre alt sein.
»Ich habe Ihren Mann nicht gesehen, setzen Sie sich doch einen Augenblick.«
»Und Simon? Haben Sie Simon gesehen? Er ist noch klein …«
»Ich habe ehrlich keine Ahnung, wovon Sie sprechen, aber wenn Sie mir sagen, woher Sie kommen, werde ich Sie zurückbringen, okay?«
»Sie sind ein nettes Mädchen, können Sie auch tanzen?«
»Ja, ja, ich tanze jeden Tag. Wie ein Derwisch. Aber kommen Sie, ich bringe Sie besser nach Hause.«
»Ich kann tanzen wie Judy Garland. Jedenfalls sagt das mein Mann Hubert. Er ist ein großer Tänzer. Wie Judy Garland. Haben Sie ihn zufällig gesehen?«
Den ganzen Weg zurück über die Hügel plappert die Frau mit ihrer Kleinmädchenstimme und klammert sich dabei an ihr Wägelchen, das bei jedem Schlagloch scheppert wie ein Besteckkasten. Als sie das Ende der Straße erreichen und die Zäune des Kibbuz in Sichtweite kommen, bleibt die alte Frau stehen und sieht Layla direkt ins Gesicht. »Ich konnte Zäune nie leiden, wissen Sie. Vor allem die mit den spitzen Stacheln. Mögen Sie Zäune?«
Layla möchte antworten, doch ehe sie den Mund öffnen kann, spürt sie den Sog, und vor ihre Augen schieben sich die Bilder, ehe sie auch nur die Chance hatte zu blinzeln. Sie wundert sich noch, wie schwer die Luft plötzlich geworden ist, so zäh und dick, dass sie kaum atmen kann. Ihre Nasenlöcher blähen sich, doch die Luft ist wie bleierner Dampf. Dann beginnen ihre Trommelfelle zu vibrieren, ein Rauschen und Wispern erfüllt ihre Ohren, dringt in ihre Gedanken wie Nebel. Die Stimme der alten Frau vermischt sich mit diesem Rauschen, das eine Mauer zwischen Layla und der Wirklichkeit schafft.
Sie steht auf einem Bahnsteig, und der schneidend kalte Wind dringt durch das dünne Futter ihres Mantels. Männer in schweren Stiefeln schreien die Frauen und Kinder an, die sich ängstlich aneinanderdrücken. Ihre Mutter schließt ihre eiskalten Finger hart um ihr Handgelenk und zieht sie zu sich. Doch diesmal ist ihre Umarmung nicht tröstlich und warm, sondern hart und verzweifelt. Die Angst ist überall. Sie kriecht durch die Ritzen der Zugwaggons, sie ist in der kalten Luft, die nach süßlichem Rauch riecht und sie ist in den Gesichtern der Menschen, die mit großen Augen auf das Tor hinter den Bahngleisen blicken, das sich langsam schließt. Als Layla aufsieht, ist die Landschaft hinter einer Mauer aus Stacheldraht verschwunden.
Von allen Kindern Kfar Jalas war die Tochter von Mahmoud und Sabah Al-Riadh die merkwürdigste, das jedenfalls versicherten sich die Nachbarn. Es spielte keine Rolle, wie oft Laylas Eltern ihnen auch erklären, ihre Tochter habe keine speziellen Kräfte und könne weder Geister noch die Zukunft sehen. Von dem Augenblick an, als Layla in die Mittelstufe kam, begannen die Gerüchte, was Sabah dazu veranlasste spöttisch zu erklären, die einzige Besonderheit, die ihre Tochter hätte, sei die Fähigkeit, blitzschnell zu verschwinden, wenn es Arbeit gäbe. Irgendwann jedoch verloren auch die Neugierigsten das Interesse und hörten auf, über den Vorfall zu spekulieren, der die ganze Aufregung überhaupt erst ausgelöst hatte. Der Vorfall, den weder Layla, noch ihre Eltern jemals erwähnten, ereignete sich zwei Tage nach Laylas zwölftem Geburtstag. Layla war auf dem Heimweg von der Schule, als sie plötzlich wie vom Blitz getroffen stehen blieb und, kreidebleich im Gesicht, auf die Straße vor sich zeigte. Dann fiel sie ohnmächtig um. Es war purer Zufall, dass sich an derselben Stelle, auf die sie gezeigt hatte, am nächsten Tag ein Unfall ereignete, der zwei Tote forderte, denn was Layla eigentlich gesehen hatte, bevor sie wie ein gefällter Baum zu Boden ging, war ein kleines Mädchen mit traurigen Augen und einem abgetragenen Wintermantel. Ein Mädchen, das außer ihr niemand sehen konnte, wie sich bald herausstellte, denn in jener Nacht fingen die Träume an. Erst spärlich, fast sachte. Später, als Layla älter wurde, wurden auch die Träume intensiver, plastischer und auf eine merkwürdige Art realistischer als andere Träume. Sie kamen selten, doch wenn sie kamen, dann mit der vollen Wucht ihrer Eindrücklichkeit, sodass Layla oft schweißgebadet und mit klopfendem Herzen aufwachte. Doch bis zu diesem Abend kamen die Träume nur nachts, niemals wieder tagsüber, niemals wenn sie, so wie jetzt, hellwach war. Während Layla mühsam in die Wirklichkeit zurückkehrt, sieht sie gerade noch, wie die kleine alte Frau ihr von ferne zuwinkt, und dann beherzt die Straße zum Kibbuz entlangmarschiert, wobei sie die wilden Kaninchen aufschreckt, die hier in den Hügeln leben. Layla sieht ihr nach, bis sie hinter den Toren verschwunden ist, die den Kibbuz vor der Außenwelt beschützen. Noch immer ist ihr kalt, obwohl der Abend mild ist und die Luft nach wildem Hibiskus und Ozon riecht. Der Stoff ihrer dünnen Bluse scheuert unangenehm auf der Haut ihrer Arme, und ihre Muskeln fühlen sich steif an und schmerzen. Doch das, was ihr wirklich zu schaffen macht, ist nicht so sehr die Tatsache, dass ihre Träume offenbar beschlossen haben, nun auch bei hellem Tageslicht zu erscheinen, sondern vielmehr, dass sie sicher ist, dass die alte Frau nicht auf Hebräisch über ihre Zaunphobie lamentiert hat, sondern in einer fremden Sprache. Eine Sprache, die Layla nie zuvor gehört hat, und doch hat sie jedes Wort verstanden.
***
Der Engel liegt auf dem Rücken unter einem Baum und sieht einer El-Al-Maschine nach, die in nördlicher Richtung unterwegs ist. Durch die dichten Zweige sieht er nur einen kleinen Ausschnitt des blauen Himmels, doch der genügt ihm. Auf der Erde hat der Engel wenig, wofür es sich zu existieren lohnt, und er sehnt sich nach der Luft, die sich über ihm spannt wie ein Betttuch aus feinster blauer Seide. Er ist schon sehr lange neunzehn Jahre alt, und obwohl er sich immer noch blitzschnell bewegen kann, hinterlassen seine Füße keine Spuren mehr im Sand. Hier, am Boden des Himmels, hat er sich immer fremd gefühlt. Selbst als er noch ein Mensch war, haftete ihm etwas Übernatürliches an. Als er ein Kind war, war seine Haut so zart und weiß wie Butter, und sein Haar war nachtschwarz. Mit zwei Wochen hat er jedem, der vorbeikam, die Hände entgegengestreckt und gelächelt. Alle nannten ihn nur »das süße Kind«, alle außer seiner Mutter, die ihn ihr Gottesgeschenk nannte. Während er unter dem Baum liegt, hat er das Gefühl, so leicht wie eine Dunstwolke zu sein. Er verhält sich vollkommen still, um die Vögel nicht aufzuschrecken, die in der Platane nisten. Das Gras unter dem Baum ist so weich, als hätte es noch nie jemand betreten, und der Engel fühlt die feuchten Halme an seinem Nacken kitzeln, als ihm die Polizisten die Schultern tiefer in den Boden drücken und ihn herumrollen, um ihm Handschellen anzulegen.