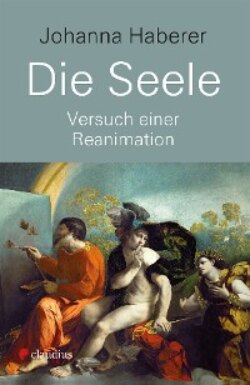Читать книгу Die Seele - Johanna Haberer - Страница 8
Selbstgespräche
ОглавлениеAllein die Existenz reflexiver Verben in fast allen Sprachen der Welt zeigt, dass wir Menschen uns im Denken als Subjekt und Objekt zugleich verstehen können: Wenn ein Subjekt etwas macht, das sich auf das Subjekt selbst bezieht, dann muss das Subjekt zugleich auch das Objekt der Aktion sein.
So können wir uns nicht nur selbst die Zähne putzen oder die Haare föhnen, sondern wir sprechen auch davon, uns selbst zu trösten. Wir können uns selbst betrügen und belügen, wir können uns ängstigen und uns beklagen, wir können uns informieren und uns interessieren, wir können es uns gut gehen lassen und uns ausruhen, wir können uns ärgern und uns entscheiden, wir können uns wohlfühlen und verirren, wir können uns verlieben und – wir können uns sogar ändern. In jedem Fall existiert in unserer Sprache das Selbst als eine Instanz, die mit sich selbst kommunizieren kann. Dieses Reflexionsfeld, diesen Resonanzraum nennen wir „Selbstbewusstsein“.
Die Kluft zwischen der naturwissenschaftlichen und technischen Abbildung menschlicher Denk- und Gefühlsprozesse und der Wirklichkeit der Sprache könnte tiefer nicht sein. Sprache schafft Evidenzen, die von der naturwissenschaftlichen Logik nicht erfasst werden können. Die Philosophen Paul Ricoeur und Hans Blumenberg nähern sich diesem Phänomen auf unterschiedliche Weise. Für beide aber ist der Begriff der Metapher erkenntnisleitend.
Eine Metapher beschreibt bekanntlich Phänomene in Bildern und verdeutlicht Gemeintes, indem Bilder aus anderen Kontexten zur Beschreibung herangezogen werden. Es entsteht also in der zwischenmenschlichen Kommunikation eine Bildsprache, die Unsagbares sagbar macht und gerade durch Überraschung und assoziative Freiheit die Wahrnehmung der Menschen erweitert und Begriffe von Scheuklappen befreit.
Blumenberg sagt: Die Sprache schafft Bilder für die Wahrnehmung, die eine „unmittelbar einleuchtende Bedeutung eröffnen, die sich anders als metaphorisch nicht, oder (noch) nicht aussagen lässt.12
Eine Metapher für das Selbst-Sein des Menschen, seine Individualität und seine Offenheit gegenüber der Welt und Gott scheint der Begriff „Seele“ zu sein.
„In der Philosophie nennt man einen ‚Begriff‘, was man in der Dichtung ‚Metapher‘ nennt. Das Denken schöpft aus dem Sichtbaren seine Begriffe, um das Unsichtbare zu bezeichnen“, schrieb die Philosophin Hannah Arendt13, und der französische Philosoph Paul Ricoeur bezeichnete die Metapher als „Instrument der Welterfassung“ und als einen Weg, „Denkprozesse zu beginnen und zu befördern“.14 Metaphern sind also Begriffe, die einen Denkprozess anstoßen, der niemals zum Abschluss kommt.
Für dieses Offenhalten des Denkens durch Sprache wäre eine Re-Animation des Seelenbegriffs auch in Philosophie und Theologie ein Zugeständnis, das Geheimnis des Lebendigen zu schätzen und sich nicht ausschließlich mit der Wortwelt der empirischen Psychologie, der Bio- und der Neurowissenschaften zu begnügen.
Viele Sprachschöpfungen, die das biblische Erbe in der theologischen, kirchlichen und liturgischen Sprache übermitteln, haben einen metaphorischen Charakter und wirken im anerkannten akademischen Wortschatz bedeutungslos und veraltet. Trotzdem gehen mit ihnen zugleich ganze Welten der Empfindungen und Denkhorizonte unter.
Ist in der jüdisch-christlichen Tradition von Vergebung die Rede, von Erlösung, Sünde und Trost, ja von Gott und der Seele – so sind diese Begriffe in dem Sinne metaphorisch, als sie keinem beschriebenen Objekt entsprechen, sondern unbeschreibliche Erfahrungen umfassen. Begriffe, die dem Einzelnen die Möglichkeit geben, eigentlich unbeschreibliche und ureigene Erfahrungen zu benennen. Sie bezeichnen die Wirklichkeiten des Inneren.
Der Begriff der Seele hat möglicherweise deshalb wieder eine vorsichtige Konjunktur, weil er das Geheimnis des Lebendigen vor der vollständigen Vermessung des Menschen in Daten zu retten verspricht. Seele wird zur Parole des Widerstands gegen ein Denken, das den Menschen auf Handlungs- und Entscheidungsdimensionen reduzieren möchte. Gab es im Zeitalter der Industrialisierung jenen Aufschrei des wahnsinnigen Ingenieurs („Die Seele, die Seele ist tot!“), so gilt es jetzt Begriffe für das zu finden, was stirbt, wenn wir mit unserem Denken und Empfinden in den Netzwelten untergehen. Wenn unsere Innenwelt in einer Art digitalem Vampirismus verwertet und verbraucht wird.