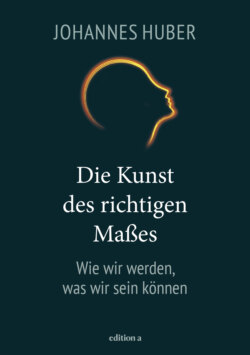Читать книгу Die Kunst des richtigen Maßes - Johannes Huber - Страница 24
Das richtige Maß beim Verzicht
ОглавлениеLeonardo da Vinci sagte:
Die Einfachheit ist die höchste Stufe der Vollendung.20
Wir hören es und finden es gut, und doch widerspricht es unseren inneren Programmierungen. Das lässt sich unter anderem mit einer kürzlich im Wissenschaftsmagazin Nature publizierten Studie des Sozialpsychologen Gabriel Adams21 belegen. Das Experiment beschäftigte sich mit der Kunst des Weglassens. Die Probanden, allesamt Architekturstudenten, bekamen die Aufgabe, ein Dach zu errichten. Sie sollten versuchen, die stabilste Konstruktion zu finden.
Die jungen Tüftler machten sich ans Werk. Fast alle fügten mehr Schindeln hinzu und verwendeten mehr Materialien. Bald zeigte sich: Wenn ein Dach zu schwer ist, hat das viele Nachteile. Nur Wenige fanden die stabilste Konstruktion. Die Voraussetzung dafür war, wegzulassen, statt hinzuzufügen.
Der Mensch fügt grundsätzlich lieber etwas hinzu, als etwas wegzulassen. Das ist ein innerer Drang. Wegzulassen ist kognitiv viel anstrengender als hinzuzufügen. Addieren ist kognitiv einfacher als Subtrahieren. Dazu kommt unsere längst auch in Studien dokumentierte Ehrfurcht vor dem Bestehenden.
Etwas wegzulassen, gilt gemeinhin auch als weniger kreativ, als etwas hinzuzufügen. Dabei liegt die Schönheit zum Beispiel in der Arbeit eines Bildhauers immer im Weglassen und Wegnehmen. Aus einem formlosen Block schlägt der Künstler die Form. Die menschliche Standardeinstellung lautet also schlicht und einfach:
Mehr ist mehr.
Aktuell sind wir allerdings alle umgeben von einem Gefühl des Zuviels. Explodierende Zeitpläne, mehr, schneller, besser. Ausartende Bürokratie, explodierende Kommunikation, immer mehr Arbeit innerhalb der gleichen Zeit. Der ganze Planet, der durch ständiges Hinzufügen von Neuem an die Grenzen seiner Möglichkeiten und Ressourcen stößt. Bis er zu platzen droht. Das fördert unsere Bereitschaft, zu verzichten, wenn wir es denn schaffen, aber ist Verzicht umso besser, je radikaler er ausfällt, wie es die drei genannten Beispiele aus dem Silicon Valley vermuten lassen könnten?
Die Antwort lautet Nein. Denn auch das wäre ein Dogma und Dogmen können uns bei unserer Suche nach dem richtigen Maß nur im Wege stehen. Es gibt wie gesagt keine allgemeingültige Regel für das richtige Maß. Es ist keine starre Größe wie zum Beispiel: Iss nur einmal am Tag und das wenn möglich nur fünf Mal in der Woche, dann bist du so weit. Das wäre zu einfach. Wir müssen uns vielmehr immer wieder fragen, wo und wann wir den Punkt erreichen, an dem etwas nicht mehr passt, an dem wir das Gefühl haben, unsere innere Mitte zu verlieren.
Der Buddhismus etwa sieht Fastenrituale eher skeptisch. Zur Erleuchtung gelangt der Mensch laut Buddha nicht durch Kasteiung, sondern eben durch das richtige Maß. Streng genommen gehört das Fasten gar nicht zur grundlegenden buddhistischen Praxis, es dient dort eher dazu, Gefühle zu erkennen und daraus zu lernen. Das drückt sich auch in einer Legende aus dem Leben des Buddha aus. Siddhartha, der junge Buddha, heißt es, fastete, bis er »sein Rückgrat durch seinen Magen spüren« konnte. Dann fiel er in Ohnmacht und erkannte, dass bloße Kasteiung nicht zur Erleuchtung führt.
Kehren wir an dieser Stelle noch einmal zurück zu Josef Pieper, dem bereits zitierten deutschen christlichen Philosophen des 20. Jahrhunderts und seiner Unterscheidung zwischen außergewöhnlichen, schon zur Vollkommenheit gereiften Persönlichkeiten und durchschnittlichen Menschen. Auch Letztere sind in der Lage, zur Elite zu werden, lautete das Zitat, aber sie bedürfen des Verzichtes, um ihre innere Ordnung herzustellen.
Wir könnten die Frage nach dem Nutzen der Askese und ihrer Wechselwirkung mit dem richtigen Maß also so beantworten: Das richtige Maß besteht nicht in Askese, aber Askese ist eine gute Möglichkeit, es zu finden und sich darin zu trainieren, es zu wahren.