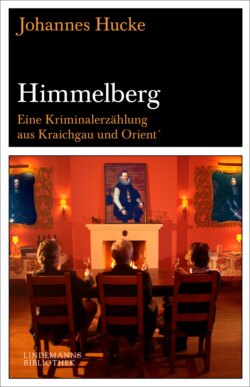Читать книгу Himmelberg - Johannes Hucke - Страница 6
Attaque Simulée
ОглавлениеEin sonderbarer Geruch steigt auf, als Rüdiger Reichsgraf und Marquis zu Hoensbroech (sprich: Hunsbruch) die Truhe öffnet, um den betagten Kavalleriedegen hervorzuholen. Nicht nur Moder und Mottenpulver sind die Urheber dieses Duftgemischs; gewiss, die Truhe stand lange auf dem Dachboden, wer mag zuletzt darin gestöbert haben? Aber es dominiert nicht der erwartete Muff abgetragener Kleidungsstücke, aus der Mode gekommener Vorhänge und Tischdecken, sondern etwas nicht mehr Greifbares, Fremdgewordenes, geradezu Abstraktes vernebelt dem Sucher für den Moment die Sinne: Es ist das Arom eines versunkenen Jahrhunderts, des neunzehnten, als alles noch anders war in Europa – gelegt zu den Akten scheinbar für immer, abgehakt, versiegelt ... und auf einmal wieder emporgeschreckt, ans Licht gezerrt, exhumiert. Unter schweren Samt- und Brokatdecken findet der Graf die Waffe; der Knauf verziert mit dem gekrönten Löwen, dem Familienwappen, die Scheide aus getriebenem Silber. Wie eben erst aus dem Verkehr gezogen, baumeln Kette und Ledergehänge an den Ösen. Es kommt dem Erben zu Bewusstsein, dass dieses handgeschmiedete Werkzeug vermutlich einst in den hölzernen, sargähnlichen Kasten platziert wurde, kurz nachdem Taten damit getan wurden – welche auch immer. Friedlich werden sie vermutlich nicht gewesen sein.
„Wenn die Klinge die Sonne sieht, soll sie Blut schmecken“, fällt Graf Hoensbroech jene bitterernste, oftmals missdeutete Spruchweisheit aus dem Japan der Samurai ein, die nicht Blutdurst predigt, sondern vor eilfertigem Missbrauch warnt.
Ohne Hast, doch zügig, senkt er den Truhendeckel, erhebt sich und trägt den Degen nach draußen. Auf dem Treppenabsatz streift er die Reitjacke über und knöpft sie zu. Vor dem Flurspiegel legt er den Gurt um; mürbe ist das Material geworden, hoffentlich hält es noch: Nicht auszudenken, wenn er die Attacke reitet, nach der Waffe greift, und es ist nichts mehr da, womit er angreifen könnte! Dass Heldenmut und Lächerlichkeit nahe beieinander liegen, gehört ebenfalls zu den altbekannten Überlieferungen.
Erstaunlich, wie gut die Handgriffe noch sitzen, nach so langer Zeit. Ob er das alles auch beim Reiten gut hinbekommt, wird sich zeigen. Nie wäre es dem Grafen in den Sinn gekommen, noch einmal auf solche der tiefsten Vergangenheit angehörenden Methoden zurückzugreifen. Doch die ungeheuerlichen Vorkommnisse auf seinem Weingut und in den Reblagen am Himmelberg verlangen nach ebenso drastischen Maßnahmen. Der Reichsgraf, als einziger seiner Familie befugt, den Titel des Marquis zu tragen, weiß sonst keinen Ausweg. Spätestens seit dem Anruf vor einer Stunde liegt klar vor ihm, was er zu tun hat. Man könnte sich ja nicht mehr ins Gesicht sehen, wenn man jetzt zögerte.
Im Geschwindschritt steigt er die Stufen ins Parterre herunter. Erwartungsgemäß wird er hier auf den ersten Widerstand treffen. Doch es sind nicht die unversehens ins Angelbachtal eingefallenen Feinde, die ihn hier aufhalten. Gräfin Maria steht in der Tür. Ihr Blick drückt Sorge und tiefe Missbilligung aus.
„Ich werde jetzt bestimmt nicht die Hände ringen und mich vors Pferd werfen.“
„Das verlangt auch keiner. Bleib lieber drin. Es ist frostig heute.“ Der Marquis eilt an seiner Frau vorbei nach draußen.
Einen letzten Versuch unternimmt die Gräfin, um die Eskalation zu vermeiden: „Ich frage mich nur, wozu die Polizei da ist!“
„Für Angelegenheiten von Staats wegen. So etwas macht man lieber selber.“
Gräfin Maria zu Hoensbroech bleibt zurück. Sie schüttelt den Kopf und fasst ihre Gedanken in einem einzigen Wort zusammen.
„Männer.“
Das Weingut des Reichsgrafen und Marquis zu Hoensbroech, vor gerade einmal einem halben Jahrhundert mit Sinn für die hellen Seiten der Tradition entgegen dem Zeitgeschmack in einer Talaue unweit des Eichtersheimer Wasserschlosses erbaut, verfügt auf der dem Hoftor abgewandten Seite über Stall und Scheune und eine kleine Pferdekoppel. Seit langem hat sich die Familie auf edle Schimmel spezialisiert, ein im Umkreis oftmals anekdotisch verarbeiteter Gegenstand. Das Lieblingspferd des Grafen, überrascht und erfreut durch den Besuch seines Herrn zu ungewohnter Stunde, streckt seinen Kopf über das Gatter.
„Ja, gleich“, ersucht er das hin und her tänzelnde Tier um Geduld und begibt sich ins Stallgebäude.
Wäre doch bloß Sohn Adrian zugegen! Doch der ist am Vortag zur Weinmesse nach München abgereist. – Nun rasch die Reitstiefel überstreifen, eine Jahr um Jahr mehr Anstrengung einfordernde Tätigkeit. Kurz kommt dem Reichsgrafen zu Sinn, dass seine Vorfahren für derlei Verrichtungen über bestens ausgebildete Reitknechte geboten ... Als die Prozedur geglückt ist, stampft Graf Rüdiger mit beiden Stiefeln kurz auf. Jetzt sitzen sie richtig.
Vom Haken nimmt er die Trense mit der Linken, den Sattel trägt er auf dem freien Arm. Trotz seiner Nervosität bleibt das Pferd versammelt stehen, lässt sich brav auftrensen und bewegt sich keinen Deut, als die Gurte festgezurrt und die Steigbügel heruntergelassen werden. Doch schon beim Aufsteigen macht sich das überlegende Feingefühl des Vierbeiners wiederum bemerkbar: Ansatzlos will der Schimmel in Galopp fallen, eine in der Tat ungewöhnliche Reaktion. Kaum ein anderes Lebewesen, so heißt es, hat ein solches Gespür für Gefahren entwickelt wie das Pferd – selbst wenn die Bedrohung nicht ihm selbst, sondern seinem Reiter gilt.
Gefrorener Dunst hängt in den Reben. Es ist noch viel kälter als die Tage zuvor. Kaum ein Blättchen hat sich im Gestänge gehalten, an den eingeschrumpelten Geiztrieben hängt Eis. Nach wenigen Metern Schritt setzt sich das Pferd in Trab. Dumpf trappeln die Hufe auf dem bereiften Gras. Indes der Graf bereits auf das Sträßchen zusteuert, das direkt zur Höhe führt, entscheidet er sich noch einmal um und entschließt sich zu einem Umweg: So spät wie möglich sollen die Angreifer mitbekommen, dass hier jemand gegen sie vorgeht. – Lange vergessene Details aus militärstrategischen Schriften schießen ihm durch den Kopf. Wie lange ist das her, seit er sie lesen musste! Nun, kein Zweifel, bestenfalls einen Scheinangriff vermag er auszuführen. Hauptziel einer Scheinattacke ist die Verwirrung des Feindes. Wer hat sich darüber noch so ausführlich verbreitet? Richtig, dieser Radetzky, Joseph Wenzel Graf Radetzky von Radetz, einer der wenigen österreichischen Taktiker von Rang, über hundert Orden, oftmals verwundet, noch häufiger ausgezeichnet – aber kein Pferdefreund, nein, durchaus nicht. In der Feld-Instruction für die Infanterie, Kavallerie und Artillerie hob dieser Vielbewunderte als Vorbedingung eines jeden Scheinangriffs die Ernsthaftigkeit der Aktion hervor: Der Opponent muss glauben, der Angreifer besitze eine reelle Chance, der Angriff könne zielführend sein.
Freilich, das dürfte kaum gelingen. Sobald die Eindringlinge sich dessen gewiss werden, dass hier ein Einzelner auf sie zustürmt, ist es vorbei mit der List. Wie viele mögen es sein? Zwei, drei ... oder doch mehr? Nasir Shansab, der Freund des Grafen, hat keine Schätzungen angegeben. Kommt die Hilfe womöglich längst zu spät? Ein entsetzlicher Gedanke! Welche Waffen werden sie tragen? Am Ende gar Maschinengewehre? Dann wäre überhaupt nichts auszurichten; sogar der Rückzug könnte schiefgehen. Wer beherzigt heute noch, dass man Leuten nicht in den Rücken schießt! – Eine weitere Randnotiz der Kavalleriegeschichte fällt Graf Hoensbroech ein, als er den Schimmel zwischen die Rebreihen lenkt, nunmehr in leichtem Galopp. War’s nicht Graf Pappenheim, der mitten im Dreißigjährigen Krieg gewisse Fährnisregeln während der Feldschlacht einforderte? Caracollieren erachtete der Mann als feige; ein Reiterangriff auf feindliche Infanterie soll in einem Zug ausgeführt werden. Aus sicherer Distanz den Karabiner abfeuern und dann einfach wieder wegreiten, dergleichen entsprach mitnichten der Kriegsethik des katholischen Generals.
Vorsichtig richtet sich der Reiter im Sattel auf. Der Saum des Wäldchens hinter den Rebreihen ist gut erkennbar. Jetzt sieht er auch die Rauchsäule: Tatsächlich, der Verdacht des Freundes, der sich auf dem Hochsitz verschanzt hat, bestätigt sich. Man scheint vor nichts zurückzuschrecken. Indem er sein Lieblingspferd zu schnellerem Galopp antreibt, zieht der Graf den Degen und streckt ihn vor, den Arm straff geradeaus. Die Kenntnis dieser Angriffshaltung verdankt er einem längst verstorbenen Schullehrer, der statt Erdkunde weit lieber Militärgeschichte unterrichtete. Jetzt ist es geschehen: Wer weiß, ob nicht auch zwischen den Weinstöcken Shansabs Verfolger lauern. Wenn hier schon Blut vergossen werden soll, dann wenigstens das richtige.
In dem Sammelsurium aus strategischen Überlegungen, das ihm fortwährend im Hirn herumwirbelt, meldet sich auch noch der alte Clausewitz zu Wort, dessen Schrift „Vom Kriege“ die ältesten Erkenntnisse zur siegreichen Kriegsführung enthält und bis in die jüngste Zeit hinein durchsetzungswillige Manager inspiriert. Leider sind die beiden Zitate, die Hoensbroech ins Gedächtnis kommen, nicht eben ermutigend. „Eine Armee ist ein Werkzeug. Ein Werkzeug verschleißt.“ Oh ja, da sprach er recht, der preußische Militärakademiker. Den Verschleiß von sieben Lebensjahrzehnten spürt auch die Ein-Mann-Armee zu Pferde, die sich in immer rascherem Tempo dem Angriffsziel nähert. Damit taucht zugleich ein weiteres der Clausewitz’schen Axiome im Gedächtnis auf: „Nicht der Angriff ist die beste Verteidigung, sondern die Verteidigung der beste Angriff. Wer attackiert, befindet sich im Risiko, weil er sich somit bewegt und seine Kräfte zerstreut.“
Immerhin Letzteres wäre im Falle des Reichsgrafen gar nicht möglich, da er doch allein gegen vermutlich schwer bewaffnete Männer reitet. – Mit einem Mal kann er sie ausmachen: Es sind derer drei. Sie blicken nach oben, gestikulieren. Jetzt scheinen auch sie etwas zu bemerken. Während das Feuer am Hochsitz emporzüngelt, wenden sich die angegriffenen Angreifer überrascht um. Ob sie tatsächlich Maschinengewehre dabei haben, kann der Marquis nicht erkennen. Dass sie nur mit faulen Äpfeln nach ihm werfen, erscheint unwahrscheinlich. Der vordere der Männer nimmt etwas Langes, Dünnes auf, legt an und zielt. Graf Hoensbroech duckt sich so tief wie möglich in die Mähne hinab und treibt seinen Schimmel an zum gestreckten Galopp. Seine größte Sorge gilt im Moment seinem Lieblingstier; nicht auszudenken, wenn es getroffen würde! Schließlich ist es nicht er, sondern der Graf Radetzky, welchselbiger einst stolz darauf gewesen, sich möglichst viele Pferde unterm Leib wegschießen zu lassen.
Begonnen hatten die unerwarteten Wirren auf dem von Hoensbroech’schen Weingut vierzehn Tage zuvor. Die Griechin Paraskevi Pampukidis, von den meisten der Einfachheit halber auf Evi zusammengekürzt, die wohl kenntnisreichste Praktikantin, welche der Kraichgau bis dato gesehen hat, kam aus dem Keller heraufgeeilt. Sie hatte etwas festgestellt, was ihr ausgesprochen merkwürdig vorkam: Ausgerechnet mit dem Weißburgunder, der wichtigsten Sorte im Anbau, nicht nur auf dem Himmelberg, sondern im weiten Kreise, schien etwas nicht in Ordnung zu sein. Eigentlich hatte die angehende Önologin den Wein gar nicht probieren wollen; dieser Morgen gehörte ganz ihren Experimenten, einzigartigen Erkundungen, die auf solche Weise in Deutschland noch nicht vorgekommen waren. Denn es genügte der jungen Hellenin durchaus nicht, die Gefilde Nordbadens allein mit dem Flair ihrer des antiken Götterhimmels würdigen Erscheinung zu beseelen, nein, ihr Ziel war ein veritabler vinologischer Kulturtransfer: Limnio und Monemvassia, zwei uralte Rebsorten aus der Heimat ihrer Vorfahren, hatte sie im Versuchsanbau gepflanzt. Zwei Gebinde, der Jungfernertrag, lagerten nunmehr im Keller der Lehrherren.
Sie lagerten? Nein, sie stellten Fragen! Evis Wissensdurst kannte keine Grenzen: Wie würden diese Reben schmecken, wenn sie im saftigen Löss des Kraichgaus wüchsen und nicht im hitzigen Karst der Archipele? Immerhin, das vergangene Jahr war klimatisch günstig gewesen, die Trauben kamen reif auf die Presse – doch wie sollte es nun weitergehen? Täglich bestürmte die Vinophile die erfahrenen Meister mit neuen Fragen, unterbreitete frische Anregungen, entwickelte unerhörte Ideen: Wie, wenn man die Weine in Amphoren reifen ließe? Oder sollte man sie nicht doch lieber mit Harz versehen, wie dies im alten wie im neuen Griechenland der Tradition entsprach? Oder müsste nicht auf symbolträchtige Weise eine Cuvée gewagt werden, eine Mariage aus Limberger und Limnio, zwischen Kraichgau und Hellas? – Unter solchen Gedanken ging Evi im Keller auf und ab, verkostete wohl zum zehnten Mal an diesem Tage ihre flüssigen, tiefdunklen Lieblinge – und entschied sich, einstweilen nichts zu unternehmen.
Stattdessen, aus Routinegründen, probierte sie erst einen Reichsgräflichen Grauburgunder, dann einen Auxerrois. Beide waren schon sehr schön entwickelt, versprachen viel für den weiteren Reifeprozess. Schließlich, ein wenig unkonzentriert, da ihr schon wieder ein neuer Gedanke durch den Kopf schoss, drehte sie den Hahn am Edelstahltank auf, worin sich der Weißburgunder befand, der einfachere, nicht der Premium-Wein, den hatte sie erst gestern gemeinsam mit Graf Adrian getestet. Schräg hielt sie das Glas unter den Strahl, drehte wieder zu, betrachtete den trüben Tropfen, schwenkte – und roch. Roch abermals ... und wieder ... und verzichtete darauf, den Wein im Munde zu bewegen. Mit einem für eine Praktikantin erstaunlich energischen „Adrian!“ durchmaß sie den Keller. Sie fand den Gesuchten am großen Schreibtisch im Verkostungsraum, wo gewaltige Ahnenproträts in Schmuckrahmen, feine Tapeten und kostbares Mobiliar aus den verschiedensten Schlössern der Familie eine Aura von Pomp und Erhabenheit, Noblesse und historischem Glamour verbreiten, die jeden Besucher unmittelbar einnimmt, nicht ohne ihm zu verdeutlichen, in welche Sphäre des Erlesenen man sich hier hineinbegibt.
„Adrian, hast du den Weißburgunder noch mal geschwefelt oder was ist da los?“
Der junge Graf Hoensbroech, seit einigen Jahren hauptverantwortlich für die Produktion, blickte amüsiert-gequält von den Rechnungen auf und stellte klar: „Nein. Sollte ich?“
„Dann kann ich mir das überhaupt nicht erklären, was ist denn da nur passiert?“, echauffierte sich die Griechin. Medusenhaft ringelten sich die schwarzen Locken um ihr Haupt; es schien angezeigt, behutsam vorzugehen.
Schmunzelnd klappte Graf Adrian zu Hoensbroech die Mappe zu und erhob sich. Keine Frage, das Anliegen der Praktikantin duldete keinen Aufschub. Mit therapeutisch abgedunkelter Stimme erkundigte er sich, welche Mängel sie denn festgestellt habe. Der Gang in den Weinkeller war begleitet von expressionistischen Beschreibungen der Widerwärtigkeit des Gestanks, welcher mit einem Male von diesem Trank, der noch vor kurzem zu den schönsten Hoffnungen berechtigte, ausgehe. Am fraglichen Tank angekommen, reichte Evi Pampukidis dem Grafen stumm ein Probierglas und wies auf den Hahn. Der Wein sprudelte ins Glas, Hoensbroech roch, schwenkte, roch abermals ... und wieder ... und rief mit dem Ausdruck höchsten Erstaunens:
„Das ist ja ekelhaft!“
Mutmaßungen folgten, was zu dieser unglaublichen Veränderung des Duftbilds geführt haben mochte. Den Senior konnte man nicht befragen; oft, sehr oft befand sich zumindest ein Mitglied der Weinbau treibenden Grafenfamilie auf Dienstreise – in diesem Fall handelte es sich um eine Burgunder-Trophy im Berliner Hotel Adlon. Immer wieder senkten der Winzer und die angehende Winzerin ihre Nasen in die Gläser. Immer wieder machten sie Anstalten, mit den Geschmacksnerven des Gaumens zu überprüfen, was die Rezeptoren im Riechorgan mitgeteilt hatten ... doch ein jedes Mal fiel einem der beiden eine neue Geruchsnuance auf, die mit Empörung annonciert wurde, so dass sie einfach nicht zum Trinken kamen.
„Leder! Da sind ja Ledernoten drin!“
„Stimmt, wie kann denn so was kommen? Und irgend so was wie ... wie Brotaufstrich, igitt, aus dem Reformhaus ...“
„Nein, jetzt hab ich’s: Wurst! Das sind Wurstaromen! Rindswurst, Teewurst, Leberwurst ...“
„Pfui Teufel.“
„Nicht zu glauben.“
Als Paraskevi Pampukidis schließlich dazu überging, jene traumatisierende Situation zu schildern, da sie als kleines Mädchen in der Scheune ihrer Großtante den Kadaver ihrer seit Wochen verschollenen Schmusekatze fand und energisch repetierte „Genau so hat das gestunken! Genau so hat das gestunken!“, wusste sich Graf Adrian keinen anderen Rat mehr.
„Den müssen wir sofort abstechen.“
Sogleich wurde mit dem zahllose Male auf jedem Weingut geübten Vorgang, welcher der Trennung des Jungweins von den Trubstoffen dient, begonnen. Nach Beendigung der aufwändigen Prozedur sollte der Tank nahezu leer sein. In diesem Falle schien dem keineswegs so: Mit dem Ausdruck der Fassungslosigkeit starrte Adrian von Hoensbroech durch die Öffnung des großen Edelstahltanks hinein.
„Was? Was ist denn da?“ Gemeinhin ein Ausbund an Neugier und Wagemut, zeigten sich auf Evi Pampukidis Antlitz mit einem Mal Spuren von Furcht, als sie die Reaktion des Grafen wahrnahm.
„Schau nicht rein. Schau. Bitte. Nicht. Rein!“, wiederholte Adrian, schob den Deckel wieder über die Öffnung, hielt sich ein Taschentuch vor den Mund und griff nach seinem Handy.
Eine halbe Stunde später summte das Weingut von Kriminalbeamten, Experten der Spurensicherung und weiteren Fachkräften aus dem Wirkungsbereich der Exekutive, dass Außenstehende den Eindruck hätten gewinnen können, es handle sich um Dreharbeiten zu einem Polizeifilm. Der bedauernswerte Winzer musste sämtliche Tankdeckel aufschrauben, indessen die engagierte Praktikantin übergenug damit beschäftigt war, die zahlreichen Beamten davon abzuhalten, den reifenden Gewächsen Schaden zuzufügen. Währenddem koordinierte Gräfin Maria die Versorgung des Einsatzteams mit allgemeinen Informationen und speziellen Häppchen, inständig, wenngleich mit wenig Selbstüberzeugungskraft darauf hoffend, man habe sich geirrt, und all die fürchterlichen Nachrichten aus dem Weinkeller seien nichts als Falschmeldungen.
Der Untersuchungsbericht erwies sich als gekennzeichnet von desillusionierender Präzision. Seit etwa achtundzwanzig Stunden habe die Leiche eines ein Meter vierundsiebig großen und zweiundachtzig Kilogramm schweren Mannes, vermutlich aus dem arabischen Kulturraum entstammend, im Edelstahltank gelegen. Todesursache sei eindeutig ein Stich in den Hals, ausgeführt mit größter Vehemenz. – Wiewohl Graf Adrian zu Hoensbroech mehrfach beteuerte, zuletzt keinerlei Orientalen auf dem Gut gesehen zu haben sowie gleich mehrfach heraushob, dass er einem Weingut vorstehe und keinem Teehaus, sollte ihm die Leichenschau in den Räumlichkeiten der Gerichtsmedizin nicht erspart bleiben. Es war dies die zweite auf den Magen schlagende Missliebigkeit an diesem Tag, weshalb er es vorzog, erst nach dem Abendbrot nach Michelfeld zurückzukehren. Zuvor besuchte er einen engen Vertrauten in Hilsbach, von dem er wusste, dass dessen Spirituosenschrank starke und hochwirksame Kräuterschnäpse enthielt.
Als Graf Adrian heimkehrte, fand er die Familie um den Tisch versammelt. Zu seiner Erleichterung war das Abendessen schon abgetragen. – Der Vater, Graf Rüdiger, war vorzeitig in Berlin aufgebrochen, veranlasst durch zwei Anrufe. Kaum dass ihn seine Gemahlin von dem schauderhaften Fund telefonisch unterrichtet hatte, entdeckte er eine weitere Nachricht auf der Mailbox, die bereits zwei Tage alt war: Nasir Shansab, ein Herzensfreund aus Jugendtagen, gebürtig aus Afghanistan, hatte ihn angefragt, ob er ein paar Tage bei ihm auf dem Weingut unterschlupfen könne. Nicht zufällig weile er in Deutschland, überdies ohne Aufenthaltsgenehmigung; diverse Verschlechterung hätten sich ergeben, etwas wirklich Schreckliches sei passiert. Die Situation sei heikel und Hilfe dringend geboten; außerdem werde er verfolgt.
Dem Oberhaupt der Familie wurde es blümerant zumute: Wie schrecklich! Ein derartiger Notruf erreicht ihn erst nach zwei Tagen! Kombinierte er diese Nachricht mit den Informationen, die ihm seine Frau zuteil werden ließ, blieben nur zwei Möglichkeiten: Entweder Nasir war von seinem Verfolger in Michelfeld gestellt, getötet und in den Wein versenkt worden – oder aber, darauf wagte man kaum zu hoffen, der Freund hatte sich seines Widersachers entledigt; weshalb aber hätte er ihn dann in den guten Weißburgunder stecken sollen, auch noch ohne ihm Bescheid zu geben? – Kaum je zuvor hatte der Graf eine solchermaßen peinigende Reise unternommen wie diese von der Hauptstadt in die Heimat. Seine Nerven waren bis zum Äußersten angespannt.
Nur darauf war zurückzuführen, dass er den Sohn, kaum dass er ihn begrüßt hatte, schonungslos befragte:
„Wie sah sie aus?“
„Was? Wer?“ Auch Adrian von Hoensbroech hatte sich noch nicht erholt. Entsprechend wenig Feingefühl prägte seine Entgegnung.
„Die Leiche natürlich“, beharrte der Senior.
Das Mienenspiel des Sohnes bestätigte sogleich die Vermutung, dass es kein erheiternder Anblick gewesen sein konnte.
„Ich erkläre gleich“, fügte Graf Rüdiger zu Hoensbroech an, „warum ich das wissen muss.“ Einem Kuvert entnahm er eine Fotografie, die einen bärtigen schlanken Herrn mit arabischen Zügen zeigte, offensichtlich zwischen sechzig und siebzig Jahre alt, gehüllt in einen auffallend eleganten Mantel. „Könnte es sein ...“ Hier unterbrach der Senior sich selbst, senkte einen Moment lang das Haupt und fuhr fort: „Könnte es sein, dass es sich bei dem Toten um diesen Mann gehandelt hat?“
„Das geht ja zu wie heute Nachmittag“, warf Gräfin Maria ein. „Da mussten wir auch dauernd Fotos anschauen.“
„Bitte“, insistierte Graf Rüdiger. „Ist es möglich?“
Mit einem Ausdruck im Gesicht, als müsse er einen weiteren in Wein marinierten Erschossenen identifizieren, schaute Graf Adrian auf das Bild.
„Eher unwahrscheinlich. Wobei, ... auch schlanke Menschen schwemmen auf, wenn sie ...“
„Adrian, bitte!“, unterbrach ihn die Mutter, woraus man ersehen konnte, dass dieser Tag auch an ihr nicht spurlos vorübergegangen war.
In den folgenden Stunden berichteten die Mitglieder der gräflichen Familie einander en détail, was man erlebt hatte, welche Umstände man vermute, welche Hoffnungen und – mehr noch – welche Befürchtungen man hege. Den breitesten Raum nahm dabei Reichsgraf Rüdigers Schilderung der Geschichte seiner Freundschaft mit dem Spross aus vermögender, gebildeter afghanischer Tuchhändlerfamilie ein. Im Internat zu Salem hatten sie einander kennengelernt, waren über Schul- und Studienzeit hinaus in Kontakt geblieben; dann entzweiten sich ihre Wege. Den Freund zog es zurück nach Afghanistan, wo er – noch zur Zeit der sowjetischen Besetzung – Reichtum und Ansehen seiner Sippe beträchtlich zu mehren verstand.
Nur ein einziges Mal – „da warst du noch ein Knabe, Adrian“ – sei Nasir anlässlich eines Handelsabkommens mit Deutschland zu Besuch in Michelfeld gewesen. „Vermutlich kannst du dich nicht an ihn erinnern.“
Verhältnismäßig spät entschloss sich die Gräfin, dem krisenstabsartigen Zusammenkommen ein wenig Form zu geben und holte eine Flasche vom besänftigenden Roten eines spanischen Weinguts aus dem Raritätenschrank.
„Damit wir besser schlafen können.“
Auch Weine kann man überfordern. So sehr sich der Spanier auch mühen mochte, mit der Auslöschung all jener frischen Ängste und Furchtsamkeiten zeigte er sich denn doch überfordert. Indessen beide, Mutter und Sohn miserabel schliefen, da ihnen unablässig Szenen des Tages durch den Sinn geisterten, lag Graf Rüdiger vollkommen wach, der Prüfung wegen, die ihm morgen bevorstehen sollte. Wie sollte er den Anblick Nasirs ertragen, entstellt und aufgedunsen und – vor allem – tot? – Da erlöste ihn gegen halb vier Uhr morgens ein Anruf. In Erwartung der fürchterlichen Nachricht griff er nach dem Hörer. Als er die Stimme seines Freundes hörte, übermannte es ihn, und dreimal rief er laut seinen Namen.
Auf diese Weise von den schlimmsten Befürchtungen befreit sowie der Notwendigkeit einer Leichenschau entledigt, fuhr er am nächsten Morgen nach Ochsenfurth, wo er im Schloss der Baronin den alten Spießgesellen anzutreffen hoffte. Schon im Eingang kam Nasir Shansab auf ihn zu: Kaum älter geworden, wie immer tadellos gekleidet, ein Inbild von Geschmeidigkeit und Stil. Die Baronin, auf Diskretion bedacht, ließ die Männer im blauen Salon allein. – Der afghanische Tuchhändler, den sein früher ausgedehnter Europaaufenthalt stark geprägt hatte, Abkömmling einer langen Reihe von Stammesführern, fasste die Geschehnisse zusammen. Mehrmals seit seiner Flucht hatte er geglaubt, den Häschern entkommen zu sein, da musste er spät, viel zu spät feststellen, dass sie ihm die ganze Zeit auf den Fersen gewesen waren: Mitten in der Nacht, in nächster Nähe zum Weingut derer von Hoensbroech. Verzweifelt war er über die Koppel in den Hof eingedrungen, jedoch, in der plötzlichen Sorge, seine Feinde würden auch die Hiesigen nicht verschonen, auf der anderen Seite wieder aus dem Tor hinausgelaufen.
„Wie denn?“, unterbrach ihn der Marquis. „Aber du warst doch im Keller!“
„Im Weinkeller? Nein. Warum?“
„Aber weißt du denn nicht ...“ Und Hoensbroech setzte Shansab auseinander, was die Familie am gestrigen Tag so ungemein mitgenommen hatte. Er endete mit der sonderbaren Bemerkung: „Und du bist dir sicher, dass du hier niemanden erschossen und in meinen Weißburgunder gestopft hast?“
„Das kannst du nicht ernst meinen.“
„Hätte doch sein können – damit er aus dem Weg ist, der Tote.“
Im Blick des Afghanen konnte der Graf unschwer erkennen, dass er mit dieser Mutmaßung weit gefehlt hatte. „Aber um Gottes Willen“, hob er noch einmal an, „wer ist dieser Mensch denn gewesen? Da weiß ich mir gar keinen Reim mehr drauf.“
Dem Gast erging es ebenso. Man kam überein, Shansab solle noch ein paar Tage auf dem Schloss der Baronin Ochsenfurth zubringen, bis man eine Gelegenheit gefunden habe, ihn außer Landes zu bringen. Wohin, das versprach der Marquis zu klären. Am besten wäre es natürlich, man könne Nasir alsbald mit seiner eigenen Familie wieder zusammenführen, die inzwischen auf Umwegen von Afghanistan über Zimbabwe nach Kanada gelangt war. – Die kommenden Tage waren einerseits erfüllt von Planungen, wie man dem Freund der Familie eine gefahrlose Passage zum nordamerikanischen Kontinent verschaffen könne; andererseits machten diverse Ermittler ihre Aufwartung, die sich mit der schnöden Tatsache, dass sich ein ermordeter Wildfremder ganz ohne Anlass und Genehmigung in einem Stahltank zu Michelfeld Aufenthalt verschafft hatte, nicht abfinden mochten.
Den Plan umzusetzen, erwies sich als außerordentlich kompliziert. Wohl waren die Hoensbroech’schen Kontakte international verzweigt, doch die Vielzahl an Vorsichtsmaßregeln erforderte absolute Perfektion in Konzept und Durchführung. Kaum war es dem Grafen geglückt, einen sicheren Transport nach Rotterdam und von dort aus nach New York zu organisieren, kam der nächste Anruf. Gehetzt erzählte Nasir Shansab, die Baronin habe verdächtige Gestalten im Schlosshof ausgemacht und er sei schon auf dem Weg nach Michelfeld.
„Tu das nicht!“, wollte ihm Graf Hoensbroech noch durchs Telefon zurufen, da knackte es bereits in der Leitung. In höchster Erregung, unschlüssig, was zu tun sei, verbrachte er eine üble Stunde, als ihn das nächste Klingeln schreckte.
„Rüdiger, ich bin jetzt ganz in deiner Nähe.“
„Na, ein Glück, du hast es ...“
„Nichts hab ich, leider. Ich befinde mich auf einem Hochstand, weißt du ... dieses Ding oberhalb vom ... Augenblick mal ... Verschwindet! Da! Ich knall euch ab! – Entschuldigung ... vom Himmelberg. Kannst du mir irgendwie helfen?“
„Nasir! Ich hole sofort die ...“
„Nein! Nein, nein, nein! Keine Polizei! Ich hab doch keine Aufenthaltsgenehmigung, ich will zu meiner Familie ... und jetzt sind sie da und ... und machen Feuer!“
Weitere Rückfragen blieben ohne Antwort. Stattdessen hörte der Graf Schüsse. Dann knackte es wieder. Aus.
Daoud, einer der Begleiter des Beauftragten, hat schon immer an Geister geglaubt. In der Gebirgsregion, wo er aufwuchs, unterteilte man diese verschiedenartigen akustischen und optischen Erscheinungen, die zum Leben gehörten wie Vögel oder Schlangen, in Sippen. Analog zu den menschlichen Gemeinschaften lebten auch die Geister in Treue zueinander; manche waren ehemalige Menschen, andere existierten als Luftwesen seit unvordenklichen Zeiten. Schon als sehr kleiner Junge lernte Daoud mit diesen gefährlichen Wesenheiten umzugehen. Bekannte kleinere Geister konnten ihm nichts anhaben, die größeren musste man bannen. Dafür war eine Tante zuständig, manchmal die Großmutter. Tauchten aber unbekannte, mächtige Geister auf, hinter Felsnasen, aus Erdspalten oder mitten im Zelt, unangekündigt, unter Gezisch, so half nur die Flucht. Doch selbst wenn diese gelang, war noch lange nicht sicher, ob man wirklich entkommen war. Ein Vetter vierten Grades im Süden des Landes galt als verhext; man merkte ihm nichts an, in keiner Weise. Doch einige im Dorf wussten, dass er nicht weit genug weggelaufen war, als ihm ein mächtiger, fremder Dschin erschien. Deshalb würde er, wenn die Zeit gekommen war, selber zum Geist werden.
Als der weißhaarige Reiter auf Daoud zudonnert, in immer schnellerem Tempo, die Nüstern des Pferds atmen Dampf, Nebel umweht die Gestalt, Dunstschleier schließen die Szene nach allen Seiten ab, da verkrampft sich sein Herz.
„Schieß!“, ruft sein Herr Dschamal, „schieß ihn ab!“
Auch Massud, der Onkel, zetert im Hintergrund. Doch im Gegensatz zu Dschamal zeigt Massud große Furcht.
„Tu was, Daoud, du hast die Waffe!“, kreischt er.
Da entdeckt der zögernde Schütze, dass auch der Geisterreiter bewaffnet ist. Einen Moment lang überlegt er, ob er sich dem Unbekannten zu Füßen werfen soll; aber nein, mit solchem Ingrimm kommt dieses Wesen da herangestürmt, wer wollte da auf Gnade hoffen? Gesträubten Haars lässt Daoud die Waffe fallen und stürmt davon. Nach wenigen Metern bemerkt er, dass jemand neben ihm ist. Seit an Seit mit seinem Onkel sucht Daoud in Panik den Weg in das Wäldchen hinein. – Dschamal schreit, sie sollen stehen bleiben; doch eher würden die Fliehenden versuchen, einen Ölfrachter in voller Fahrt aufzuhalten als dieses rauchende Höllenpferd. Was weiß, Daoud schon von den Geistern des Westens? Nichts weiß er. Nie hat er sich Gedanken darum gemacht, was so weit drüben, hinter dem Kaukasus, vor sich geht. Seitdem der Auftrag des Ältesten an ihn ergangen ist, Dschamal Parhez in dieser grässlichen Stadt mit den Turmhäusern aufzuspüren, ergeht es Daoud sowieso fürchterlich. Wie gerne hätte er in diesem Monat Verlobung gefeiert; stattdessen reist er auf unbequemste Weise, schläft seit Wochen ohne Obdach in der Kälte, jederzeit darauf gefasst, morden zu müssen oder selbst gemordet zu werden, ausgesetzt den Grobheiten dieses gestörten Chaleb, eines Emporkömmlings und Schikanierers, dessen Sadismus selbst vor seinen eigenen Leuten nicht Halt macht. Selbstverständlich bleibt Daoud keine Wahl als mitzumachen, als treuer Vasall; andernfalls verlöre er sein Gesicht. Aber dass es so schrecklich lange dauern würde, das hat ihm keiner gesagt. Und dass es hier so mächtige Geister gibt!
Dschamal Parhez aber hat den Glauben an übernatürliche Erscheinungen längst verloren. Da überwindet er den Schrecken augenblicklich – doch es ist schon zu spät, um die kleine Pistole aus der Jacke zu ziehen. Rasch greift er nach einem der verdorrten Rebstöcke, die auf einem Haufen übereinander liegen: Damit wird er diesen Angreifer aus dem Nichts vom Pferd hauen. Während hinter Dschamal das Feuer unter dem Hochsitz weiter vorankriecht, bereitet er sich auf den Moment des Aufeinanderpralls vor. Aber der junge Mann unterschätzt das Tempo von Ross und Reiter, die mit tobendem Getrappel auf ihn zujagen. Bevor Dschamal zuschlagen kann, sinkt ihm der Knüppel aus der Hand: Ein beißender Schmerz in der Schulter ergreift von seinem Körper Besitz. Sofort spürt er, dass ihm das Blut den Arm hinunterläuft. Mit der anderen Hand fasst er nach der verwundeten Stelle. Dschamal stellt fest, dass der Arm noch dran ist; aber die Schnittwunde blutet heftig.
Indessen Dschamal Parhez mit den Folgen der Attacke beschäftigt ist, springt Rüdiger Reichsgraf zu Hoensbroech vom Pferd und eilt auf den Verletzten zu. Den Degen hält er auf dessen Kehle gerichtet. Selber überrascht vom Erfolg seines Angriffs, steht er auf einmal vor dem Feind seines Freundes. Unversehens hat er einen Gefangenen gemacht. Den ursprünglichen Plan, die Übermacht nur abzulenken, vom Hochsitz wegzulocken, musste er mitten im Ritt aufgeben; weder hätte er zur Seite ausweichen können, da die Rebzeilen dies verhinderten, noch wäre es möglich gewesen, bei dieser Geschwindigkeit umzuwenden. Kaum kam ihm dies zu Bewusstsein, gewahrte er, dass zwei der Fremden, warum auch immer, die Flucht ergriffen. Mit dem einen, der übrig blieb, so hoffte er, würde er fertig werden. Als er sah, wie der Mann sich mit einem Holzstück wappnete, ließ Hoensbroech den rechten Arm vorschnellen, und die Degenspitze traf mit der Wucht des vollen Galopps. Am festen Leder rutschte das Metall ab, sonst wäre der Arm wohl amputiert worden.
„Machen Sie das Feuer aus, sofort!“ Graf Hoensbroech treibt den Fremden vor sich her, zum Hochsitz hin, dessen hölzerne Leiter bereits lodert und glimmt. „Jacke ausziehen. Ersticken sie damit die Flammen!“
Während der Graf mit den Füßen das mehr rauchende als brennende Reisig beiseiteschiebt, gehorcht der Gefangene, streift seine Jacke ab und drückt sie gegen den Schwelbrand. Erst jetzt erkennt der Graf, dass es mit dem Feuer gar nicht so weit her ist; das Material war wohl viel zu feucht, um richtig in Flammen aufgehen zu können.
„Nasir, du kannst runterkommen! Aber pass auf, die Sprossen sind angekokelt.“
Vorsichtig steigt Nasir Shansab hinunter. „Wo sind die andern?“
„Keine Ahnung. Weggerannt.“
„Respekt. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Einer gegen drei!“
„Glücksache. – Halt, keinen Schritt!“ Entschlossen nähert sich der Graf dem Gefangenen, den Degen unverwandt vorgestreckt. „Bleiben Sie stehen! Halt, sage ich! Ach so, sprechen Sie überhaupt deutsch?“
„Natürlich“, flüstert Dschamal Parhez und hält ruckhaft inne.
„Lauter! Ich verstehe Sie nicht.“
„Natürlich spreche ich deutsch!“
„Gut. Sind Sie schwer verletzt?“
„Nein.“
„Zeigen Sie mal her.“
Dschamal rührt sich nicht.
„Sie sollen mir das zeigen!“
Widerwillig nimmt der Verletzte die Hand von der Wunde. Nachdem Graf Hoensbroech die Verletzung in Augenschein genommen hat, den Kavalleriedegen nach wie vor gegen den Besiegten gerichtet, überrascht er diesen mit einem Vorschlag. „Kann ich mich auch darauf verlassen, dass Sie das Gastrecht achten?“
„Bitte?“
„Werden Sie als mein Gefangener auf Gewalttätigkeiten verzichten, wenn ich Sie mit in mein Haus nehme und dort verarzte?“
„Ich brauche keinen Arzt.“ Der junge Parhez blickt seinen Überwinder wütend an.
„Ich bin auch kein Arzt. Bei mir geht das ohne Betäubung. Aber immerhin habe ich einen Verbandskasten im Haus. Geben Sie mir Ihr Wort?“
Dschamal überlegt. Blickt starr vor sich hin. Dann nickt er langsam. So sehr es ihn schmerzt, aus heiterem Himmel überwunden worden zu sein, ehrt es ihn doch, dass ein Wildfremder seinem Wort Glauben schenkt. Was jetzt kommt, weiß Gott allein! So eine Schmach ... Während Dschamal den Weinberg hinabsteigt, die blankgezogene Klinge immerfort in seinem Rücken wähnend, murmelt er ein Gebet. Aber es kommt ihm nicht so richtig über die Lippen. Die Wunde brennt außerordentlich stark, fest presst er die gesunde Hand dagegen.
„Haben Sie eine Waffe?“, will der Mann hinter ihm wissen.
Dschamal schüttelt den Kopf.
Leise bittet Hoensbroech seinen alten Freund Nasir, das Pferd mit nach unten in den Stall zu führen. Bald blickt er nach hinten, ob nicht die beiden Geflohenen wieder auftauchen, bald nach vorn, auf diesen merkwürdigen Menschen, der so unerwartet schnell aufgegeben hat. Wie alt mag er sein? Siebenundzwanzig vielleicht? Wie ein Auftragsmörder sieht er jedenfalls nicht aus. Filigran ist er gebaut, gelenkig, die Figur eines Balletttänzers. Wären sie bloß schon unten am Haus ...
Als Nasir Shansab, den Schimmel an der Hand, Graf Hoensbroech einholt, ist er außer Atem. „Ich kann gar nicht sagen, wie ich dir danke. Hast du wirklich keine Polizei verständigt?“
„Unsinn, selbstverständlich nicht.“
„Und deine Frau?“
„Du kennst sie doch.“
„Gut. Auch dafür danke ich euch. Und jetzt?“
„Gehen wir erst mal ins Warme.“
Aus der Dachluke spähend, das Fernglas in Händen, hat Gräfin Maria den Hergang verfolgt. In der Jackentasche hielt sie ein Handy bereit, eingeschaltet, die Notrufnummer bereits vorgewählt. So irrsinnig sie die Idee fand, auf solch altertümliche Weise dem Freund zu Hilfe zu kommen, so sehr fühlt sie nun Erleichterung. Nein, mehr noch, es ist nicht zu verhehlen: Das hat ihr ganz prachtvoll gefallen, wie ihr Gatte diese haarsträubende Situation gemeistert hat. Ganz bestimmt wird sie ihn nicht sofort dafür loben, sonst reißt das noch ein. Aber zu gegebener Stunde wird sie die richtigen Worte finden. Mit einem Mal hat die Gräfin Zutrauen gefasst; die Hauptgefahr scheint einstweilen überstanden. Zwar weiß sie noch nicht, wie dies alles nun vor sich gehen soll, aber inzwischen traut sie dem Gatten zu, auch hierfür eine Lösung zu finden. Als sie den Männern entgegengeht und ihrem Gemahl zunickt, meint sie ein ungläubiges Lächeln um seine Augen wahrzunehmen. Sie begrüßt Nasir, indem sie ihm mit beiden Händen um die Rechte greift, flüstert ihm ein paar Worte zu. Und dann kümmert sie sich um den Schimmel.
„Das hat er brav gemacht“, kommertiert Graf Hoensbroech nach hinten gewandt. „Eine Belohnung hätte er sich verdient.“
„Genau das hatte ich gerade vor“, lautet die Antwort, und die Gräfin führt das ruhig vor sich hin trottende Pferd in den Stall. „So, mein Guter“, tätschelt sie ihm den Hals, „was magst du lieber: Rüben oder Äpfel?“
Ohne die Antwort abzuwarten, greift sie in einen Jutesack voll dicker Gelberüben. – Durch die Stalltür kann sie erkennen, wie Nasir Shansab die Tür zum Degustationsraum zuerst durchschreitet, gefolgt von diesem jungen Kerl mit dem schmalen Wuchs. Hinterdrein kommt ihr Mann. Ein bisschen erschöpft sieht er aus, wie er sich niederbeugt, um den Degen draußen gegen die Hauswand zu lehnen. Nun, ist ja kein Wunder. Eine Kavallerieattacke reitet man heutzutage wirklich nicht mehr so oft.