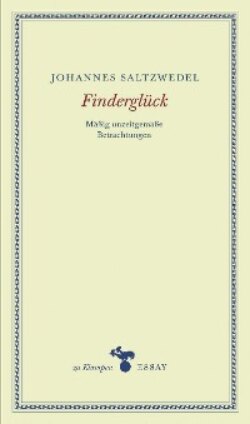Читать книгу Finderglück - Johannes Saltzwedel - Страница 6
Abschied vom Sequentiellen
ОглавлениеNotizen zur digitalen Vielfalt (1999)
Die Probleme lösen sich
nicht im Begriff,
nur in der Gestalt.
Hugo von Hofmannsthal
In den siebziger Jahren schätzten Fachleute, etwa ein Mensch unter einer Million leide an echter Persönlichkeitsspaltung. Es gab so gut wie keine Literatur, keine Therapie, kaum Fachvokabular. Um 1995 hatte sich die Lage dermaßen verändert, daß Kulturkritiker aufmerksam wurden. Mit kuriosen Fällen von »Multiple Personality Disorder« (MPD) konnte der Psychiater Oliver Sacks ein großes Lesepublikum unterhalten. Der psychische Zerfall in autonome Selbste zur Abschottung meist traumatischer Erinnerung wurde in Boulevardblättern und Talkshows vor allem der USA zum gängigen Thema, für Sozialarbeiter und Psychologen gehörte das Erkennen der Seelenstörung zur Routine, im Internet entstanden Selbsthilfegruppen namens »Divided Hearts« oder »Shattered Selves«, und man schätzte, nicht jeder millionste, sondern jeder zwanzigste US-Bürger zeige entsprechende Symptome. Sozialwissenschaftler suchten den naheliegenden Verdacht zu belegen, daß die angebliche Epidemie, ähnlich wie die Hypochondrie im ausgehenden 18. oder die Hysterie im ausgehenden 19. Jahrhundert, mindestens zum guten Teil ein Produkt veränderter Diagnosemethoden sei. Der Streit um die »Wirklichkeit« von MPD spiegelt, wie der Wissenschaftsphilosoph Ian Hacking dargestellt hat, auch den Kampf zwischen Berufsgruppen von Therapeuten und ihrem jeweiligen Traditionsanspruch.
Inzwischen ist das Interesse am Krankheitsbild der multiplen Persönlichkeit stark abgeklungen. Aber verwandte Symptome zeigen sich immer wieder. Mindestens so lange wie die Moderne gibt es den Argwohn, »daß der Gedanke von der Simplizität unserer Seele ein geborgter Begriff ist« (Lichtenberg). Doch nun scheint die Furcht nicht nur bestätigt: Der Umgang mit einer Vielzahl paralleler Wahrnehmungswelten ist geradezu die Normalform aktiven Daseins geworden. Von der Installation elektronischer Schrifttafeln oder Bildschirmanzeigen im öffentlichen Verkehr bis zur Steigerung der Beatfrequenz in der Technomusik, vom wirtschaftlichen Gebot für Radiosender, alle paar Minuten die »Klangfarbe« zu ändern, auf daß die Hörer dem Abschaltknopf fernbleiben, über die hakenschlagende Prosa der Vernetzungspropheten bis zur Ästhetik unausgesetzter Bewegung und raschester Schnitte in Actionfilmen und Videoclips: Wo Verzeitlichung nicht unmittelbar in das Nebeneinander mehrerer separater Reize übergehen kann, muß wenigstens ein pausenloser Wechsel der Bilder, Sujets und Intensitätsebenen den Schein aufrechterhalten, daß die aktuelle Erlebnisspanne mitreißend gefüllt sei.
Reizüberflutung zu beklagen ist spätestens seit den zwanziger Jahren ein Topos der Eigentlichkeit geworden. Jenseits solcher Floskeln aber scheint sich unser Verhalten in der und zur Welt tatsächlich zu wandeln: Wir gewöhnen uns an dauerndes Umschalten, an einen Alltag paralleler oder zumindest simultan vorstellbarer Sinneserregungen diversester Art, wie ihn schon die Kaufhausmusik oder ein Telephonat mit dem Handy aus dem fahrenden Zug darstellen. Vorgreifend könnte man behaupten: Die innere Haltung, die solchen für Bürger Westeuropas fast unausweichlichen Situationen entspricht, ist eine im höchsten Grade antimeditative und somit ein Inbegriff, wenn nicht gar die Übersteigerung dessen, was als westliche Lebensform seit etlichen Jahren in die Kritik geraten ist. Eine weitere Entfernung vom asketischen Ideal der Selbstfindung als die momentan im Ästhetischen grassierende Neuigkeitsversessenheit scheint kaum denkbar.
Leicht könnte nun der Multimedia-Mensch als künftiger MPD-Patient porträtiert werden, der zu gesammeltem Aufmerken und entsprechender Hypotaxe in Gedanken und Wortwahl schon heute unfähig ist, weil er seine Umgebung gewohnheitsmäßig als Feld universellen Zappings begreift. Ein Gegenwartskundler könnte die Nervosität schon unter Kleinkindern, das allseits beklagte Abnehmen der Konzentrationsfähigkeit im Schulalter wie des verständnisvollen Lesens unter Studenten mühelos im Typus eines Weltverhaltens summieren, das die kurze rezeptive Aufmerksamkeit, den raschen Konsum fertiger, meist bildförmiger Eindrücke zur Norm erhoben hat. Er könnte hervorheben, daß das pure Aushalten eines möglichst großen Quantums solcher Eindrücke entscheidend geworden ist, daß mithin Bewältigung, und zwar quantitative, das qualifizierende Verstehen übertrumpft oder es wenigstens versucht. Es brauchte nur jemanden diese Flüchtigkeit, dies Schwinden intellektueller Ausdauer postmoderne Zerfahrenheit zu nennen, schon wäre die Bahn frei für reaktionäre Lamenti. Das aber hieße eine Chance vergeben für die Wahrnehmung, wie umfassend die Abkehr von sequentieller Vermittlung, der Hang zur gestückelten Wahrnehmungsvielfalt in unausgesetzten plötzlichen Schnitten unsere ästhetische Situation prägt.
Als Georg Simmel im Winter 1902/03 einen Vortrag über »Die Großstädte und das Geistesleben« ausarbeitete, begann er wie selbstverständlich mit der »Steigerung des Nervenlebens«, die das »Unterschiedswesen« Mensch im Getümmel der Metropolen erfährt. Umdrängt vom »raschen und ununterbrochenen Wechsel äußerer und innerer Eindrücke«, kämpft das Individuum auf neue, härtere Art um »die Selbständigkeit und Eigenart seines Daseins«, es setzt dem großstädtischen Panoptikum einen Verstandespanzer der »Reserve« entgegen, hinter dem das seelenhafte Ich als unverwechselbares fortexistieren kann. So sehr es von äußeren Reizen »brutal hin und her« gerissen wird, wahrt es noch im dichtesten Trubel distanzierte Erkenntniseinheit. Simmel, dessen eigener Prosastil bei all solcher Distanz ein Höchstmaß ästhetischer Sensibilität zu bewahren sucht, hat das »sich umgrenzende Ich« (Benn) fraglos zur einzig sinnvollen Antwort auf die unausgesetzte Affektion erklärt: »Wenn der fortwährenden äußeren Berührung … so viele innere Reaktionen antworten sollten … so würde man sich innerlich völlig atomisieren und in eine ganz unausdenkbare seelische Verfassung geraten.« Genau diese unausdenkbare Lage aber ist seit langem auch abseits der Metropolen eingetreten, ja sie gilt heute als unvermeidlich, wenn nicht gar erstrebenswert – wesentlich infolge elektronischer Medien, deren Siegeszug und Definitionsmacht Simmel nicht ahnen konnte.
Unter den Geisteswissenschaftlern sind es zuerst die Linguisten gewesen, die den dynamischen, auf ein jeweiliges Kontinuum zurückgehenden Theoriemodellen der Jahrhundertwende Bestimmungsraster entgegenstellten, die auf diskrete Werte, möglichst gar binäre Oppositionen setzten. Der Strukturalismus, mochte er sich in Randzonen auch gern spielerisch geben, versprach sich von dieser Quantelung geistiger Inhalte viel. Ließe sich die Physik menschlichen Ausdrucks, der Zentralkalkül ideeller Arbeit, mit dem ja schon ein Musil ironisch geliebäugelt hatte, tatsächlich ins Werk setzen, dann verwandelten sich plötzlich viele alte Geistesfragen zu Problemen, denen allein noch die technische Lösung mangelte. Die Folgen dieser Haltung zeigen sich schon in den mannigfachen Spielarten des europäischen Nouveau Roman: Erzählung muß in den Untergrund flüchten, weil eine Versuchsanordnung, vom fingierten Stilleben über die Tonband-Imitation bis zur Inventarliste, die Textoberfläche bildet; diskrete Einzelheiten, statische Szenen und musivisches Dasein sollen authentisches Datenmaterial liefern. Kaum einem der Autoren, die mit avantgardistischem Selbstbewußtsein auftraten, war bewußt, wie präzis ihr gewitztes Kunstwollen wirklich die technische Entwicklung der Erkenntnismittel nachvollzog. Erst heute zeigt sich, daß die Sprachingenieure bloß Teil einer weit umfassenderen ästhetischen Umwälzung waren. Denn heute hat sich die Bevorzugung diskreter statt kontinuierlicher Eindrücke zum Vorwalten digitaler über analoge Darstellung und Wahrnehmung verschärft. Oswald Wiener, der 1970 das durchtrieben komische Experimentalwerk »die verbesserung von mitteleuropa, roman« veröffentlichte, weiß davon. In seinen 1998 erschienenen Vorlesungen zur Theorie der Turing-Maschinen fällt gleich am Anfang so lapidar wie unauffällig der Satz: »Die Zeit teilen wir im Hinblick auf die Maschine zweckmäßigerweise in diskrete Abschnitte, Zeiteinheiten.«–»Im Hinblick auf die Maschine«: Da braucht man noch nicht einmal an die menschlichen Roboter aus den Industriekavernen von Fritz Langs »Metropolis« zu denken, die zur Bewegung im mörderisch rasanten Einheitstakt verdammt sind. Es genügt schon, sich an die Rede vom Ruck erinnert zu fühlen, der durch Deutschland gehen müsse.
Die sinnlichen Aspekte der digital zerlegten Weltauffassung sind oft genug beschrieben worden. Sei es das sprunghafte Auftauchen, Verschwinden und Wechseln von Information, die ihrer Tendenz nach statt sequentieller Erschließung ein graphisch-piktographisches Erfassen im Moment verlangten; seien es Menge, Präzision und im gleichen Maße primäre Beliebigkeit von Zahlgrößen, denen auch dem Gefühl nach der Lebenswert von Berechenbarkeit und Wissen zuerkannt wird: Komplett wie nie zuvor und austauschbar wie nie zuvor, stellen digitale Daten ein Äußerstes an Exaktheit wie an Flüchtigkeit dar, ein präsentisches Perfektum, das allein noch zu vergehen taugt. Der Druckpunkt auf Tastaturen gab einen Vorgeschmack. Inzwischen läßt die Standbildtaste, am Videorecorder selbstverständlich, auch auf normalen Heimfernsehern die Bildpunkte gefrieren und löst so aus der scheinbaren Folge das diskrete Rasterbild eines Moments – verräterischerweise meist des falschen. Mechanisch wechselnde optische Elemente hingegen, Werbebanden im Fußballstadion zum Beispiel, streifenförmig aufgeteilte Plakatanzeigen an Flughäfen oder das Senkrecht-Windrad an der Tankstelle, wirken dank ihrer nachvollziehbaren Kontinuierlichkeit schon zart nostalgisch, so selbstverständlich rechnen die Sinne mit verzögerungsfreiem, digitalem Bildwechsel. Daß sich zwei völlig verschiedene elektronische Porträts durch sogenanntes Morphing computergesteuert ineinander verwandeln lassen, bestätigt durch seine satirische Vortäuschung eines schöpferisch-dramatischen Werdegangs nur, wie weitgehend unsere Eindruckswelt sich jenseits von kausalen und historischen Bezügen in primär zeitlos empfundene Zustandsdaten aufgelöst hat, in ein – anstatt auf Begeisterung – auf rasche, grundlose Faszination angewiesenes Kaleidoskop vieler, vieler bunter ›stills‹.
Aus dieser Richtung gesehen wirken etliche Accessoires der jüngsten Vergangenheit wie Vorboten der kommenden Totalzerlegung. Stroboskoplichter beispielsweise, die Grundausstattung von Discos der siebziger Jahre, gewöhnten mehr als eine Generation an die Entzeitlichung des Moments. Selbst daß Verzeichnisse der Namen, Dinge oder Verhaltensweisen, die gerade als modisch oder überholt gelten sollten, In-und-out-Listen heißen, gemahnt seltsam daran, auf welch dualen, ja nahezu manichäischen Grundlagen das Starsystem beruht, das weithin an die Stelle einer kritischen Öffentlichkeit getreten ist.
Auf den ersten Blick scheint nun die in potentiell unendlich viele Einzelbilder zerteilte Wahrnehmung und Wertung folgerecht zu vollenden, was um die Jahrhundertwende verblüffend einhellig zum Signum moderner Kunst erklärt wurde. Der diskursiv uneinholbare, vom schockhaften Hereinbrechen neuen Sinns schier berstende Augenblick, hier scheint er verwirklicht. Plötzlichkeit der Epiphanie in jedem neuen elektronischen Zeittakt, welch höhere Intensität ästhetischer Erfahrung hätten die Künder momenthafter Kunst noch anstreben können? Erst im Nahblick wird deutlich, daß ihnen nahezu das Gegenteil vorgeschwebt haben dürfte. Ein nur eben noch erfaßbarer diskreter Bildquant, sofort von einem vollständig anderen ersetzt, bringt vielleicht Adrenalin, Rückenmarksnerven und Körpermotorik in Gang. Aber er trägt keine Prägnanz und somit keine Erhellung oder gar Offenbarung, schon, da kein Erfahrungsweg auf ihn zu oder von ihm fort führt. Der unausgesetzte abrupte Wechsel solcher in Daten erfaßter Zustände drängt, indem er die Aufmerksamkeit durch reine Unterschiedsfülle auslastet, ihren Gehalt zurück, bis nur noch ein flackerndes Hintergrundrauschen in der Wahrnehmung übrigbleibt.
Die Apostel ästhetischer Epiphanie, von Cézanne bis Doderer, konnten den Moment des Umschlagens der Einzelheiten in lichtvolle Sinngestalt allein vor dem Horizont sequentiell-narrativen Fortschreitens zum Ziel ihres Werks erheben, einem selten und mit Anstrengung errungenen Ziel. Müheloses, pausenloses Umschalten von Datenquantum zu Datenquantum hingegen wirkt nivellierend; es ist aurafeindlich – und ironiefrei ohnehin. Besonders leicht ließe sich dies übrigens an der sogenannten Archäologie Michel Foucaults zeigen, einer Doktrin, die hierzulande ihren akademischen Einfluß noch keineswegs verloren hat: Scheinbar den Quellen verpflichtet, expliziert man einen ›Diskurs‹, den man dann anderen ›Diskursen‹ wie in einem Maschinenpark entgegenstellen kann; sprachliche Verfaßtheit als solche aber und erst recht der Übergang von einem zum anderen Diskurs bleiben Mysterien, die nur noch mit dem dunklen Faktor der Macht benannt werden können. Wenn aber unfaßbare dämonische Mächte das historische Werden im Vergehen regieren, dann stehen für die Erkenntnis bestenfalls Eindeutigkeiten gegen Eindeutigkeiten: Das in seiner Wandelbarkeit zu Erkennende, Geschichte wie Gesellschaft, zerfällt zu Momentaufnahmen der Fatalität. Als hätte diese schicke Methodik, die unter der Hand das historische Denken abschafft, erzeugt, was sie zu beschreiben angetreten war, so trist mutet zuweilen die Entropie der unzähligen Diskurse an, die mittlerweile nicht nur akademisch ergründet, sondern auch lebensweltlich praktiziert werden.
Beispiele für das alltägliche Nebeneinander der Diskurse gibt es genügend, zumal auf dem Sektor elektronischer Medien. Zwar wird es gern an hochreflektierten Formen erörtert wie den vor Bedeutungskanälen schier berstenden und doch dramatisch-emotional stillgestellten Filmschaukästen Peter Greenaways. Schon ganz alltägliche Umstände jedoch sind lehrreich genug. Mit dem Aufkommen von Bildschirmarbeitsplätzen beispielsweise war ein wichtiger Schritt weg von der sequentiellen, nach der Einfalt der Schreibhierarchie geordneten Verwaltung getan. Sofortige Verfügbarkeit schien dem Sachbearbeiter in manchen Momenten Zauberkräfte zu verleihen. Doch mit der Machbarkeit kam die technische Entfremdung vom Gegenstand. Fiel das Computersystem aus, blieb nur der Ruf nach dem Fachmann, während die Arbeitsleistung der Terminalnutzer zwischenzeitlich auf den Binärwert Null fiel. Seit von 1981 an der PC geläufig wurde, sind wir über diese frustrierend diskreten Zustandsgrößen hinaus mit einer Fülle weiterer Grundeigenschaften digital zerlegter Wahrnehmung vertraut geworden: Zeichen auf dem Bildschirm brauchen keineswegs einer inneren Realität zu entsprechen, ebensowenig dem, was hernach ein Drucker zu Papier bringt; es empfiehlt sich, vom Tätigkeits- und Gedankenfluß des öfteren ein Zwischenbild in Form der Sicherheitskopie zu hinterlegen, denn bei einem »Absturz« könnten ungesicherte Daten, gar Gedankenblitze, spurlos verschwinden. An die plötzliche Verfügbarkeit von Informationen über eine Datenbank wie an das plötzliche Ende solcher Verfügbarkeit – etwa weil die Zugangssoftware nicht mehr mit dem neuen Betriebssystem des Computers harmoniert – hat man sich binnen weniger Jahre bis zur Gleichgültigkeit gewöhnt; ebenso daran, daß die Elektronik einen im Moment des Manipulierens absorbiert, zwischendurch jedoch gelangweilt läßt – weswegen bei Computerspielen die zu meisternden Abenteuer als Trommelfeuer hereinbrechen.
Diesen Äußerlichkeiten entspricht ein Wandel im Verhältnis zu geistigen Inhalten. Daß Ideen immer selbstverständlicher wie temporär funktionale Zustandsgrößen aufgefaßt werden, braucht nicht erst ein Kunsthistoriker zu demonstrieren. Galt früher der Wechsel von Theorien als mühsam gebahnter, ja durch Gewissensnöte freigekämpfter Weg, so muß heute kein Intellektueller seine Bahn im edlen Streit ums Richtige und Gute rechtfertigen, da es niemandem mehr auf- oder gar mißfällt, daß er schlagartig seine Voraussetzungen gewechselt hat. Selbst kanonische Bild- und Sprachformeln können angesichts dieser immer nur für den Augenblick stabilen Fixierung ihre äußere Beständigkeit einbüßen. Momentane Wirkung zählt, nicht gesicherte Form. Zu einem Text, also einer Menge per se arbiträrer Zeichen erklärt, damit aller Schwere von Endgültigkeit ledig, geht die äußere Erscheinung auf Distanz vom eigentlichen Ausdrucksgehalt. Sie wird ein jederzeit verbesserbares Make-up, ein Film, der Umschnitte verkraften muß. Sinn dagegen hält sich fortan hinter vielen möglichen Versionen skizzenhafter Ausfertigung verborgen. Zwangsläufig löst er sich so von dramaturgisch-sequentieller Eindeutigkeit und wandert ab in die kleineren Bestandteile, die jeder für sich, aber nie über sich hinaus Geltung beanspruchen können. Textbausteine für Geschäftsbriefe wie auch die Modularisierung ganzer Firmenstrukturen sind nur erste Spuren dieser Denkhaltung. Die Separation in momentane Machbarkeiten wird weitergehen – wohin, bleibt offen. Sicher freilich ist, daß ein Werkzeug den Umgang mit mentalem Gut wesentlich in die Richtung einer pluralistischen und punktualistischen Ästhetik treibt: das Betriebssystem Windows und seine elektronischen Verwandten.
Wer Windows nutzt, kann dank Multitasking prinzipiell so viele Programme starten, wie der Hauptspeicher seines Computers bewältigt; er kann sich praktisch verzögerungsfrei gleichzeitig als Briefschreiber, Buchhalter, Konstruktionszeichner und Golfspieler betätigen. Nahezu jede Art beruflicher und privater Rolle ist parallel verfügbar. Eifrig studieren Soziologen die künstlichen Welten sogenannter MUDs (Multiple User Dungeons, vornehmer Domains), sozialer Phantasiereiche im globalen Datenverbund, die sich aus Anfängen in Kampfspielform zu regelrechten Gruppenexperimenten entwickelt haben, ja sogar schon gelegentlich Ausbildungszwecke erfüllen. Zumindest jemand, der solche Rollenwelten ins Leben ruft, kann die Mitspieler und ihr Schicksal jederzeit überwachen. Selbstbestimmung gestattet der Datenraum stets nur mittelbar, dafür jedoch unbegrenzt – um den Preis, daß noch die absorbierendste Betätigung in der elektronischen Kulissenwelt lediglich das Manipulieren von Bytes bedeutet und der Ausführende das auch weiß. Wie hoch dieser Preis für den Begriff von menschlicher Identität tatsächlich ist, zeigt neben vielem anderem das beharrliche Fortleben einer Kognitionswissenschaft, in der durch Rückschluß menschliche Einsicht und Schöpferkraft allen Ernstes analog zur Häufung und Umwälzung diskreter Daten gedeutet werden. In solcher a priori endlichen Welt aus immer schon potentiell bekannter, da irgendwo gespeicherter Information kann nur die möglichst rasche Verknüpfung möglichst entlegener Daten Originalität beanspruchen, womit man noch vor das frühaufklärerische Denkmodell vom ›Witz‹ als Inventionskraft zurückgefallen ist. Die Münchhausen-Ideologie der radikalen Konstruktivisten vollendet diesen abgeschlossenen Bau zu klinischer Reinheit.
Aber das datentechnisch fundierte Denkmuster beliebig umschaltbarer Zustandsbilder hält nicht bloß einige Spielsüchtige und Theoretiker gebannt. In nahezu allen aktuellen Erkenntnisfragen setzt die öffentliche Argumentation »Grundwerte« als diskrete Größen voraus, die, Parametern vergleichbar, primär wertfrei statuiert und umgeordnet werden können. Ob es um die Ozonschicht geht oder um den Arbeitsmarkt: Alles hängt von den Prämissen ab, und die scheinen dem geläufigen Dezisionsdenken zunächst und im Prinzip frei wählbar. Auch daß jeder Eingriff das unüberschaubare Ganze betreffen muß, daß Kalkulierbarkeit folglich nie mehr als eine schöne Hoffnung bleiben kann, gilt unter den Klein-Demiurgen aller Couleur längst als technologische Binsenweisheit. Wirkung bleibt mittelbar, darum kommt es so sehr auf die Wahl der Grundelemente an – eine Spätversion des axiomatischen Optimismus vom Anfang des Jahrhunderts, die vergessen läßt, daß ihre unbekümmerte Resignation aufs Vielfältige ein Schema digitaler, als Nebeneinander imaginierter Wertigkeiten geradezu voraussetzt.
So möchten beispielsweise ungezählte Schreibende und Redende durch politisch korrekten Sprachgebrauch dazu beitragen, angebliche Diskriminierungsnachteile auszugleichen. Ob die bewußte Entscheidung fürs schriftliche und mündliche Tabu tatsächlich im angestrebten Sinne wirkt, würden zwar höchstens einige Aktivisten beschwören; alle übrigen hoffen mit systemischer Ungewißheitsmarge. Doch selbst ihren Gegnern wird kaum je bewußt, daß schon die Annahme, sich im Ausdruck frei entscheiden zu können, auf der Verengung kultureller Zeichenhaftigkeit zu diskreten Größen beruht. Wer aus unbewußter Überzeugung die Geschlechterpolarität als feste Werte wie Null und Eins, oder weniger freudianisch als A und B, beschreibt, benötigt etwa für die darin zunächst nicht vorgesehenen Übergänge plötzlich eine komplizierte Mehrwertigkeit, die auszutüfteln so viel Zeit kostet, daß das Ergebnis mit entsprechend scholastischem Stolz verkündet wird. Das Weltknäuel aus Hautfarben und Herkunftsregionen fordert, sobald unser Gleichheitsideal ihm präzise Individualwerte abverlangt, erst recht einen sprachtheoretischen Vorbehalt, der oberflächlich gesehen zu universaler Einfühlung, tatsächlich aber zu sprachlichen Billiglösungen führt – schon deswegen, weil für wirklich humane Praxis, für eine Haltung der Wesentlichkeit schlicht die Zeit fehlt. Paradoxerweise schlägt so das unabschließbare, eben historisch offene Bemühen, Individuelles zu respektieren, in Pauschalisierung um, und es beginnt, fatal an die Hoffnung zu erinnern, daß zur Aufklärung, ganz gleich was man so nennt, bloß der rechte Lichtschalter gefunden werden müsse – einer dann natürlich dauerhaft, also endzeitlich, undialektisch, ja unhistorisch gedachten Aufklärung.
Selbst die so kraftvoll wiedererwachte Sehnsucht nach Moralstandards ist anfällig für derlei digitale Schemata. Kataloge von Primär- und Sekundärtugenden, ob an Umfragezahlen erläutert oder vom Katheder deduziert, wirken schon wegen der Einteilung menschlichen Verhaltens nach diskreten Kategorien wie unverbindliche Augenblicksmodelle. Ihre Wirksamkeit kommt der Art nahe, wie das Stadtplanungsspiel »SimCity« soziale Standards repräsentiert: In diesem schon klassischen Computerspiel, zumindest seinen frühen Versionen, bemißt sich Wohlergehen an Produktionsziffern, Verkehrsströmen und Siedlungsvortrieb, die öffentliche Moral ist an der Dichte der Polizeiwachen abzulesen, und der allmächtige virtuelle Bürgermeister – de facto der Spieler am Bildschirm – muß mit Unruhen höchstens dann rechnen, wenn er die Steuern erhöht. Und steckt nicht auch im vieldiskutierten Begriff »Multikulturalismus« schon die Annahme, daß kulturelle Eigenarten eine in sich wertentrückte Grundmenge gleichrangiger Optionen bilden? Läßt nicht der vornehm desinteressierte Ton all die vielen historisch erstrittenen und erlittenen Konturen von Identität so abgrenzbar erscheinen wie Programmkanäle im Kabelfernsehen und ihre Pluralität so erhaltenswert wie die bestialische Artenfülle im Zoo? Drängen wohlmeinende Toleranzformeln à la »Weltethos« das Charakteristische der angeblichen Kulturen nicht derart zusammen, daß vom Schicksal des Werdens eine Kollektion von Vorurteilsmasken übrigbleibt, nach deren befremdender Besichtigung man höchst indigniert ist, daran erinnert zu werden, daß auch die eigene schwerlich abnehmbar oder gar auszuwechseln wäre?
Wie in diesen Fällen die Menge des scheinbar Verfügbaren, Fertigen, Optionalen unbemerkt zu schlechter Pluralität gemindert wird, so neigt unsere digital brüchig gewordene Wahrnehmung zur Radikalform jener »Blasiertheit«, die Georg Simmel am überforderten Metropolenbewohner gewahrte. Abgebrüht davon, daß niemand mehr ihm garantieren kann, ob die neue Version seines PC-Betriebssystems »stabil« läuft oder nicht, überrascht es den Manipulateur von Datenzuständen kaum noch, daß soziale und geistige Betriebssysteme zuweilen ebenfalls abstürzen. Unwillkürlich nimmt er an, daß auch jenseits der Festplatten für den nötigen Ersatz an Lebens- und Gedankensoftware gesorgt sein dürfte: Die Experten werden schon ein neues Modell liefern, auch wenn ihr nächstes Produkt genauso eine mit Fehlern durchsetzte Betaversion sein mag. Wer dennoch, statt sich cool dieser entbürgerlichenden Vergleichgültigung zu fügen, Wahrheit im Singular verlangt, ist wirklich selber schuld – vielleicht ohnehin jeder, der von irgendeinem der vielen Zustände auf dem geistigen Bildschirm mehr verlangt als ein meßbares Quantum Hirnstimulation. Charakteristischerweise sind Aufsatzsammlungen, in denen Widersprüchliches nach Proporzregeln nebeneinander stehenbleibt, in fast allen Geisteswissenschaften zur beliebtesten, da raschesten Publikationsart avanciert: Wähle jeder, aus welchen Gründen und Traditionen auch immer, die ihm gerade genehme Les- und Denkart, ganz wie in seiner restlichen Wahrnehmungswelt üblich; übermorgen werden neue Bilder die heutigen ohnehin vollständig überschreiben. In den Künsten ist diese Verabschiedung des Unbedingten zugunsten der Resignation auf ein virtuelles System schon alltäglich. Kaum absehbar, was solche Haltung aus dem Begriff der Geschichte insgesamt macht.
Am nachhaltigsten aber wirkt sich das digitale Flimmern, der Abschied vom Sequentiellen, auf den Begriff des Wissens selbst aus. Wissen steht der diskret meßbaren Akkumulationsgröße Information so nahe, daß schon aus praktischen – von physikalischen bis administrativen – Gründen seine Verwaltung und Verfügbarkeit wichtiger werden als jede inhaltliche Klärung. Nicht was und wozu, sondern wieviel und wie rasch man weiß, gilt als Stärke, ja noch die Geschwindigkeiten der Informationsströme oder die Angabe, in wie wenigen Jahren sich »das Wissen« der Menschheit schon wieder verdoppelt habe, signalisieren beruhigenden Reichtum. In vielen, auch der Wortwahl nach repräsentativen Studien ist vom kulturellen Kapital des Wissens die Rede, vom Aufbruch in die Wissensgesellschaft und davon, daß Wissen als Problemlösungsmittel füglich »vernetzt« werden müsse wie die Computer. Solch von Experten verschaltetes Wissen, dessen einheitliche Intensität und freie Abrufbarkeit seine Hauptvorzüge ausmachen, ein positivistisch egalitäres Wissen im krudesten Sinne der »natural sciences«, ist von Erkenntnis längst auch seiner Anmutung nach so verschieden, daß der gelehrten Betrachtung allenfalls seine Strukturen (mit Foucault gesprochen) und Stadien – Entwicklungsphasen wäre schon zuviel gesagt – einer Untersuchung würdig erscheinen. Konnte Robert Musils General Stumm von Bordwehr noch über dem endlosen Prospekt geistiger Gehalte und Hierarchien in der Staatsbibliothek tragikomisch resignieren, so hinterläßt die endlose Parataxe des Wissens von heute nur mehr vagen Appetit auf ein ganz anderes. Das leichthin verkündete Wort von der Entwertung des Wissens gewinnt Profil, sobald man sich klarmacht, mit welcher Mühe etwa Philosophen gegenwärtig eine Ahnung davon zurückzugewinnen trachten, was ein Sonnenuntergang ist. Noch das am wenigsten digital erfaßbare Grundverhalten des Menschen, seine urtümlichste Traditionalität, das Erzählen, gerinnt durch die postmoderne Rede von sinnstiftenden »großen Erzählungen« zur Sammlung austauschbarer, verwechselbarer, wiewohl angeblich magisch bindekräftiger Bilder.
All diese Aspekte erscheinen gebündelt in der ästhetischen Form des Internets. Seine jederzeit abrufbaren Datenzustände tragen Zeit-, also Verfallsstempel. Seine kaum begrenzten Wachstumsreserven zwingen dazu, möglichst exotische, unverwechselbare Namen für Personen und Institutionen zu verwenden, damit sie im ungeheuren Zeichenindex der Suchmaschinen nicht begraben werden. Häufigste Erscheinungsarten historischer Kontinuität im Internet sind Katalog und Update, also pures Nebeneinander und totaler Ersatz – jene beiden Formen von Vielfalt, die am wenigsten Sequentialisierungsmühe erfordern. »achtung: was besteht, ist veraltet«, schrieb der schlitzohrige Oswald Wiener 1969 – sein subversiv gemeinter Satz, hier ist er Ereignis, ja Prinzip geworden. Kaum etwas fürchten Anbieter im World Wide Web so sehr wie das Image, ein Klassiker zu sein. Was schon vergangenes Jahr »ins Netz gestellt« wurde, trägt unwillkürlich den Makel des rettungslos Überholten, selbst wenn es ein Verzeichnis aller römischen Konsuln sein sollte. Mit moderaten, periodischen Überarbeitungen ihres Layouts versuchen die gefragtesten Websites, dieser vor dem Fernsehschirm antrainierten kleinen Neugier aufs optisch Ungewohnte entgegenzukommen. Als kameradschaftliches »work in progress« auftretend, sehen die weniger dilettantisch geplanten Wissensreserven im Internet sich gezwungen, in möglichst kurzen Abständen ein frisches »What’s new«-Angebot zu präsentieren: Wissen folgt hier dem Vorbild des Nachrichtentickers. Das Internet ein »kulturelles Gedächtnis« zu nennen, das sagt einiges über den Zustand von Kultur und Gedächtnis.
Verwechsle darum niemand den Internet-Surfer vorschnell mit jenem scheinbar ähnlich verpflichtungslosen Helden der Moderne, dem Flaneur. Beschritt dieser seine Passage vor dem Hintergrund historischer Identitäten, der beobachteten wie der eigenen, nahm er sie wahr als ein Kontinuum und Ensemble von Stimmungen und Nuancen, so vollzieht sich das angebliche Gleiten des Surfers tatsächlich als von Klick zu Klick diskontinuierliches Springen ins Ungewisse der nächsten digitalen Bildinformation. Spähte der Flaneur nach Valeurs, so ist der Surfer ein habitueller Umblätterer von selbstzweckhafter Eile und Zerstreutheit, ein »user«, der von Schlagzeilen oder optischen Effekten aufgehalten werden möchte und dem alles, was die Zeichenmenge eines Bildschirms überschreitet, suspekt werden muß. Die pure Vielfalt des Verfügbaren läßt sehende oder gar engagierte Betrachtung einfältig erscheinen; zum Ziel führt allein kühles, rasantes Durchmustern. Und weil das Internet ein All allzeit scheinbar aktueller Resultate ist, ein Arsenal des Fertigen, mit dessen Fülle jeder Nutzer nur noch fertig werden, zurecht und zu Rande kommen will, entspricht es aufs Genaueste einer Auffassung von Wissen, der Geltung, Gehalt und Gestalt vorderhand gleichgültig, Verfügbarkeit und Vielfältigkeit indessen heilig sind.
Der wachsende Abstand von den Zeiten, als das Wissen noch geholfen hat – nämlich zur Erkenntnis –, ist an manchem Indiz im elektronischen Verbund abzulesen, bis auf Zeichenebene. So bieten einige Suchmaschinen inzwischen die Möglichkeit, Namen und Wörter auch dann ausfindig zu machen, wenn der Fragende sie nicht exakt buchstabiert. Ein Schema, das Mayer, Meyer, Mair und Meier gemeinsam herbeischafft, ist ohne große Mühe über Konsonantenraster programmierbar, und es genügt, in einem seriösen elektronischen Bibliothekskatalog einmal die Buchstabenfolgen »Berthold Brecht« oder »französich« zu suchen, um den Vorteil derartiger Hilfen einzusehen. Vermutlich jedoch nehmen viele, für die das digital gespeicherte Dokument zum Regelfall geworden ist, abweichende Schreibarten, hinter denen ja sprachlich-geistige Identitäten und Traditionen stehen, nicht einmal mehr wahr. Da nennt ein Internet-Antiquar aus Texas, immerhin jemand, der mit bejahrtem Schrifttum seinen Lebensunterhalt verdient, den Druckvermerk seiner Angebote regelmäßig ihr »Copywrite«– das Festhalten des Lauts genügt, für akkurateren Umgang mit den kulturellen Zeichen fehlen halt Zeit, Kenntnis, Stil und Aufmerksamkeit. Manche Schreibprogramme sorgen darum mit Hilfe eines überwachenden Algorithmus zumindest im Wortschatz von Geschäftsbriefen für Einheitlichkeit. Es könnte ja sein, daß der, an den der Brief geht, ausnahmsweise sensibel geblieben ist und die weltweite orthographische Anarchie noch nicht seufzend oder achselzuckend hingenommen hat. Die meisten haben es längst; wirkt doch der Grundsatz, Ausdruck und Gedanke stünden in Beziehung, angesichts des blinkenden Schwalls von Nebeneinander im Internet so rührend antiquiert wie die Bemerkung, durch historische Erfahrung wollten »wir« ja »nicht sowohl klug (für ein andermal) als weise (für immer)« werden.
Jacob Burckhardt, der so sprach, hielt Wandlung für das Wesen der Geschichte. Wem der unausgesetzte, ins Vergrauen übergehende Wechsel digitaler Information zur normalen Erscheinungsart seiner Wahrnehmung und seines Wissens geworden ist, könnte davon substantieller verändert werden, als daß ihm nur die überkommene Schreibung von ein paar Wörtern gleichgültig wird. Er könnte auf längere Sicht den Sinn für Wandlung, für Schicksal, für das Werden im Vergehen überhaupt verlieren: Wem Folge fehlt, kommt auch Folglichkeit abhanden. Sich selbst höchstens als Knoten in einem unabsehbaren Schaltplan von Zuständlichkeiten sehend, kann ihm seine ästhetische Einstellung kontingent, optional, formfrei und maßstablos werden. So steigert der Abschied vom Sequentiellen die Krise der ästhetischen Subjektivität und nährt das Verlangen nach Überzeugungen.