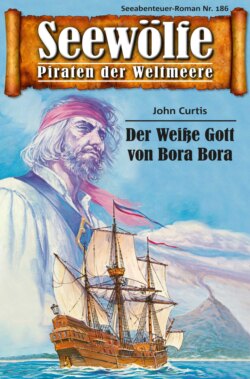Читать книгу Seewölfe - Piraten der Weltmeere 186 - John Curtis - Страница 4
1.
ОглавлениеDer Abend legte seine ersten Schatten über die Bucht von Faanui. Der Himmel im Westen von Bora-Bora hatte sich blutrot gefärbt. Im Innern der Insel, dort, wo der Osthimmel sich bereits mit dem Dunkel der herannahenden Nacht überzog, ragten stumm und drohend die Gipfel des Paja und des Otemanu empor.
Bora-Bora, die Perle der Inseln unter dem Winde, erlebte unruhige Zeiten. Sie kannte das zwar, denn viele Kriege hatten bereits ihre weiten Strände und die felsigen Hänge aus dunklem Basalt überzogen. Und auch an den steilen Hängen des Paja und des Otemanu waren schon die Todesschreie vieler Menschen verhallt, die dort den Göttern geopfert worden waren.
Aber das alles lag fast Jahrtausende zurück, und den wilden Jahren war eine Periode des Friedens gefolgt. Die Insel war reich, sie bot ihren Bewohnern alles, was sie zum Leben brauchten. Die Brotfrucht, Früchte in Hülle und Fülle, das klare Wasser kühler Quellen, weite, weiße Strände, die mit Kokospalmen bestanden waren, blauen Himmel, Sonne, das weite Meer und die herrliche Bucht Faanui, in der es sich nach Herzenslust baden ließ.
Vor Stürmen schützte die Insel ein weiter, sie umgebender Ring aus Korallen. Dort brach sich die Wucht der Wogen. Für fremde Eindringlinge, die dieses Paradies in guter oder auch böser Absicht besuchen wollten, gab es nur eine einzige Passage, die zwischen den Korallen hindurch an die Strände Bora-Boras führte. Dorthin, wo hübsche junge Mädchen mit brauner Haut, langen dunklen Haaren und lachenden Augen auf ebensolche jungen Männer warteten.
Nein, niemand hatte auf Bora-Bora damit gerechnet, was dann, eines Morgens, geschehen war. Kanonendonner rollte über die See heran. Die Bewohner der Insel stürzten aus ihren Hütten, liefen zum Strand hinunter und schoben ihre Auslegerboote ins Wasser. Sie paddelten durch die Bucht bis Moto Mute, dem vorgelagerten Schwemmland, das die Innenseite des Korallenrings bildete.
Aber sie sahen nichts, sie hörten lediglich den rollenden Geschützdonner, der immer lauter und heftiger zu ihnen herüberdrang. Sie trauten sich jedoch nicht, mit ihren Auslegerbooten hinauszusegeln aufs offene Meer, um nachzuschauen. Ihr alter Häuptling, der Papalagi, hatte es ihnen streng verboten.
Gegen Abend dieses verhängnisvollen Tages tauchte erst ein Segel über der Kimm auf, dann ein zweites und schließlich auch noch ein drittes.
Die Bewohner von Bora-Bora staunten. Noch nie hatten sie derartig große Fahrzeuge gesehen. Die Schiffe näherten sich rasch der Insel, durchsegelten schließlich auch die Passage von Teavanui und ankerten dann in der Bucht von Faanui.
Fragend blickten die Menschen auf den alten Papalagi, der stumm auf dem Schwemmland stand und die Fremden beobachtete. An seinem Gesichtsausdruck erkannten sie, daß er die Götter befragte, aber sie schienen ihm eine befriedigende Antwort zu verweigern.
Schließlich richtete sich der Papalagi auf.
„Ihr kehrt in eure Hütten zurück“, sagte er. „Ich werde die Fremden fragen, was sie auf Bora-Bora wollen. Fremde haben für unsere Insel noch nie etwas Gutes bedeutet.“
Die Inselbewohner gehorchten ihrem Papalagi. Sie stiegen in ihre Boote und paddelten zurück. Aber noch bevor sie den Strand erreichten, brüllten die Geschütze der großen Schiffe auf, und viele starben. Auch der Papalagi.
Etwas später ruderten die Fremden an den Strand. Sie waren schwer bewaffnet. Die Inselbewohner, die das Massaker in der Bucht überlebt hatten, wollten in die Berge fliehen. Aber die Fremden verfolgten sie, fingen sie wieder ein, verhörten sie, vergewaltigten die jungen Mädchen und Frauen und hielten jede Woche einen Gerichtstag ab.
Auf Bora-Bora erstarb das Lachen der Menschen. Die jungen Mädchen badeten nicht mehr in der Bucht, sondern versteckten sich in den Bergen zusammen mit ihren jungen Männern. Auch die Alten waren längst geflohen. Die Hütten am Strand von Bora-Bora waren verwaist.
Die großen Schiffe lagen noch immer in der Bucht von Faanui, furchteinflößende Kolosse, die hin und wieder ihre Tod und Verderben bringenden Feuerrohre erdröhnen ließen, damit die Inselbewohner ja nicht vergaßen, daß es sie noch gab.
Aber dann kam der Tag, an dem der neue Herrscher von Bora-Bora den Inselbewohnern befahl, in ihre Hütten zurückzukehren, anderenfalls er sie alle fangen und töten lassen würde. Dieser Mann nannte sich El Supremo, der Göttliche, und er war ein Riese von Gestalt mit einem langen grauen Bart und merkwürdig brennenden Augen.
Die Inselbewohner fürchteten ihn, und so gehorchten sie seinem Befehl. Sie kehrten in ihre Hütten zurück und sahen zu ihrem größten Erstaunen, daß auch andere Menschen, die eine weiße Haut hatten wie El Supremo, der Göttliche, gefangen waren wie sie und Sklavendienste leisten mußten wie sie und geschlagen wurden wie sie.
Die Inselbewohner verstanden gar nichts mehr, denn ihre eigenen Götter schienen sie verlassen zu haben. Aber die Zeit verging, und die Soldaten El Supremos wachten darüber, daß hart gearbeitet wurde auf Bora-Bora. Schließlich war aus der einst so paradiesischen Insel eine Festung geworden. Am weißen Strand erhoben sich hohe Palisaden mit spitzen Pfählen. Keiner der Inselbewohner durfte je das Innere dieser Festung betreten und jene, die die Soldaten El Supremos hineinschleppten, sah niemals jemand wieder. Angst und Schrecken verbreiteten sich auf Bora-Bora vor dem neuen Gott, der sich zu Füßen der heiligen Berge Paja und Otemanu niedergelassen hatte und unvorstellbar grausam regierte.
El Supremo hielt Hof. Dazu hatte er sich auf einem thronartigen Gebilde niedergelassen. Er war in ein weites weißes, mit Goldfäden durchwirktes Gewand gehüllt. Ein grauer Bart und schulterlanges graues Haar, das von einem Stirnband gehalten wurde, verlieh ihm das Aussehen eines Patriarchen. Aber dieser erste Eindruck wurde bei näherem Hinsehen durch das scharfe Profil, die zusammengepreßten Lippen und die brennenden Augen sofort wieder zerstört.
Mit der Rechten führte er eine herrische Geste aus.
„Bringt sie her“, befahl er zwei Spaniern, die in devoter Haltung vor seinem Thron standen. „Ruft den Foltermeister und seine Knechte. Diesmal werden sie reden, sie werden mir, dem Gott dieser Insel, alles sagen, was ich wissen will. Alles!“
Die beiden Spanier verneigten sich. Dann zogen sie sich unter weiteren tiefen Bücklingen im reich geschmückten saalartigen Raum zurück, um den Foltermeister und seine Knechte zu holen. Zwei andere Spanier entfernten sich auf gleiche Weise, um die beiden Gefangenen, von denen El Supremo gesprochen hatte, herbeizuschaffen.
Durch den Thronsaal ging ein Raunen. Die meisten Augenpaare richteten sich auf die Folterbank, die bereits zu Füßen des Göttlichen aufgestellt worden war, und auf das Feuer, das mit bläulicher Flamme in dem großen Kohlebecken tanzte.
Viele der Spanier, die an diesem Abend von El Supremo in den Thronsaal befohlen worden waren, empfanden so etwas wie ein Lustgefühl in bezug auf die bevorstehende Folterung. Denn sie kannten sich aus, weil an jedem Gerichtstag irgend jemand gefoltert wurde. Nur diesmal war das etwas anderes.
Denn die beiden Gefangenen, denen das hochnotpeinliche Verhör bevorstand und denen auf diese Weise die Zunge gelöst werden sollte, nachdem sie bisher bei keinem der Verhöre auch nur einen Laut von sich gegeben hatten, waren keine geringeren als der Sohn des getöteten Papalagi und seine junge Frau Nu-Nui. Das allein schon verhieß ein großartiges Schauspiel zu werden, denn Nu-Nui war eine Frau von außergewöhnlicher Schönheit.
El Supremo hob die Rechte.
„Versorgt alle mit Wein, wie es an jedem Gerichtstag üblich ist!“ befahl er und quittierte das aufbrandende Gemurmel mit einer huldvollen Geste. Dann erhob er sich.
„Niemand auf Bora-Bora widersetzt sich meinem Willen. Denn ich, El Supremo, dulde das nicht. Ich habe Bora-Bora in eine uneinnehmbare Festung verwandelt. Von hier aus werde ich mein Reich gründen. Ein Reich, das die gesamte Südsee umspannt. Wer mir in Treue dient, der wird von mir belohnt werden, aber wer sich mir widersetzt, auf den wartet der Tod. Ich weiß, daß es auf dieser Insel eine kleine Gruppe von Eingeborenen gibt, die El Supremo, den Göttlichen, stürzen und ermorden wollen. Ich weiß, daß einigen dieser verdammungswürdigen Engländer, die die Frechheit hatten, mich, den Göttlichen, auf offener See anzugreifen und mir schwere Verluste zuzufügen, die Flucht geglückt ist, weil die Eingeborenen ihnen dabei geholfen haben. Deswegen werde ich heute den Sohn des Papalagi und seine Frau befragen, denn sie wissen alles, und dann werde ich alle jene erbarmungslos vernichten, die es gewagt haben, mir zu trotzen.“
El Supremo hob seinen schweren Pokal. Der rote Wein funkelte im geschliffenen Kristall. Die Spanier sprangen auf. Auch sie erhoben ihre Humpen und zollten der Rede des Göttlichen, wie El Supremo sich nannte, lautstark Beifall. Dabei wußten viele von ihnen, daß dieser Mann nicht normal war, aber sie hüteten sich, sich das auch nur im geringsten anmerken zu lassen, denn El Supremo hatte auf Bora-Bora die absolute Macht. Dreihundert Soldaten scharten sich um ihn und beherrschten die Insel bis in den letzten Winkel.
Nur ein kleines Gebiet zwischen den beiden heiligen Bergen Paja und Otemanu hatte sich bisher ihrer Schreckensherrschaft entzogen. Was immer El Supremo an schwerbewaffneten Soldaten dorthin entsandt hatte – sie waren spurlos verschwunden und niemals wiedergekehrt. Auch dieses Problem wollte El Supremo an diesem Abend lösen.
Durch einen glücklichen Zufall war es einem Trupp seiner Soldaten gelungen, des Anführers der Aufständischen und seiner jungen, bildschönen Frau habhaft zu werden. Dabei war die junge Frau für El Supremo beinahe noch wertvoller als der Sohn des Papalagi, dessen Namen niemand kannte.
El Supremo hatte sich vorgenommen, Nu-Nui zuerst foltern zu lassen, und ihr Mann würde es mitansehen müssen. Das würde ihn zum Reden bringen, ohne daß El Supremo Gefahr lief, den Sohn des Papalagi schon durch die Folter zu töten.
Denn eins war seltsam bei den Eingeborenen Bora-Boras: es gab Dinge, die zwar jeder Spanier leicht zu ertragen vermochte, aber die Eingeborenen starben daran. Plötzlich, ohne daß man noch irgend etwas dagegen tun konnte.
Im Saal des Regierungspalastes entstand eine Bewegung. Der Foltermeister und seine Knechte zogen ein. In großen Körben schleppten sie ihr furchtbares Handwerkzeug mit sich. Zangen, Nadeln, Fuß- und Daumenschrauben und andere schreckliche Dinge. Dicht hinter ihnen folgten zwischen einem Trupp von Spaniern, deren schwere Kupferhelme im Licht der flackernden Fackeln glänzten, die beiden Gefangenen – ein noch junger Eingeborener von athletischem Körperbau und eine Frau, ebenfalls hochgewachsen und von einer Schönheit, die unwillkürlich die meisten den Atem anhalten ließ.
Beide trugen an den Händen schwere Eisenfesseln, aber die Ketten waren lang genug, um ihnen genügend Bewegungsfreiheit zu lassen. Sie würdigten die Spanier keines Blickes, und schon das allein, diese offen zur Schau getragene Verachtung, versetzte El Supremo in rasende Wut. Aber er beherrschte sich und ließ sich nichts anmerken.
Wenige Schritte vor dem Thron, unmittelbar neben der Folterbank, blieben der Foltermeister und seine Knechte stehen und verneigten sich fast bis zum Boden. Anders die beiden Eingeborenen. Sie dachten gar nicht daran, ihre Knie zu beugen, sondern starrten El Supremo aus ihren dunklen Augen nur an.
El Supremo lief rot an.
„Auf die Knie mit ihnen!“ schrie er außer sich vor Wut. „Bringt ihnen bei, wie man sich El Supremo gegenüber zu verhalten hat!“
Einer der Spanier, der sich eben wieder aus seiner gebückten Haltung aufrichtete, befolgte den Befehl sofort. Er schlug erst dem Sohn des Papalagi und dann Nu-Nui die Hellebarde in die Kniekehlen. Sofort knickten den beiden die Beine weg, und sie stürzten zu Boden. Darauf sprang ein zweiter Spanier herbei und setzte dem Sohn des Papalagi die Spitze der Hellebarde auf den Rükken, als er sich aufrichten wollte. Das gleiche geschah bei Nu-Nui.
Es blieb ihnen nichts anderes übrig, sie mußten diese Demütigung hinnehmen, aber niemand sah, daß sie sich mit einem raschen Blick verständigten. Auch El Supremo entging dieser Blick. Aber Nu-Nui und ihrem Mann genügte er.
El Supremo baute sich vor den beiden auf und gab den beiden Spaniern mit den Hellebarden einen Wink. Die Soldaten zogen die Waffen zurück.
„Aufstehen!“ befahl El Supremo. „Wenn ich mit euch rede, dann habt ihr zu stehen!“
Nu-Nui und ihr Mann erhoben sich. Der Blick des Anführers der Aufständischen streifte die Folterbank, und sofort wußte er, was ihnen bevorstand. Blitzschnell sah er sich weiter um. Dann zuckte er wie ein jäher Entschluß über sein ebenmäßig geschnittenes Gesicht. Er wandte sich Nu-Nui zu und wollte etwas zu ihr in seiner eigenen Sprache sagen, von der er wußte, daß die Fremden sie nicht verstanden. Aber El Supremo kam ihm zuvor. Er winkte einen schmächtigen Mann zu sich heran, der weder Weißer noch Eingeborener war.
„Du wirst jetzt dolmetschen, Juan“, sagte er. „Aber wehe, wenn du ein falsches Spiel mit mir zu treiben versuchst, du weißt, was darauf steht.“
Der Mann knickte in sich zusammen und verneigte sich tief.
„Sehr wohl, Göttlicher! Nie würde ich es wagen, auch nur eins deiner erlauchten Worte …“
El Supremo schnitt ihm mit einer Handbewegung das Wort ab. Dann blickte er die beiden Eingeborenen an. Und fast tat es ihm um die bildhübsche junge Frau leid, die, einen bunten Rock um die Hüften geschlungen mit ihren kleinen festen Brüsten, so nackt, wie Gott sie erschaffen hatte, wor ihm stand. El Supremo entging auch nicht, wie lüstern die anderen Spanier Nu-Nui anstarrten. El Supremo hatte es schon zu oft erlebt, er wußte, wie Menschen nach der Folter aussahen.
Er wandte sich dem Sohn des Papalagi zu.
„Wie heißt du?“ ließ er durch den Dolmetscher fragen.
Er erhielt keine Antwort, dafür aber einen Blick, der dem Göttlichen das Blut in die Wangen trieb. Einen Moment verspürte El Supremo das Bedürfnis, sich auf diesen Eingeborenen zu stürzen, aber er bezwang sich. Er ballte seine Hände zu Fäusten, daß die Knöchel weiß hervortraten.
„Du willst immer noch nicht antworten?“ fragte er mit leiser Stimme. „Du wirst reden, heute, hier und jetzt!“
El Supremo tat noch einen Schritt auf den Sohn des Papalagi zu.
„Ich lasse jetzt deine Frau auf die Folterbank spannen. Die Folterknechte werden sie sich vornehmen, und du wirst zusehen. Ich kenne mich aus, du wirst darum betteln, daß die Folterknechte aufhören, du wirst mich auf den Knien anflehen, daß ich dir erlaube, zu reden und alles zu sagen, was du weißt!“
Der Dolmetscher übersetzte, und zum erstenmal zeigte der Sohn des Papalagi Wirkung. Er wurde grau im Gesicht, alle Farbe wich aus seinen Wangen. Er wußte, daß dieser Teufel in Menschengestalt tun würde, was er angedroht hatte. Er kannte die Weißen, die seine Insel überfallen hatten, und er wußte, zu was diese Bestien fähig waren.
Blitzschnell, ehe es jemand verhindern konnte, hatte er seiner jungen Frau ein paar Worte in einem Dialekt zugerufen, die auch der schmächtige Dolmetscher nicht verstand.
Auch Nu-Nui war blaß geworden, auch sie wußte, was ihr bevorstand.
Dann handelte der Sohn des Papalagi. Er sprang vor, zu verlieren hatte er ohnedies nichts mehr.
El Supremo sah die geschmeidige, katzenhafte Bewegung. Aber er begriff nicht, was der verzweifelte junge Mann tun wollte, denn nie hätte er es für möglich gehalten, daß irgend jemand auf der Insel wagen würde, Hand an ihn, den göttlichen El Supremo, zu legen.
Die Handkette klirrte um El Supremos Hals. Im Saal brandete ein wilder Schrei des Entsetzens auf, die Wachen sprangen herbei, aber sie erstarrten mitten in der Bewegung. Entsetzen schnürte ihre Kehlen zu, ließ sie unfähig werden, sich zu rühren.
Der Sohn des Papalagi zog die Kette, die er um den Hals El Supremos geschlungen hatte, zu. El Supremo schnappte nach Luft, seine Augen traten aus den Höhlen, aber der Druck der Kette um seinen Hals verstärkte sich, erbarmungslos zog sie sich weiter und weiter zu.
Nu-Nui zögerte nicht länger. Mit einem Satz war sie bei einem der spanischen Soldaten, entriß ihm die Hellebarde und rannte zu dem großen Fenster, das seitlich des thronartigen Sessels in die Wand des Saales eingelassen war.
Ein paar heftige Schläge, ein paar Stöße, und das Fenster zersplitterte.
In diesem Moment handelte der Sohn des Papalagi abermals. Er lokkerte die Kette, packte El Supremo und beförderte ihn mit einem gewaltigen Stoß die Stufen der Empore hinunter, auf der der Thron des Göttlichen stand, genau in die züngelnden Flammen des riesigen Kohlebeckens hinein.
El Supremo flog in die Flammen, noch im Sturz riß er das Kohlebekken um, und die glühenden Stücke von Holzkohle spritzten in die Menge. Auch die Folterknechte wurden von ihnen getroffen.
Schreie erfüllten den Saal, hier und da gingen Kleider in Flammen auf, in panischer Angst drängten die Menschen zur Flucht.
Ehe überhaupt jemand richtig begriff, was für eine ungeheuerliche Sache soeben geschehen war, hechteten Nu-Nui und ihr Mann durch das zerschlagene Fenster ins Freie.
Es war ihr Glück, daß El Supremo zu seiner eigenen Sicherheit ein striktes Verbot erlassen hatte, Feuerwaffen jeglicher Art mit in den Regierungspalast zu nehmen.
Als El Supremo endlich wieder Luft kriegte, brüllte er wie am Spieß. Seine Kleidung brannte, sein Bart war versengt, er blutete aus einer großen Fleischwunde, die er sich beim Aufprall auf das Kohlebecken zugezogen hatte.
Die Folterknechte löschten sein brennendes Gewand, dann betteten sie den Göttlichen in ihrem ersten Schreck auf das Folterbett. Und dort sank El Supremo in tiefe Ohnmacht.
Die beiden Flüchtlinge hetzten zum Strand. Erst nach der Bucht Faanui beendeten sie ihren Lauf. Keuchend blieb Nu-Nui stehen, und ihr Mann schloß sie in die Arme. Eine Weile standen sie so dort, und sie sagten nichts, bis Nu-Nui sich aus den Armen ihres Mannes löste.
„Sie werden uns jagen, Rarori“, sagte sie. „Sie werden alles an Soldaten aufbieten, was sie haben, und dann sind wir auch zwischen den heiligen Bergen nicht mehr sicher. Wir müssen fort, wir müssen Hilfe holen, oder wir sterben alle!“
Rarori hielt Nu-Nui an den Händen.
„Ja“, sagte er, „aber wo finden wir Hilfe? Wir hätten El Supremo töten sollen, ich hätte ihm das Genick brechen und ihn in das Kohlebecken werfen sollen. Ohne ihn wären diese weißen Teufel hilflos gewesen, er hat den Tod tausendfach verdient!“
Nu-Nui legte ihm die Hände auf die Schultern, dann schmiegte sie sich an ihn und küßte ihn lange und zärtlich.
„Es ist gut, daß du ihn nicht getötet hast, Rarori“, sagte sie, und ihr Mann sah sie verwundert an.
„Gut? Warum soll das gut sein, Nu-Nui? Er wird noch viele von uns umbringen.“
Sie schüttelte den Kopf.
„Er behauptet von sich, ein Gott zu sein, der neue Gott dieser Insel. Aber jetzt hast du ihn vor allen Leuten lächerlich gemacht. Du hast ihn besiegt, er hat vor Angst gequiekt wie ein Schwein, das geschlachtet wer den soll. Nach dem ersten Schreck werden auch seine Leute sich daran erinnern. Wir müssen jetzt nur eins tun: rasch den nächsten Schlag gegen ihn führen. Wir müssen alle diejenigen befreien, die sich Engländer nennen, die er in seine Gefängnisse gesperrt hat und beim großen Fest hinrichten lassen will. Dann müssen wir seine Schiffe versenken, wir können das, ich weiß es, weil ich mit jenen Engländern gesprochen habe, denen wir zur Flucht verhalfen. Diese Schiffe sind groß und stark, und sie haben den tödlichen Donner, aber sie sind nicht unverwundbar, das haben wir nur gedacht.“
Rarori sah Nu-Nui eine Weile nachdenklich an.
„Nicht ich sollte der Anführer sein, sondern du“, sagte er dann.
Aber Nu-Nui wehrte lächelnd ab. „Ich bin von meinem Vater erzogen worden, Rarori, weil meine Mutter starb. Mein Vater war der Papalagi von Topua. Er war verantwortlich für die Kriegsflotte Bora-Boras. Und ich bin seine Tochter! Vielleicht bin ich dein Ratgeber, auch wenn es einer Frau nach unseren Regeln nicht ziemt. Aber die Zeiten haben sich geändert, auch auf Bora-Bora. Dem Alten, das wir bewahren, muß mehr und mehr Neues hinzugefügt werden, und das wird schneller und schneller der Fall sein. Denn diesen Fremden werden andere folgen und den anderen wieder andere. Niemand von uns weiß, wie das alles weitergehen wird, aber wir werden kämpfen, Rarori, bis wir entweder frei oder tot sind!“
Wieder sah Rarori seine junge Frau an, dann zog er sie in seine Arme.
„Wir werden nicht fliehen, Nu-Nui, wir werden das tun, was du vorhin gesagt hast. Ich habe darüber nachgedacht. Wir kehren zum Sitz des Feuergottes zurück, damit den unseren kein Unheil geschieht.“
Sie machten sich auf den Weg. Sie kannten auf der Insel jeden Pfad und jeden Abgrund, der ihnen drohte. Unangefochten erreichten sie den Sitz des Feuergottes, trotz der Soldaten, die längst die Gegend nach ihnen absuchten.