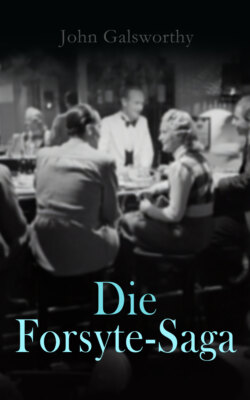Читать книгу Die Forsyte-Saga - John Galsworthy - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Siebentes Kapitel Ein Nachmittag bei Timothy
ОглавлениеInhaltsverzeichnis
Wenn der alte Jolyon beim Einsteigen in seine Droschke gesagt hätte: Ich will kein Wort davon glauben, hätte es seine Empfindungen wahrer ausgedrückt.
Das Gefühl von James und seinen Damen in Gesellschaft seines Sohnes gesehen worden zu sein, hatte in ihm nicht nur einen Unmut erweckt, der ihn immer überkam, wenn etwas ihn ärgerte, sondern auch jene geheime, zwischen Brüdern so natürliche Feindseligkeit, deren Wurzeln – oft kleine Kinderstubeneifersüchteleien – im Verlauf des Lebens zuweilen zäher werden, tiefer eindringen und ganz im Verborgenen eine Pflanze tragen, die mitunter die bittersten Früchte zeitigt.
Bisher hatte es unter den sechs Brüdern keine andere unfreundliche Empfindung gegeben, als jene durch den geheimen und natürlichen Argwohn veranlaßte, daß die andern reicher sein könnten als sie selbst. Es war ein Gefühl, das sich durch die Nähe des Todes – dem Ende aller Handicaps – und infolge der Verschwiegenheit ihres Geschäftsführers bis zur höchsten Neugierde steigerte, wenn er zu Nicholas wohlweislich von James' Einkommen sprach, zu James von dem des alten Jolyon, zum alten Jolyon von Rogers, zu Roger von Swithins, während er Swithin gegenüber die höchst erregende Bemerkung zu machen pflegte, daß Nicholas ein reicher Mann sein müsse. Timothy allein bildete eine Ausnahme, da er seine goldsichern Staatspapiere besaß.
Allein jetzt war, wenigstens zwischen zweien von ihnen, ein ganz anderes Gefühl der Kränkung entstanden. Von dem Moment ab, wo James die Impertinenz gehabt hatte, die Nase in seine Angelegenheiten zu stecken – wie er es ausdrückte – wollte der alte Jolyon dieser Geschichte über Bosinney keinen Glauben mehr schenken. Seine Enkelin durch ein Mitglied ›der Familie dieses Menschen‹ gedemütigt! Er war überzeugt, daß Bosinney verleumdet wurde. Seine Pflichtvergessenheit mußte einen andern Grund haben.
June war wohl auf ihn losgefahren, oder sonst etwas; sie war so empfindlich jetzt!
Jedoch wollte er Timothy ein wenig sein Herz ausschütten und sehen, ob er ihm weitere Winke geben würde! Und er wollte kein Gras darüber wachsen lassen, sondern gleich zu ihm gehen und wohl auf der Hut sein, damit er in dieser Sache den Weg nicht nochmals zu machen brauchte.
Er sah James' Wagen die Straße vor Timothys Haus versperren. Also waren sie vor ihm hingelangt und schnatterten wohl darüber, daß sie ihn gesehen hatten! Und weiterhin standen Swithins Grauschimmel Nase an Nase mit James' Falben, wie im Konklave über die Familie, während die Kutscher über ihnen im Konklave saßen.
Der alte Jolyon legte seinen Hut in der engen Halle auf einen Stuhl, wo der Bosinneys vor langer Zeit damals für eine Katze gehalten worden war, strich sich mit seiner dünnen Hand ärgerlich über das Gesicht mit dem hängenden weißen Schnurrbart, wie um jede Spur eines Ausdrucks zu verwischen, und begab sich nach oben.
Er fand das Vorderzimmer gefüllt. Es war zu jeder Zeit voll genug – ohne Gäste – ohne daß jemand darin war – denn Timothy und seine Schwestern fanden ein Zimmer, der Tradition ihrer Generation gemäß, nicht wirklich ›hübsch‹, wenn es nicht ›ordentlich‹ möbliert war. Es enthielt darum elf Stühle, ein Sofa, drei Tische, zwei Schränke, unzählige Nippsachen und ein großes breites Klavier. Und jetzt, wo Mrs. Small, Tante Hester, Swithin, James, Rachel, Winifred, Euphemia, die gekommen war um ›Leidenschaft und Ablenkung‹ abzugeben, das sie beim Lunch gelesen, und ihre intimste Freundin Frances, Rogers Tochter (die musikalische unter den Forsytes, die Lieder komponierte) sich in dem Zimmer aufhielten, war nur ein Stuhl unbenutzt geblieben, außer den beiden natürlich, auf die sich nie jemand setzte – und der einzige Platz, wo man stehen konnte, war von der Katze eingenommen, auf die der alte Jolyon denn auch unverzüglich trat.
In diesen Tagen war es durchaus nichts Ungewöhnliches für Timothy soviel Besuch zu haben. Jeder einzige der ganzen Familie hatte immer wahre Verehrung für Tante Ann gehegt, und nun, wo sie nicht mehr war, kamen sie noch häufiger und blieben länger.
Swithin war zuerst gekommen, er saß träge in einem roten Armsessel mit vergoldeter Rückenlehne und sah aus, als wolle er die andern alle überdauern. Mit seiner schweren Gestalt und seinem Umfang, dem dichten weißen Haar und dem unbeweglichen rasierten Gesicht entsprach er vollkommen Bosinneys Bezeichnung ›der Dicke‹ und wirkte in dem reich möblierten Zimmer urwüchsiger denn je.
Seine Unterhaltung drehte sich wie gewöhnlich in letzter Zeit, um Irene, und er hatte nicht versäumt Tante Juley und Hester seine Meinung hinsichtlich der Gerüchte zu sagen, die im Umlauf sein sollten. Ja – sie brauche wohl ein wenig Flirt, hatte er gesagt, eine schöne Frau bleibt nie unangefochten; aber mehr als das glaube er nicht. Es war nichts erwiesen, sie sei viel zu vernünftig, wüßte zu gut, was sie ihrer Stellung und der Familie schuldig war. Kein Sk– er wollte ›Skandal‹ sagen, aber der Gedanke war so abgeschmackt, daß er abwehrend die Hand bewegte wie um zu sagen – ›aber lassen wir das!‹
Möglich, daß Swithin die Situation vom Standpunkt des Junggesellen aus betrachtete – aber wozu war diese Familie, in der so viele durch eigene Kraft eine gewisse Stellung erreicht hatten, nicht berechtigt? Wenn er in dunklen pessimistischen Augenblicken auch die Worte ›Pächter‹ und ›sehr kleine Verhältnisse‹ in Verbindung mit seinen Vorfahren gehört hatte, glaubte er daran?
Nein! er hegte die geheime Ansicht und schlug sich dabei pathetisch auf die Brust, daß irgend einer unter seinen Vorvordern etwas Vornehmes gewesen sein müsse.
»Es muß so sein,« hatte er einst zum jungen Jolyon gesagt, ehe dieser auf schlechte Bahnen geraten war. »Sieh uns an – wir sind vorwärts gekommen! Es muß doch gutes Blut in uns stecken!«
Er war dem jungen Jolyon sehr zugetan! Der Junge war in Cambridge in guter Gesellschaft gewesen, hatte die Söhne des alten Halunken, Sir Charles Fiste gekannt – von denen einer auch ein schöner Lump geworden war. Und er hatte einen gewissen Stil – es war jammerschade, daß er mit diesem fremden Mädel durchgegangen war – mit einer Erzieherin noch dazu! Wenn er schon so auf und davon mußte, warum nicht mit einer, die ihnen Ehre gemacht hätte! Und was war er nun? – Beamter beim Lloyd; er sollte sogar Bilder malen – Bilder! Verflucht! er hätte als Sir Jolyon Forsyte, Bart.1 enden können, mit einem Sitz im Parlament und einem Gut auf dem Lande!
Einem Impulse folgend, der früher oder später ein Glied jeder angesehenen Familie dazu treibt, war Swithin auch auf das Heroldsamt gegangen, wo er die Versicherung erhielt, daß er ohne Zweifel der nämlichen Familie angehöre, wie die wohlbekannten Forsites mit einem ›i‹ deren Wappen ›drei Spangen rechts in schwarzrotem Felde‹, er, wie sie hofften, nun annehmen würde.
Swithin tat es jedoch nicht, aber als er sich vergewissert hatte, daß ihr Abzeichen ein ›stehender Pfau‹ war und das Motto ›Für Forsite‹, hatte er den Pfau auf seinem Wagen und den Knöpfen seines Kutschers, und das Abzeichen mit Motto auf seinem Briefpapier anbringen lassen. Das Wappen ließ er fort, teils weil er fürchtete, daß es auffallen könnte den Wagen damit zu schmücken, da er es nicht bezahlt hatte, und alles Auffallende war ihm verhaßt, und teils weil er, wie jeder praktische Mann im Lande, eine geheime Abneigung und Verachtung für Dinge hegte, die er nicht verstand – er fand, wie andere wohl auch, ›drei Spangen auf schwarzrotem Felde‹ waren ein harter Bissen.
Allein er vergaß nie, daß sie ihm gesagt hatten, er wäre berechtigt das Wappen zu benutzen, wenn er dafür zahlte, und es befestigte seine Überzeugung ein Gentleman zu sein. Unvermerkt hatten sich auch die übrigen Familienmitglieder den angeeignet, und einige, denen es ernster war, nahmen auch das Motto an; der alte Jolyon allein weigerte sich es zu führen und nannte es Humbug, der, so viel er sehen könne, gar keinen Sinn hätte.
Innerhalb der älteren Generation war es vielleicht bekannt, welch großem geschichtlichen Ereignis sie ihr Abzeichen eigentlich verdankten; und wenn sie dringend danach gefragt wurden, gestanden sie lieber schleunigst, daß Swithin es irgendwo aufgestöbert hatte, als daß sie eine Lüge sagten, denn sie logen nicht gern und waren der Meinung, daß nur Franzosen und Russen es täten.
Bei der jüngeren Generation blieb die Sache in Schweigen gehüllt. Sie wollten die Gefühle der Älteren nicht verletzen und sich selbst nicht lächerlich fühlen; sie benutzten einfach das Abzeichen ...
»Nein,« sagte Swithin, »er hatte Gelegenheit gehabt selbst zu sehen und konnte nur sagen, daß nichts in ihrem Wesen gegen diesen jungen Bukanier oder Bosinney oder wie sein Name war, sich von ihrem Wesen gegen ihn selbst unterschied, er würde tatsächlich eher sagen ...« Aber hier brach die Ankunft von Frances und Euphemia die Unterhaltung leider ab, denn diese Dinge konnten vor jungen Leuten doch nicht besprochen werden.
Und obwohl es Swithin einigermaßen erregte, gerade unterbrochen zu werden, wo er im Begriff war etwas Wichtiges zu sagen, gewann er seine Liebenswürdigkeit doch bald wieder. Er hatte Frances – Francie, wie sie in der Familie genannt wurde – sehr gern. Sie war so munter und sollte sich ein hübsches kleines Sümmchen Taschengeld durch ihre Lieder erworben haben; er fand es sehr tüchtig von ihr.
Er tat sich viel darauf zugute, Frauen gegenüber eine sehr freidenkende Haltung einzunehmen, denn er sah nicht ein, warum sie nicht Bilder malen oder Lieder, ja selbst Bücher schreiben sollten, namentlich, wenn es ihnen einen nützlichen Groschen einbrachte; warum auch nicht – es hielt sie von dummen Streichen ab; ein ander Ding, wenn sie Männer wären!
›Klein Francie‹, wie sie gewöhnlich mit gutmütiger Herablassung genannt wurde, war eine bedeutende Persönlichkeit, wenn auch nur als stehende Illustration für das Verhältnis der Forsytes zur Kunst. Sie war eigentlich nicht ›klein‹, sondern ziemlich groß; ihr Haar, (für eine Forsyte) ziemlich dunkel, gab mit den grauen Augen ihrem Aussehen etwas ›Keltisches‹, wie man es nannte. Sie machte Lieder mit Titeln, wie ›Heimliche Seufzer‹ oder ›Küß mich Mutter, eh ich sterbe‹, mit einem Refrain wie ein Anathema:
»Küß' mich, Mutter, eh' ich sterbe;
Küß' mich – küß' mich, Mutter, oh!
Küß', oh, küß' mich e–eh' ich –
Küß' mich, Mutter, eh' ich st–e–erbe!«
Sie dichtete den Text dazu selbst, und auch andere Gedichte. In froheren Augenblicken schrieb sie Walzer, von denen einer, die ›Kensington-Weise‹, in Kensington fast volkstümlich war und einen einschmeichelnden Rhythmus hatte:
Er war sehr originell. Dann waren da noch ihre ›Lieder für die Kleinen‹, zugleich erzieherisch und witzig, vor allem ›Großmütterchens Goldfisch‹ und ein beinahe prophetisch von der künftigen Stimmung des Landes erfülltes Liedchen mit dem Titel: »Haut ihm nur ›ein blaues Auge‹.« Jeder Verleger war bereit sie anzunehmen, und Zeitschriften wie ›Hohe Ziele‹ und ›Frauenhort‹ waren entzückt von »jedem neuen von Miß Francis Forsytes geistvollen, glänzenden, pathetischen Liedchen. Wir waren zu Lachen und zu Tränen bewegt. Möchte Miß Forsyte so fortfahren«.
In dem sichern Instinkt ihrer Rasse war es Francie ein Leichtes die richtigen Leute kennen zu lernen – Leute, die über sie schrieben und sprachen, auch Leute aus der Gesellschaft – sie hatte eine Liste solcher im Kopf, bei denen sie ihre Vorzüge zur Geltung bringen konnte und ließ die Stufenfolge steigender Preise, die für sie die Zukunft bedeuteten, nicht aus dem Auge. Auf diese Weise gelang es ihr sich allgemeine Achtung zu erwerben.
Einmal, zu einer Zeit als ihre Gefühle durch eine Neigung aufgepeitscht waren – denn Rogers ganze Lebensführung mit seinen eifrigen Häuserspekulationen hatte bei seiner ältesten Tochter einen Hang zur Leidenschaft hervorgerufen – wandte sie sich einer größeren ernsteren Aufgabe zu und wählte die Form einer Sonate für die Violine. Dies war die einzige ihrer Produktionen, die die Forsytes beunruhigte. Sie fühlten sofort, daß sie sich nicht verkaufen würde.
Roger, der sich freute eine talentvolle Tochter zu haben und oft auf das Taschengeld anspielte, das sie sich selbst erworben hatte, war durch diese Violinsonate ganz aufgebracht.
»Solch ein Schund!« sagte er davon. Francie hatte den jungen Flageoletti, Euphemias Geiger, aufgefordert, sie bei ihr zu Haus, in Prince's Gardens zu spielen.
Was die Sache an sich betraf, so hatte Roger recht. Es war Schund, aber – sehr ärgerlich! Eine Art von Schund, der sich nicht verkaufte. Wie jeder Forsyte weiß, ist Schund, der sich verkauft, durchaus kein Schund – keineswegs.
Und doch, trotz des gesunden Menschenverstands, der den Wert der Kunst nach dem bestimmt, was sie einträgt, konnten die Forsytes, Tante Hester zum Beispiel, die sehr musikalisch war, nicht umhin zu bedauern, daß Francies Musik, ebenso wie ihre Gedichte nicht ›klassisch‹ waren. Aber wie Tante Hester sagte, gab es heutzutage gar keine Dichtkunst mehr, alle Gedichte wären ›kleine unbedeutende Dinger‹. Niemand konnte mehr ein Gedicht schreiben wie das ›Verlorene Paradies‹ oder ›Childe Harold‹, bei denen man wirklich das Gefühl hatte, etwas gelesen zu haben. Immerhin aber war es nett für Francie etwas zu haben, womit sie sich beschäftigen konnte. Während andere Mädchen mit Einkäufen Geld ausgaben, erwarb sie es! Und sowohl Tante Juley wie Tante Hester waren immer bereit zu hören, wie Francie es wieder angefangen ihre Preise zu steigern.
Sie hörten jetzt zusammen mit Swithin zu, der sich den Anschein gab es nicht zu tun, denn diese jungen Leute sprachen so schnell und verschluckten so viel, daß er nie verstehen konnte, was sie sagten!
»Und ich kann nicht begreifen,« sagte Mrs. Septimus, »wie du das machst. Ich hätte das nie gewagt!«
Francie lächelte leise. »Ich habe viel lieber mit einem Manne zu tun als mit einer Frau. Frauen sind so streng!«
»Mein Kind,« rief Mrs. Small, »wir sind es sicher nicht.«
Euphemia brach in ihr leises Lachen aus, das mit Quietschen endete, und sagte, als würgte sie jemand: »Ich sterbe noch vor Lachen, Tantchen.«
Swithin sah keine Veranlassung zum Lachen; er verabscheute Leute, die lachten, wenn er selbst keinen Scherz merkte. Übrigens verabscheute er Euphemia überhaupt und erwähnte sie nur als »Ricks Tochter, wie heißt sie doch, die Blasse?« Er wäre beinahe ihr Pathe geworden – ganz sicher, wenn er nicht energisch gegen diesen ausländischen Namen aufgetreten wäre. Er haßte es Pathe zu stehen. Jetzt sagte Swithin voll Würde zu Francie: »Schönes Wetter – hm – für diese Jahreszeit.« Aber Euphemia, die wohl wußte, daß er sich geweigert hatte ihr Pathe zu werden, wandte sich zu Tante Hester und fing an ihr zu erzählen, wie sie Irene, Soames' Frau, im Kaufhaus gesehen.
»Und Soames war mit ihr?« fragte Tante Hester, denn Mrs. Small hatte noch keine Gelegenheit gefunden ihr den Vorfall zu erzählen.
»Soames mit ihr? Natürlich nicht!«
»Aber war sie ganz allein in der Stadt?«
»O nein! Mr. Bosinney war mit ihr. Sie war wundervoll angezogen.«
Aber als Swithin den Namen Irenens hörte, blickte er Euphemia streng an, die allerdings nie gut in einem Kleide aussah, was sie auch tragen mochte, und sagte:
»Wie eine vornehme Dame sicher. Es ist ein Vergnügen sie zu sehen.«
In diesem Augenblick wurden James und seine Töchter gemeldet. Dartie, der sich nach einem Trunk sehnte, hatte eine Verabredung beim Zahnarzt vorgeschützt, sich, nachdem er am Marble Arch abgesetzt worden, eine Droschke genommen, und saß jetzt bereits in der Fenstertür seines Klubs in Piccadilly.
Seine Frau, erzählte er seinen Freunden, hatte einige Besuche mit ihm machen wollen. Das wäre aber nicht sein Fall – ganz und gar nicht!
Er rief nach dem Kellner und schickte ihn hinaus um nachzusehen, wer das 4.30 Rennen gewonnen hatte. Er sei hundemüde, sagte er, und das war Tatsache, denn er war mit seiner Frau den ganzen Nachmittag von einer ›Schau‹ zur andern herumgefahren. Schließlich hätte er sich aus dem Staube gemacht. Ein Mann müsse doch auch sein eigenes Leben leben.
In diesem Augenblick sah er durch die Glastür – er liebte diesen Platz, wo er jeden Vorübergehenden sehen konnte – und erblickte unglücklicherweise oder vielleicht glücklicherweise Soames, der mit der offenbaren Absicht hereinzukommen, von der Parkseite her langsam die Straße kreuzte, denn er gehörte auch zu dem ›Iseeum‹.
Dartie sprang auf, ergriff sein Glas, stammelte etwas über ›das Rennen‹ und zog sich schnell ins Spielzimmer zurück, wohin Soames niemals kam. Hier lebte er in vollkommener Einsamkeit, bei trübem Licht sein eigenes Leben bis halb acht, zu welcher Zeit Soames, wie er wußte, den Klub sicher verlassen haben mußte.
Es war nicht ratsam, so wiederholte er sich jedesmal, wenn der Drang an den Unterhaltungen in der Fenstertür teilzunehmen zu stark in ihm wurde – es war absolut nicht ratsam, mit so geringen Einkünften wie er sie hatte, und wo der ›Alte‹ (James) seit der Geschichte mit den Öl-Aktien, an der er gar keine Schuld hatte, noch immer so muffig war, einen Streit mit Winifred zu riskieren.
Wenn Soames ihn im Klub sah, würde sie sicher erfahren, daß er gar nicht beim Zahnarzt gewesen war. Er kannte keine einzige Familie, in der alles immer so ›herum kam‹. Mit einem mürrischen Blick in dem olivenfarbenen Gesicht, die Beine in den karierten Hosen gekreuzt, mit Lackschuhen, die in der Dämmerung blinkten, saß er ungemütlich zwischen den grünen Billardtischen, kaute an seinem Zeigefinger und überlegte, wo zum Teufel er das Geld hernehmen sollte, wenn Erotic den Lancaster Cup nicht gewann.
Seine Gedanken wandten sich mißmutig den Forsytes zu. Was das für eine Gesellschaft war! Nichts war aus ihnen herauszubekommen, wenigstens machte es die größten Schwierigkeiten. Sie waren so verd–t genau in Geldangelegenheiten; nicht ein Sportsmann in der ganzen Sippe, wenn nicht George gewesen wäre. Dieser Soames zum Beispiel, bekäme einen Ohnmachtsanfall, wenn man einen Zehner von ihm borgen wollte, oder wenn nicht das, so sähe er einen mit dem verwünschten überlegenen Lächeln an, als wäre man eine verlorene Seele, weil man Geld brauchte.
Und seine Frau (Dartie wässerte unwillkürlich der Mund), mit der er versucht hatte auf gutem Fuß zu stehen, wie man es mit einer hübschen Schwägerin natürlich gern wollte, ob diese – (er gebrauchte wirklich ein grobes Wort) – wohl einen Blick für ihn hatte – sie sah ihn ja an, als wäre er Auswurf – und doch konnte sie es weit genug treiben, darauf wollte er eine Wette eingehen. Er kannte die Frauen; sie waren nicht umsonst mit so sanften Augen und solchen Figuren geschaffen, dahinter würde dieser Soames wohl bald genug kommen, wenn irgend etwas daran war, was er über den guten ›Bukanier‹ gehört hatte.
Dartie erhob sich von seinem Stuhl, machte einen Gang durchs Zimmer, und hielt vor dem Spiegel über dem Kaminsims an, wo er lange in Betrachtung seines Gesichts versunken stehen blieb. Mit dem gewichsten dunklen Schnurrbart und dem kleinen vornehmen Ansatz von Backenbart hatte es das für manche Gesichter eigentümliche Aussehen, als wäre es in Leinöl getaucht; und beunruhigt fühlte er das Entstehen eines Pickels an der Seite der leicht gebogenen fettigen Nase.
Inzwischen hatte der alte Jolyon den übrig gebliebenen Stuhl in Timothys behaglichem Wohnzimmer entdeckt. Seine Ankunft hatte die Unterhaltung offenbar unterbrochen, und es war ein verlegenes Schweigen eingetreten. In ihrer wohlbekannten Gutherzigkeit beeilte sich Tante Juley die Gemütlichkeit wiederherzustellen.
»Ja, Jolyon,« begann sie, »wir sprachen eben davon, daß du lange Zeit nicht hier gewesen bist; aber es darf uns nicht überraschen. Du bist natürlich sehr beschäftigt? James sagte gerade, wie viel es jetzt zu tun gibt –«
»Sagte er das?« erwiderte der alte Jolyon und blickte James fest an. »Es gäbe nicht halb so viel zu tun, wenn jeder sich nur um seine eigenen Angelegenheiten kümmerte.«
James, der nachdenklich in einem kleinen Sessel saß, von dem seine Kniee in die Höhe ragten, schob unruhig die Füße vor und trat dabei mit dem einen auf die Katze, die unbesonnen vor dem alten Jolyon neben ihm Zuflucht gesucht hatte.
»Ihr habt ja hier eine Katze,« sagte er gekränkt und zog den Fuß ungeduldig zurück, als er ihn auf dem weichen pelzigen Körper fühlte.
»Mehrere,« sagte der alte Jolyon und blickte von einem zum andern. »Ich trat eben auf eine.«
Es schwiegen alle.
Dann fragte Mrs. Small, indem sie die Finger in einander flocht und mit feierlicher Ruhe um sich blickte: »Und wie geht's der lieben June?«
Ein leiser Humor blitzte in den ernsten Augen des alten Jolyon auf. Eine merkwürdige alte Frau, diese Juley! Sie ist einzig darin, immer das Verkehrte zu sagen!
»Schlecht!« sagte er; »London bekommt ihr nicht – zu viele Leute, viel zu viel Geschwätz und Geklatsche überall.« Er legte Nachdruck auf die Worte und sah wieder James gerade ins Gesicht.
Niemand sprach.
Sie hatten alle ein Gefühl, daß es zu gefährlich sei, nach irgend einer Richtung hin einen Schritt zu unternehmen oder eine Bemerkung zu wagen. Etwas von der Vorahnung des drohenden Verhängnisses, wie sie den Zuschauer einer griechischen Tragödie überkommt, hatte sich diesem reichmöblierten Zimmer mit den weißhaarigen alten Männern in Schoßröcken und vornehm gekleideten Frauen mitgeteilt, die alle von dem selben Blut waren, unter all denen eine ungreifbare Ähnlichkeit bestand.
Nicht daß sie sich dessen bewußt gewesen wären, denn die Anwesenheit so verhängnisvoller böser Geister kann nur empfunden werden.
Jetzt erhob Swithin sich. Er wollte hier nicht sitzen mit diesem Gefühl – er ließ sich von keinem einschüchtern! Noch würdevoller als sonst manövrierte er durchs Zimmer und schüttelte jedem einzeln die Hand.
»Bestelle Timothy von mir,« sagte er, »daß er sich zu sehr verweichlicht!« Dann wandte er sich zu Francis, die er ›fesch‹ fand, und fügte hinzu: »Du mußt an einem dieser Tage eine Spazierfahrt mit mir machen.« Aber das beschwor die Vision jener andern denkwürdigen Fahrt herauf, über die so viel gesprochen worden war, und er stand einen Augenblick ganz still, mit glasigen Augen, wie in Erwartung auch die Bedeutung dessen zu erhaschen, was er selbst darüber gesagt; doch plötzlich überlegte er, daß ihm all das ganz einerlei sei und sagte zum alten Jolyon: »Na, adieu, Jolyon! Du solltest nicht ohne Überzieher herumgehen, du wirst dir noch Ischias oder sonst was holen!« Dann gab er der Katze mit der Spitze seiner Lackstiefel einen leisen Stoß, und seine ungeheure Gestalt entfernte sich.
Als er gegangen war, blickte einer verstohlen den andern an um zu sehen, wie er das Wort ›Spazierfahrt‹ aufgenommen hatte, dieses Wort, das als einzige – so zu sagen offizielle – Nachricht in Bezug auf das vage dunkle Gerücht, das die Zungen der Familie in Bewegung setzte, jetzt berüchtigt war und eine überwältigende Bedeutung bekommen hatte.
Einem Impuls gehorchend, sagte Euphemia mit kurzem Lachen: »Ich bin froh, daß Onkel Swithin mich nicht zu Spazierfahrten auffordert.«
Um wieder einzulenken und über kleine Verlegenheiten hinwegzuhelfen, die dieser Gegenstand vielleicht herbeiführen könnte, erwiderte Mrs. Small: »Er nimmt jeden gern mit, meine Liebe, der gut angezogen ist und mit dem er ein wenig Ehre einlegen kann. Ich werde nie die Fahrt vergessen, zu der er mich mitnahm. Das war ein Erlebnis!« Und über ihr pausbäckig rundes Gesicht breitete sich für einen Augenblick eine seltene Zufriedenheit, doch gleich ließ sie wieder den Kopf hängen und Tränen traten ihr in die Augen. Sie gedachte einer langen Spazierfahrt, die sie einst mit Septimus Small unternommen.
James, der in seinem kleinen Sessel wieder in unruhiges Grübeln versunken war, erwachte plötzlich daraus: »Ein komischer Kerl, dieser Swithin,« sagte er, aber es kam ihm nicht ganz aus dem Herzen.
Das Schweigen des alten Jolyon und sein strenger Blick hielt sie alle in einer Art von Lähmung. Die Wirkung seiner Worte hatte ihn selbst betroffen gemacht, sie schien die Bedeutung des Gerüchts, das er hatte unterdrücken wollen, noch zu verstärken; aber er war immer noch ärgerlich.
Er war noch nicht fertig mit ihnen – Nein, nein – sie sollten noch etwas zu hören bekommen!
Seine Nichten wollte er nicht schelten, er hatte ja keinen Streit mit ihnen – ein junges, präsentables weibliches Wesen war der Huld des alten Jolyon immer sicher – aber dieser James, und in geringerem Maße vielleicht all die andern verdienten, was ihnen zugedacht war. Auch er fragte nach Timothy.
Wie in dem Gefühl, daß ihrem jüngeren Bruder eine Gefahr drohe, bot Tante Juley ihm plötzlich Tee an: »Er ist ganz kalt und schlecht geworden,« sagte sie, »da er hinten im Wohnzimmer so lange steht und auf dich wartet, aber das Mädchen wird gleich frischen für dich machen.«
Der alte Jolyon stand auf: »Danke,« sagte er und blickte streng zu James hin, »aber ich habe keine Zeit für Tee und – Skandal und all das Übrige! Es ist Zeit für mich nach Haus zu kommen. Adieu, Julia, adieu Hester, adieu Winifred.«
Ohne weitere Abschiedsförmlichkeiten ging er hinaus.
Als er wieder in seiner Droschke saß, verdampfte sein Ärger schnell, denn so ging es immer wenn er zornig war – hatte er sich erst Luft gemacht, so war es vorbei. Traurigkeit überkam ihn jetzt. Er hatte ihnen zwar den Mund gestopft, doch um welchen Preis! Um den Preis der Gewißheit, daß dieses Gerücht, dem er keinen Glauben hatte schenken wollen, wirklich ein wahres war. June war verlassen, und wegen der Frau von jenes Mannes Sohn! Er fühlte, daß sie recht hatten und zwang sich zu tun, als wäre es nicht so; aber der Schmerz der sich hinter diesem Vorsatz verbarg, begann langsam und sicher in blinden Groll gegen James und seinen Sohn umzuschlagen.
Die in dem kleinen Wohnzimmer zurückgebliebenen sechs Damen und der eine Mann kamen in so ungezwungene Unterhaltung, wie es nach solch einer Begebenheit nur möglich war, denn obgleich jeder einzige von ihnen überzeugt war, niemals zu klatschen, wußte doch jeder genau, daß die andern sechs es taten; darum waren alle ärgerlich und verlegen. Nur James schwieg, bis ins Innerste seiner Seele verstört.
Plötzlich sagte Francie: »Weißt du, ich finde, Onkel Jolyon hat sich in diesem letzten Jahr sehr verändert. Meinst du nicht auch, Tante Hester?«
Tante Hester machte eine kleine Bewegung der Abwehr: »Oh, frage Tante Julia!« sagte sie. »Ich weiß nichts darüber.«
Keiner von den andern hatte Furcht zuzustimmen, und James murmelte verdrießlich: »Er ist nicht halb das, was er war.«
»Ich habe es längst bemerkt,« fuhr Francie fort, »er hat furchtbar gealtert.«
Tante Juley schüttelte den Kopf, ihr Gesicht war plötzlich wieder ungeheure Trübsal.
»Der arme gute Jolyon,« sagte sie, »es müßte jemand auf ihn acht geben!«
Wieder herrschte Schweigen, und dann, wie in der Furcht einzeln zurückgelassen zu werden, standen alle fünf Besucher gleichzeitig auf und verabschiedeten sich.
Mrs. Small, Tante Hester und ihre Katze blieben wieder allein, das Schließen einer Tür in der Ferne kündigte Timothys Kommen an.
Als Tante Hester an diesem Abend in dem hinteren Schlafzimmer, das früher Tante Juleys gewesen, bevor Tante Juley das von Tante Ann bekommen hatte, eben eingeschlafen war, öffnete sich ihre Tür, und Mrs. Small in einer rosenroten Nachtmütze trat mit einer Kerze in der Hand herein.
»Hester!« rief sie, »Hester!«
Tante Hesters Betttücher raschelten leise.
»Hester,« wiederholte Tante Juley, um ganz sicher zu sein, daß sie wach war. »Ich bin sehr besorgt um den armen alten Jolyon. Was,« Tante Juley betonte das Wort, »meinst du, könnte man tun?«
Tante Hesters Betttücher raschelten wieder und man hörte ihre Stimme leise abwehrend: »Tun? Wie soll ich das wissen?«
Tante Juley ging beruhigt wieder hinaus und schloß in der Furcht, Tante Hester zu stören, die Tür mit ganz besonderer Vorsicht, um sie nicht aus den Fingern gleiten und mit einem ›Krach‹ zufallen zu lassen.
Hinten in ihrem eigenen Schlafzimmer stellte sie sich ans Fenster und schaute durch eine Spalte der Muslinvorhänge, die fest zugezogen waren, damit niemand es sehen könne, auf den Mond über den Bäumen des Parks. Und in ihrer rosenroten Nachtmütze über dem runden trübseligen Gesicht, dachte sie mit nassen Augen an den ›lieben Jolyon‹, der so alt und einsam war, wie sie ihm helfen könnte und wie er sie lieben lernen würde, sie lieben wie keiner es getan seit – seit der arme Septimus dahingegangen war.
1. Baronet.