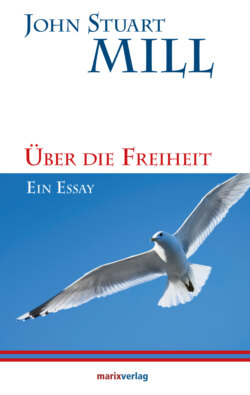Читать книгу Über die Freiheit - John Stuart Mill - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ERSTES KAPITEL Einleitung
ОглавлениеDer Gegenstand dieses Essays ist nicht die sogenannte Freiheit des Willens, welche so unpassend der irrig benannten Lehre von der philosophischen Notwendigkeit gegenüber gestellt wird, sondern die bürgerliche oder soziale Freiheit: die Natur und Grenzen der Macht, welche berechtigterweise von der Gesellschaft auf das Einzelwesen ausgeübt wird. Es ist dies eine Frage, die nur selten aufgeworfen und im Allgemeinen kaum erörtert wurde, die aber die praktischen Kontroversen der Zeit durch ihre verborgene Anwesenheit stark beeinflusst hat und sich für die Zukunft gleichsam als Lebensfrage zu erkennen gibt. Sie ist insofern nicht neu, als sie, in einem gewissen Sinne, die Menschheit seit den frühesten Tagen in Parteien gespalten hat; aber in dem Zustand des Fortschritts, in welchem sich die zivilisierteren Teile der Menschheit nun befinden, äußert sie sich unter neuen Bedingungen und heischt eine unterschiedliche und gründlichere Behandlung.
Der Kampf zwischen Freiheit und Autorität ist der auffälligste Zug in denjenigen Teilen der Geschichte, mit welchen wir am frühesten vertraut sind, besonders in denen von Griechenland, Rom und England. Aber in alter Zeit bestand diese Gegnerschaft zwischen Untertanen oder einigen Klassen von Untertanen und der Regierung. Freiheit bedeutete Schutz gegen die Tyrannei der politischen Herrscher. Die Herrscher wurden (ausgenommen bei einigen der volkstümlichen Regierungen Griechenlands) als notwendigerweise gegnerisch dem von ihnen beherrschten Volke betrachtet. Sie waren Einzelherrscher oder ein herrschender Stamm, eine herrschende Kaste, die ihre Autorität von Erblichkeit oder Eroberung ableiteten, sie unter allen Umständen nicht zum Vergnügen der Beherrschten gegeben erachteten, und deren Übergewicht man nicht anzutasten wagte, vielleicht auch nicht wollte, welche Vorsichtsmaßregeln auch immer gegen ihre bedrückende Ausübung getroffen werden mochten. Ihre Macht galt als nötig, aber auch als höchst gefährlich, als eine Waffe, die sie geneigt sein könnten gegen ihre Untertanen nicht minder zu – gebrauchen als gegen äußere Feinde. Um die schwächeren Mitglieder der Gemeinschaft davor zu schützen, dass sie nicht die Beute zahlreicher Geier werden, war es nötig, dass ein Raubtier vorhanden sei, das stärker als die andern ist, berechtigt, diese niederzuhalten. Da aber der König der Raubvögel nicht minder als einer der Geringeren geneigt sein mochte, beutegierig auf die Herde zu stoßen, so war es unerlässlich, gegen seinen Schnabel und feine Krallen in stetem Verteidigungszustand zu sein. Das Ziel der Patrioten war daher Schranken zu setzen der Macht, welche der Herrscher über die Gemeinschaft ausübte, und diese Einschränkung war es, was sie unter Freiheit verstanden. Sie wurde auf zweierlei Wegen versucht. Erstens, indem die Anerkennung gewisser unverletzlicher Bestimmungen herbeigeführt wurde, die politische Freiheiten oder Rechte genannt wurden, deren Missachtung als Pflichtbruch des Herrschers betrachtet wurde, so dass in diesem Falle ein besonderer Widerstand oder eine allgemeine Rebellion für gerechtfertigt galt. Ein zweites, allgemein späteres Mittel war die Herstellung konstitutioneller Schranken, wodurch die Zustimmung der Gemeinschaft oder irgendeiner Körperschaft, von der angenommen wurde, dass sie die allgemeinen Interessen vertrete, als notwendige Bedingung für einige der wichtigeren Handlungen der regierenden Macht festgesetzt wurde. Jener ersten Art und Weise der Einschränkung mussten sich die Herrscher der meisten europäischen Länder mehr oder minder unterwerfen. Anders war es mit der zweiten, und diese herzustellen oder sie zu vervollständigen, wo sie bereits einigermaßen vorhanden war, wurde überall der Hauptgegenstand der Freiheitsfreunde. Und solange die Menschheit damit zufrieden war, einen Feind mit dem andern zu bekämpfen und von einem Herrn regiert zu werden, unter der Bedingung, gegen seine Tyrannei mehr oder minder geschützt zu sein, ging sie mit ihren Bestrebungen über dieses Ziel nicht hinaus.
Im Laufe des menschlichen Fortschrittes kam jedoch eine Zeit, wo die Menschen es nicht mehr für eine Naturnotwendigkeit hielten, dass ihre Herrscher eine unabhängige Macht seien, deren Interessen den ihrigen entgegenständen Es dünkte sie viel besser, dass die verschiedenen Staatsbehörden ihre Bevollmächtigten oder Abgeordneten seien, die beliebig abberufen werden könnten. Derart schien ihnen eine vollkommene Sicherheit gegeben, dass die Herrschermacht nicht zu ihren Ungunsten je missbraucht werde. Allmählich wurde diese neue Forderung nach gewählten und zeitweiligen Herrschern der Hauptgegenstand der Volkspartei, wo eine solche vorhanden war, und ersetzte in beträchtlicher Ausdehnung die früheren Bemühungen die Herrschermacht einzuschränken. Als nun der Kampf um die Abhängigkeit der Herrschermacht von der periodischen Wahl der Beherrschten sich kräftiger äußerte, neigten sich manche der Meinung zu, man habe der Beschränkung dieser Macht selbst zu viel Bedeutung beigelegt. Jene war (mochte es scheinen) ein Hilfsmittel gegen Herrscher, deren Interessen regelmäßig denen des Volkes entgegenstanden. Was jetzt nötig schien, das war, dass die Herrscher mit dem Volk Eins seien, dass ihr Interesse und Wille denen des Volkes gleichkämen. Das Volk brauchte gegen seinen eigenen Willen nicht beschützt zu werden. Es war nicht zu befürchten, dass es sich selbst tyrannisieren werde. Lasst die Herrscher dem Volke tatsächlich verantwortlich sein, lasst ihm die Möglichkeit, sie rasch zu entfernen, und es kann sie mit einer Macht ausrüsten, deren Gebrauch es ja selbst vorzuschreiben vermag. Die Macht der Herrscher ist dann nur die angesammelte und für die Ausübung in geeignete Form gebrachte Macht des Volkes selbst. Diese Weise zu denken – oder vielleicht zu fühlen – war unter der letzten Generation des europäischen Liberalismus allgemein und scheint auf dem europäischen Festlande noch vorzuherrschen. Diejenigen, die eine Beschränkung dessen, was die Regierung tun darf, zugeben – ausgenommen solcher Regierungen, die ihres Erachtens nicht bestehen sollten –, stehen als glänzende Ausnahmen unter den politischen Denkern des Kontinents. Eine ähnliche Empfindungsweise würde jetzt auch in England vorwiegen, wenn die Umstände unverändert geblieben wären, die eine Zeitlang dafür sprachen.
In politischen und philosophischen Theorien aber, wie auch bei einzelnen Personen, deckt der Erfolg Fehler und Schwächen auf, die bei einem Misserfolg der Beobachtung wohl verborgen geblieben wären. Die Meinung, dass das Volk nicht nötig habe, die Macht einzuschränken, die es über sich selbst ausübt, konnte als feststehend gelten, solange Volksherrschaft nur ein Traumgebilde war oder solange man nur von ihr las, sie habe in irgendeiner weit zurückliegenden Vergangenheit bestanden. Diese Ansicht wurde nicht notwendigerweise gestört durch zeitweilige Abweichungen, wie die Französische Revolution, deren Ärgstes das Werk einer usurpierenden Kleinzahl war und zumeist nicht aus der anhaltenden Wirksamkeit volkstümlicher Einrichtungen hervorgegangen ist, sondern ein plötzlicher und krampfhafter Ausbruch gegen monarchischen und aristokratischen Despotismus war. Indessen hat sich aber eine demokratische Republik über einen großen Teil der Erdoberfläche ausgebreitet und macht sich als eines der mächtigsten Mitglieder der Völkergemeinschaft fühlbar. Wählbare und verantwortliche Regierung wurde damit zum Gegenstand von Beobachtungen und Beurteilungen, wie sie bei jeder großen bestehenden Tatsache in Erscheinung treten. Es wurde nun bemerkt, dass Phrasen, wie »Selbstregierung« und »Macht des Volkes über sich selbst«, den richtigen Sachverhalt nicht ausdrücken. Das »Volk«, welches die Macht ausübt, ist nicht stets dasselbe Volk mit denen, über die diese Macht ausgeübt wird; und die sogenannte »Selbstregierung« ist nicht die Regierung des einzelnen durch sich selbst, sondern die Regierung jedermanns durch alle andern. Der Volkswille bedeutet überdies tatsächlich nur den Willen des zahlreichsten oder rührigsten Teiles des Volkes, der Mehrheit oder derjenigen, denen es gelingt, sich als Mehrheit geltend zu machen. Das Volk kann folglich die Unterdrückung eines Teils seiner Gesamtheit beabsichtigen. Vorsichtsmaßregeln sind daher sowohl gegen diesen wie gegen jeden andern Missbrauch der Macht geboten. Die Einschränkung der Regierungsmacht über die Einzelwesen verliert demnach nichts von ihrer Wichtigkeit, wenn die Machthaber der Gemeinschaft, das heißt deren stärkste Partei, regelmäßig verantwortlich ist. Diese Anschauungsweise, welche sich ebenso der Einsicht der Denker wie der Neigung derjenigen einflussreichen Klassen der europäischen Gesellschaft empfiehlt, deren wirkliche oder vermeintliche Interessen der Demokratie entgegen sind, hat sich ohne Schwierigkeiten festgesetzt; und die »Tyrannei der Mehrheit« gehört nun in der Politik allgemein zu denjenigen Übeln, gegen welche die Gesellschaft auf ihrer Hut sein muss.
Gleich andern Tyranneien wurde anfangs und wird gemeinhin noch die Tyrannei der Mehrheit hauptsächlich darum gefürchtet, weil sie durch die Handlungen der Staatsgewalt wirkt. Denkende Personen bemerkten jedoch, dass, wenn die Gesellschaft selbst ein Tyrann ist – die Gesellschaft als Ganzes über die besonderen Einzelwesen, welche sie bilden – die Mittel der Tyrannei nicht auf Handlungen beschränkt sind, welche sie durch ihre politischen Funktionäre ausführen kann. Die Gesellschaft kann ihre Befehle vollziehen und vollzieht sie auch; und wenn sie unrechte statt rechte Befehle erlässt oder überhaupt Befehle in Angelegenheiten, in die sie sich nicht mischen sollte, so übt sie eine gesellschaftliche Tyrannei aus, härter als irgendeine politische Bedrückung, indem sie, obgleich sie gewöhnlich nicht so strenge Strafen anwendet, dennoch weniger Auswege übrig lässt, viel tiefer in die Einzelheiten des Lebens eindringt und die Seele selbst versklavt. Schutz gegen die Tyrannei der Behörde ist daher nicht genug; es braucht auch Schutz gegen die Tyrannei der vorherrschenden Meinungen und Gefühle; gegen die Neigung der Gesellschaft, ihre eigenen Ideen und Handlungen als Lebensregeln allen, die hiervon abweichen, durch andere Mittel als bürgerliche Strafen aufzunötigen, zu verhindern die Entwicklung und wenn möglich sogar die Bildung irgendeiner Individualität, die nicht mit ihrem Tun und Lassen übereinstimmt, und alle Charaktere zu zwingen, sich nach ihrem eigenen Muster zu bilden. Es gibt eine Grenze, welche die Einmischung der Gesamtmeinung in die persönliche Unabhängigkeit berechtigterweise nicht überschreiten darf, und diese Grenze zu finden, sie gegen Angriffe zu schützen, ist für den gesunden Zustand der menschlichen Angelegenheiten ebenso unerlässlich wie der Schutz gegen politischen Despotismus. Obgleich nun aber diese Behauptung im Allgemeinen nicht leicht bestritten werden kann, so ist doch die praktische Frage, wo diese Grenze zu ziehen sei – wie persönliche Unabhängigkeit und gesellschaftliche Aussicht geeignet abzusondern wären – eine Sache, für die nahezu noch alles zu tun übrig bleibt. Alles, was irgendwen das Leben wertvoll macht, hängt von der Einschränkung der Betätigungen anderer Leute ab. Gewisse Lebensregeln müssen daher festgestellt werden, vor allem durch das Gesetz, und in manchen Dingen, die für ein gesetzliches Einschreiten nicht geeignet sind, durch die öffentliche Meinung. Was diese Regeln bestimmen sollen, ist die Hauptfrage für die menschlichen Angelegenheiten, eine Frage, die, wenn wir einige wenige der auffälligsten Fälle ausnehmen, am wenigsten ihrer Entscheidung näher gerückt ist. Nicht zwei Zeitalter und kaum zwei Länder sind hier gleicher Ansicht gewesen; und die Entscheidung des einen Zeitalters oder Landes dünkt den andern ganz verwunderlich. Dennoch fand das Volk irgendeines Zeitalters oder Landes nicht mehr Schwierigkeiten dabei, als wenn es einen Gegenstand beträfe, worüber die Menschheit stets übereingestimmt hätte. Regeln, die man selbst aufstellt, hält man für selbstverständlich und von selber gerechtfertigt. Diese fast allgemeine Illusion ist eines der Beispiele von der zauberischen Macht der Gewohnheit, die nicht nur, wie das Sprichwort sagt, zweite Natur ist, sondern auch fortwährend mit der ersten verwechselt wird. Die Wirkung der Gewohnheit, jede Außerachtlassung der Lebensregeln, welche die Gesellschaft sich selbst gegenseitig aufstellt, zu unterdrücken, ist hier um so vollständiger, weil der Gegenstand zu denjenigen gehört, bei welchen man es im Allgemeinen nicht für nötig hält, sich selbst oder andern dafür Gründe anzugeben. Die Leute sind gewohnt zu glauben und sind von manchen, die als Philosophen gelten wollen, in dem Glauben bestärkt worden, dass bei derartigen Dingen Gefühle mehr gelten als Vernunftgründe und diese sogar überflüssig machen. Der praktische Grundsatz, der sie bei ihren Ansichten über die Regelung der menschlichen Handlungsweise leitet, ist, dass jeder so handeln möge wie er und diejenigen, die mit ihm übereinstimmen zu handeln, geneigt sind. Tatsächlich gibt zwar niemand zu, dass der Maßstab seines Urteils sein eigenes Belieben bilde, aber eine Meinung über eine Handlungsweise, die nicht von Vernunftgründen unterstützt wird, kann nur als persönliche Vorliebe zählen; und wenn dafür als Grund auf die ähnliche Vorliebe anderer Leute hingewiesen wird, so ist das dann nur mehrerer Leute Vorliebe, statt die eines einzelnen. Dem gewöhnlichen Menschen ist nun seine dermaßen unterstützte Vorliebe nicht nur ein vollkommen ausreichender Grund, sondern auch der einzige, den er gewöhnlich für seine Meinungen über Moral, Geschmack, Gebührlichkeit hat, sofern diese nicht in seinem religiösen Bekenntnis ausdrücklich vorgeschrieben sind; sie sind selbst sein Leitfaden für die Auslegung dieser Vorschriften. Der Menschen Ansichten über das, was lobenswert oder tadelhaft ist, werden daher von all den verschiedenartigen Ursachen berührt, die ihre Wünsche·betreffs des Gehabens anderer beeinflussen, und die ebenso zahlreich sind wie die, welche ihre Wünsche hinsichtlich eines andern Gegenstandes bestimmen. Zuweilen ihre Vernunft – zuweilen wieder ihre Vorurteile und Aberglauben, oft ihre gesellschaftlichen Neigungen, nicht selten ihre ungesellschaftlichen, Neid oder Eifersucht, Anmaßung oder Hochmut; in den meisten Fällen aber ihre Wünsche und Befürchtungen für sich selbst, ihr berechtigtes oder unberechtigtes Eigeninteresse. Wo immer eine überragende Klasse vorhanden ist, wird sich ein großer Teil der Sittlichkeit des Landes nach deren Sonderinteressen und nach dem Bewusstsein ihrer Klassenüberlegenheit ausbilden. Die Moralität zwischen Spartanern und Heloten, zwischen Pflanzern und Negern, zwischen Fürsten und Untertanen, zwischen Edlen und Niedrigen, zwischen Mann und Weib ist größtenteils eine Schöpfung dieser Klasseninteressen und -gefühle; und die dermaßen erzeugten Empfindungen wirken dann wieder zurück auf die sittlichen Gefühle der Glieder der hervorragenden Klasse in ihren gegenseitigen Beziehungen. Wo anderseits wieder eine früher hervorragende Klasse ihren Vorzug eingebüßt hat oder wo dieser Vorzug nicht volkstümlich ist, trägt die vorherrschende sittliche Empfindung häufig das Zeichen einer ungeduldigen Abneigung gegen den Vorrang. Ein anderes großes entscheidendes Prinzip der Gesellschaftsregeln, sowohl im Tun wie im Unterlassen, aufgezwungen von Gesetz oder Meinung, ist die Unterwürfigkeit der Menschen gegen die Neigungen oder Abneigungen, welche sie bei ihren zeitlichen Gebietern oder bei ihren Göttern voraussetzen. Diese Unterwürfigkeit ist, wenn auch wesentlich selbstsüchtig, doch nicht heuchlerisch. Sie lässt vollkommen echte Empfindungen des Abscheus entstehen; sie ließ Zauberer und Ketzer verbrennen. Unter so vielen niedrigeren Einflüssen haben natürlich die allgemeinen und offenkundigen Interessen der Gesellschaft auf die Richtung der sittlichen Gefühle einen nicht geringen Einfluss, weniger jedoch aus Vernunftgründen und um ihrer selbst willen, denn als Folge der Sympathien und Antipathien, die hieraus erwachsen; und Sympathien und Antipathien, die mit den Interessen der Gesellschaft wenig oder gar nichts zu tun haben, haben sich mit ebenso großer Kraft bei der Feststellung der Sittengesetze fühlbar gemacht.
Die Neigungen und Abneigungen der Gesellschaft oder irgendeines mächtigen Teiles derselben, sind daher die Hauptsache, die praktisch die Regeln zur allgemeinen Beachtung gegeben hat, die unter Strafe des Gesetzes oder der öffentlichen Meinung stehen. Im Allgemeinen haben diejenigen, die im Denken und Fühlen der Gesellschaft voraus waren, diesen Zustand der Dinge im Prinzip unangefochten gelassen, wie sehr sie auch mit manchen der Einzelheiten in Konflikt gekommen sein mögen. Sie haben sich weit mehr mit der Untersuchung beschäftigt, welchen Dingen die Gesellschaft geneigt oder abgeneigt ist, als sich die Frage vorgelegt, ob diese Neigungen oder Abneigungen dem Einzelwesen zum Gesetz werden sollte. Sie zogen es lieber vor, bestrebt zu sein, die Gefühle der Menschheit in denjenigen Punkten abzuändern, in welchen sie selbstketzerisch dachten, als zur Verteidigung der Freiheit mit den Ketzern im Allgemeinen gemeinschaftliche Sache zu machen. Der einzige Fall, wo dieser höhere Standpunkt nicht nur von einzelnen grundsätzlich angenommen und beharrlich behauptet wurde, ist der des religiösen Glaubens: ein nach mehreren Richtungen hin lehrreicher Fall, der ein höchst treffendes Beispiel von der Fehlbarkeit dessen bildet, was sittliches Gefühl genannt wird. Das Odium theologicum eines aufrichtigen Glaubenseiferers ist eines der entschiedensten Fälle von Moralgefühl. Diejenigen, die zuerst das Joch der Kirche brachen, die sich selbst »universell« (katholisch) nennt, waren im Allgemeinen ebenso wenig wie diese Kirche selbst geneigt, eine Abweichung der religiösen Meinung zu gestatten. Als aber die Hitze des Kampfes vorüber war, ohne dass eine der Parteien einen vollständigen Sieg erfochten hätte und jede Kirche oder Sekte ihre Hoffnungen darauf beschränken musste, das bereits eingenommene Gebiet zu behaupten, fanden sich die Minderheiten genötigt, weil keine Aussicht vorhanden war, dass sie zu Mehrheiten werden könnten, diejenigen, die sie nicht bekehren konnten, um Duldung ihres abweichenden Glaubens zu ersuchen. Fast nur auf diesem Kampffelde allein sind daher die Rechte des Einzelwesens gegen die Gesellschaft auf der breiten Grundlage von Prinzipien vertreten worden und der Anspruch der Gesellschaft, eine Autorität über Abweichungen auszuüben, offen bestritten worden. Die großen Schriftsteller, denen die Welt alles, was sie an religiöser Freiheitbesitzt, verdankt, haben die Gewissensfreiheit als ein unantastbares Recht hingestellt und entschieden geleugnet, dass ein menschliches Wesen dem andern Rechenschaft über seine religiöse Überzeugung geben müsse. Allein so natürlich ist dem Menschen in allem, was ihn näher berührt, die Unduldsamkeit, dass die Glaubensfreiheit kaum irgendwo sich praktisch verwirklicht hat, ausgenommen dort, wo religiöse Gleichgültigkeit, die ihren Frieden nicht von theologischem Gezänke stören lassen wollte, ihr Gewicht in die Waagschale geworfen hat. Bei allen religiösen Leuten, selbst in den duldsamsten Ländern, wird die Pflicht der Toleranz im Inneren nur mit einem stillen Vorbehalt zugegeben. Der eine ist wohl geneigt, eine abweichende Meinung über die Kirchenleitung zu dulden, nicht aber über Dogmen; der andere kann alles ertragen, nur nicht einen Papisten oder einen Unitarier; ein dritter wieder ist jedem geneigt, der an die geoffenbarte Religion glaubt; einige wenige dehnen ihre Nächstenliebe noch weiter aus, aber nur soweit der Glaube an Gott und das Jenseits vorhanden ist. Wo immer das Gefühl der Mehrheit noch echt und tiefgehend ist, wird man diese Ansprüche an Gläubigkeit nur um weniges verringert finden.
In England ist, nach den eigentümlichen Verhältnissen der Staatsentwicklung, das Joch der öffentlichen Meinung vielleicht schwerer, das des Gesetzes jedoch leichter als in den meisten anderen Ländern Europas. Wir finden hier eine rege Eifersucht gegen jede direkte Einmischung der Gesetzgebung oder Verwaltung in das Privatleben; sie entstand nicht so sehr aus einer gerechten Würdigung der Unabhängigkeit des Individuums als aus der noch vorhandenen Gewohnheit, bei der Regierung stets ein der Gesamtheit entgegengesetztes Interesse anzunehmen. Die Mehrheit hat noch nicht gelernt, die Macht der Regierung als ihre eigene Macht oder deren Meinungen als ihre eigenen Meinungen zu empfinden. Geschieht dies einmal, so wird die individuelle Freiheit wahrscheinlich von der Regierung nicht minder einem Eingriff ausgesetzt sein, als sie es bereits seitens der öffentlichen Meinung ist. Bisher aber ist das Gefühl sehr verbreitet und rege, das jedem gesetzlichen Versuch, die Einzelwesen in Dingen zu beaufsichtigen, die bis jetzt einer Aufsicht entzogen waren, widerstrebt, und das mit sehr geringer Unterscheidung, ob die Sache innerhalb der berechtigten Sphäre einer gesetzlichen Aussicht liegt; dieses Gefühl, im Ganzen höchst heilsam, ist daher in einzelnen Fällen vielleicht ebenso oft schlecht wie gut angewandt. Ein anerkanntes Prinzip, wonach die Berechtigung oder Nichtberechtigung einer Einmischung der Regierung gewohnheitsmäßig beurteilt werden könnte, ist tatsächlich nicht vorhanden. Die Leute entscheiden nach ihrem persönlichen Gutdünken. Manche würden, wo immer etwas Gutes zu vollbringen oder etwas Böses zu verhindern wäre, gern die Regierung zur Ausführung dieser Maßregeln veranlassen, während andere wieder vorziehen, lieber jede Bürde sozialer Übel auf sich zu nehmen, ehe sie den menschlichen Angelegenheiten, die einer Regierungsaufsicht unterliegen, ein neues Gebiet zufügen. In jedem besonderen Falle stellen sich die Leute auf die eine oder auf die andere Seite, je nach der allgemeinen Richtung ihrer Empfindungen oder auch je nach dem Grad von Interesse an einer besonderen Sache, welche die Regierung vollbringen sollte, oder auch je nach der Meinung, dass die Regierung in ihrem Sinne verfahren werde oder nicht. Aber nur sehr selten geschieht es infolge einer gefesteten Ansicht über das, was von der Regierung auszuführen sei. Und mir will scheinen, dass man nun infolge dieses Mangels einer Regel oder eines Prinzips auf der einen Seite ebenso oft im Unrecht ist, wie auf der andern. Die Einmischung der Regierung wird ungefähr im gleichen Maße mit Unrecht angerufen, wie mit Unrecht verschmäht.
Der Gegenstand dieses Essays ist, einen sehr einfachen Grundsatz nachzuweisen, der die Betätigung von Einschränkung und Aufsicht der Gesellschaft über das Individuum unbedingt beherrschen sollte, mögen nun die angewandten Mittel physische Kraft in Form von gesetzlichen Strafen oder moralischer Zwang der öffentlichen Meinung sein. Dieser Grundsatz ist: dass das einzige Ziel, um dessentwillen die Menschheit, einzeln oder vereint, das Recht hat, sich in die Freiheit des Handelns eines der ihrigen zu mischen, der Selbstschutz ist; dass der einzige Zweck, um dessentwillen die Macht über irgendein Mitglied einer zivilisierten Gemeinschaft gegen seinen Willen berechtigterweise ausgeübt werden kann, der ist, dass die Benachteiligung eines andern verhindert werde. Sein eigenes physisches oder moralisches Wohl bietet keine ausreichende Rechtfertigung. Er kann nicht rechtlich gezwungen werden, etwas zu tun oder zu unterlassen, weil es besser für ihn wäre, weil es ihn glücklicher machte, weil er, nach der Meinung anderer, dadurch klüger oder selbst rechtlicher handeln würde. Dies sind wohl gute Gründe, um ihm Vorstellungen zu machen, ihn zu überreden, zu überzeugen oder zu ersuchen, aber keineswegs um ihn zu zwingen, oder wenn er anders handelt, mit irgendwelchem Übel heimzusuchen. Um dieses zu rechtfertigen, muss die Handlungsweise, von der man ihn abbringen will, derart sein, dass sie irgendeinem andern Schaden bringen könnte. Nur soweit eine Handlungsweise andere betrifft, ist der Mensch der Gesellschaft verantwortlich. Soweit sie ihn selbst betrifft, ist seine Unabhängigkeit rechtlich unbeschränkt. Über sich selbst, seinen Leib, seine Seele ist das Individuum unbeschränkter Herrscher.
Es ist vielleicht kaum nötig beizufügen, dass diese Lehre nur für menschliche Wesen mit ausgereiften Geisteskräften gilt. Wir reden nicht von Kindern oder von jungen Leuten, die noch nicht das Alter erreicht haben, welche das Gesetz für die Mündigkeit festgestellt hat. Wer noch in dem Zustand, dass andere für ihn sorgen müssen, sich befindet, muss gegen seine eigene Handlungsweise ebenso geschützt werden, wie gegen äußeren Unbill. Aus demselben Grunde können wir hier diejenigen zurückgebliebenen Gesellschaftszustände außer Acht lassen, wo das Volk noch als unmündig betrachtet werden kann. Die Anfangsschwierigkeiten auf dem Wege selbsttätigen Fortschritts sind so groß, dass nur selten eine Wahl über die Winkel, sie zu überwinden, übrig bleibt; und ein vom Geist der Verbesserung erfüllter Herrscher ist berechtigt, alle Mittel zum Ziele anzuwenden, das anderseits vielleicht nicht erreicht werden könnte. Der Despotismus ist rohen Völkern gegenüber die berechtigte Regierungsweise, vorausgesetzt, dass er die Verbesserung anstrebt und die Mittel den Zweck tatsächlich rechtfertigen. Als Prinzip hat die Freiheit dort nicht Anwendung zu finden, wo der Zustand der Dinge vor der Zeit liegt, wo die Menschen der Verbesserung durch freie und friedliche Erörterung fähig sind. Bis dahin ist nichts für sie geeignet als unbedingte Gehorsamkeit gegen einen Akbar oder Karl den Großen, wenn sie glücklich sind, einen zu finden. Sobald jedoch die Menschheit die Fähigkeit erreicht hat, durch Überzeugung oder Überredung ihrer eigenen Verbesserung zugeführt zu werden (eine Periode, die alle Völker, welche hier in Betracht kommen, schon längst erreicht haben), ist jeder Zwang, erfolge er unmittelbar oder in Form von Leiden und Strafen wegen Ungehorsamkeit, nicht länger als Mittel zu ihrem eigenen Besten zulässig und einzig nur zur Sicherheit anderer gerechtfertigt.
Es ist hier zu bemerken am Platze, dass ich von jedem Vorteil absehe, der für meine Beweisführung aus dem Begriff eines abstrakten, von der Nützlichkeit unabhängigen Rechts abgeleitet werden könnte. Ich betrachte die Nützlichkeit als den Schlussstein aller ethischen Fragen, aber es muss Nützlichkeit im weitesten Sinne sein, gegründet auf die dauernden Interessen eines Menschen als fortschreitendes Wesen. Diese Interessen, behaupte ich, rechtfertigen die Unterwerfung individuellen Eigenwillens der äußeren Aufsicht nur hinsichtlich solcher Handlungen des Einzelnen, welche das Interesse anderer Leute berühren. Begeht jemand eine für andere schädliche Tat, so ist von vornherein ein zu seiner Bestrafung geeigneter Fall gegeben, durch das Gesetz oder wo dieses sich nicht mit Sicherheit anwenden lässt, durch die allgemeine Missbilligung. Es gibt auch manche positive Handlungen zum Besten anderer, die berechtigterweise erzwungen werden können, so die Zeugenaussage vor Gericht, die gebührende Teilnahme an der allgemeinen Verteidigung oder an einem andern Werke, das für die Gesellschaft, deren Schutz man sich erfreut, nötig ist; ferner die Betätigung gewisser Akte der Privatwohltätigkeit, wie die Lebensrettung eines Mitmenschen oder die Verteidigung des Schutzlos en gegen Misshandlungen – Dinge, für deren Unterlassung der Mensch von der Gesellschaft mit Recht verantwortlich gemacht werden kann, wenn die Möglichkeit der Ausführung erkennbar ist. Man kann andern nicht nur durch seine Tat, sondern auch durch seine Unterlassung Übles verursachen und in beiden Fällen ist man rechtlich für die Schädigung verantwortlich. Der letztere Fall erfordert allerdings eine viel vorsichtigere Anwendung des Zwanges, als der erstere. Jemand für das Übel, das er andern zufügt, verantwortlich zu machen, ist die Regel; ihn dafür verantwortlich zu machen, dass er ein Übel nicht verhindert habe, ist, vergleichsweise gesprochen, die Ausnahme. Es gibt jedoch viele Fälle, die klar und gewichtig genug sind, um diese Ausnahme zu rechtfertigen. In allen Dingen, die die äußeren Beziehungen des Einzelwesens betreffen, ist es de jure denjenigen verantwortlich, deren Interessen hiervon berührt werden und nötigenfalls auch der Gesellschaft als deren Schützer. Oft sind gute Gründe vorhanden, ihm nicht die Verantwortung aufzuerlegen, aber diese Gründe müssen sich von der besonderen Zweckmäßigkeit des Falls ergeben: entweder weil es einen Fall betrifft, in welchem er wahrscheinlich im Ganzen genommen besser zu wirken vermag, wenn er seinem eigenen Wollen überlassen bleibt, als wenn er von der Gesellschaft in irgendeiner möglichen Weise beaufsichtigt wird; oder weil der Versuch einer Aufsicht andere Übel herbeiführen würde, größere als die, welche dadurch verhindert würden. Wenn solche Gründe den Zwang der Verantwortlichkeit ausschließen, dann sollte das Gewissen des Handelnden selbst den leeren Richterstuhl einnehmen und diejenigen Interessen anderer schützen, die keinen äußeren Schutz haben; es soll ihn selbst um so strenger beurteilen, als der Fall nicht geeignet ist, ihn vor dem Gericht seiner Mitgeschöpfe zur Verantwortung zu ziehen.
Es gibt jedoch ein Gebiet der Tätigkeit, für das die Gesellschaft, im Unterschied von dem Einzelnen, wenn überhaupt ein Interesse, nur ein indirektes hat. Dieses Gebiet umfasst alle Teile des persönlichen Lebens und Treibens, die nur ihn selbst berühren, oder wenn sie andere berühren, nur mit deren freien, wissentlichen und billigenden Zustimmung und Teilnahme. Wenn ich sage »nur ihn selbst«, so meine ich damit ihn direkt und in erster Linie; denn was immer ihn selbst berührt, kann auch durch ihn andere berühren, und die Einwände, die auf diese Möglichkeit gegründet werden können, sollen später in Betracht gezogen werden. Dies ist also das abgegrenzte Gebiet der menschlichen Freiheit. Es umfasst vor allem das Feld des inneren Bewusstseins, verlangt im ausgedehntesten Sinne Gewissensfreiheit, Freiheit des Denkens und Fühlens, unbedingte Freiheit der Meinung und Empfindung über alle Gegenstände, praktische oder spekulative, wissenschaftliche, sittliche oder theologische. Die Freiheit, seine Meinung auszudrücken und zu veröffentlichen, scheint wohl unter ein anderes Prinzip zu fallen, da sie demjenigen Teil der Handlungen des Individuums angehört, der andere Leute betrifft; da sie jedoch fast so wichtig ist, wie die Gedankenfreiheit selbst und großenteils auf denselben Gründen beruht, so ist sie praktisch nicht davon zu sondern. Zweitens erfordert das Prinzip Freiheit des Genusses und des Strebens; unsern Lebensplan nach unserm eigenen Charakter zu bilden, zu tun, wie es uns beliebt – welche Folgen es auch für uns habe – ohne von unserem Mitwesen verhindert zu werden, solange wir sie nicht schädigen, gleichviel, ob sie unser Tun für töricht, verkehrt und unrecht halten. Drittens, von dieser Freiheit jedes Einzelwesens folgt innerhalb derselben Grenzen die Vereinsfreiheit, die Freiheit, sich zu irgendeinem Zwecke, der andern nichts schadet, vereinen zu dürfen, wobei vorausgesetzt ist, dass die Vereinten mündig sind und weder durch Zwang noch durch Betrug dazu veranlasst wurden.
Keine Gesellschaft, in der diese Freiheiten im Ganzen und Großen nicht geachtet werden, ist frei, welche Form von Regierung sie auch haben möge, und keine ist vollkommen frei, in welchen sie nicht bedingungslos und unbeschränkt vorhanden sind. Die einzige Freiheit, die diesen Namen verdient, ist die, in der wir unser Bestes auf unsere eigene Weise erstreben können, solange wir dabei den andern ihr Bestes nicht zerstören oder sie in der Erlangung dessen verhindern. Jeder ist der eigene Hüter seines Wohles, möge dieses Leib, Geist oder Gemüt betreffen. Die Menschheit hat einen größeren Gewinn, wenn sie jeden nach seinem Gutdünken leben lässt, als wenn sie jeden zwingt, nach dem Gutdünken der andern zu leben.
Obgleich diese Lehre nichts weniger als neu ist und manchen als Gemeinplatz erscheinen mag, so gibt es doch keine Lehre, die der allgemeinen Neigung der vorhandenen Meinungen und Gewohnheiten entschiedener gegenüber stände. Die Gesellschaft hat in dem Versuche, (ihrer Erkenntnis gemäß) die Leute nach dem Begriff ihrer persönlichen wie ihrer gesellschaftlichen Vorzüglichkeit zu formen, gleichviel Bemühungen aufgewandt. Die alten Staatsgebildeten hielten sich für berechtigt, das Privatleben nach allen Richtungen hin zu regeln, weil der Staat ein starkes Interesse für die körperliche und geistige Erziehung jedes seiner Bürger habe, und die alten Philosophen stimmten diesem Grundsatz zu. Diese Denkweise mag vielleicht in kleinen, von mächtigen Feinden umringten Republiken zulässig gewesen sein, die in der·steten Gefahr schwebten, durch Angriffe von außen oder inneren Unruhen zu verderben, und denen selbst eine vorübergehende Abschwächung der Kräfte und der Selbstbestimmung leicht so verhängnisvoll werden konnte, dass man sich auf die heilsame nachhaltige Wirkung der Freiheit nicht verlassen konnte. In der neueren Welt hat die bedeutendere Größe der Staaten und vor allem die Trennung von geistiger und weltlicher Macht (wodurch die Leitung des menschlichen Gewissens in andere Hände gelegt wurde als in die, welche des Menschen weltliche Angelegenheiten beaufsichtigen) eine so große gesetzliche Einmischung in die Einzelheiten des Privatlebens verhindert. Aber die moralischen Zwangsmittel wurden hier noch entschiedener angewandt, mehr noch bei einer Abweichung von der herrschenden Meinung in eigenen als in sozialen Angelegenheiten. Die Religion, das mächtigste Element, das auf die Bildung des sittlichen Gefühls eingewirkt hat, wurde fast überall entweder von dem Ehrgeiz einer Hierarchie, die sich die Aufsicht über jeden Teil der Lebensführung anzueignen versuchte oder von dem Geist harter Sittenstrenge beherrscht. Einige von den neuzeitigen Reformern, die sich im entschiedensten Gegensatz zu den Religionen der Vergangenheit stellten, sind in ihren Ansprüchen auf das Recht einer geistigen Beherrschung keineswegs hinter den Kirchen oder Sekten zurückgeblieben. Dies gilt besonders von A. Comte, dessen in »Système de Politique Positive« entwickeltes Gesellschaftssystem die Herstellung (wenn auch mehr durch sittliche als durch gesetzliche Mittel) einer Zwangsherrschaft der Gesellschaft über das Einzelwesen erstrebt, welche das politische Ideal des strengsten Zuchtmeisters unter den alten Philosophen noch um vieles übertrifft.
Abgesehen von den besonderen Ansichten individueller Denker, ist aber in der Welt überhaupt eine wachsende Neigung vorhanden, die Macht der Gesellschaft über das Einzelwesen sowohl im Wege der öffentlichen Meinung wie auch durch die Gesetzgebung ungebührlich auszudehnen. Und da alle in der Welt vorgehenden Veränderungen die Neigung haben, die Gesellschaft zu stärken und die Macht des Einzelwesens zu verringern, so gehört dieses Übermaß keineswegs zu denjenigen Übeln, die leicht von selbst verschwinden, sondern es wächst im Gegenteil immer gefährlicher heran. Die Neigung der Menschen, ihre Meinungen und Absichten andern entweder als Herrscher oder als Mitbürger zur Lebensregel zu machen, wird von einigen der besten und einigen der schlechtesten Gefühle, die in der menschlichen Natur vorhanden sind, so kräftig unterstützt, dass sie durch kaum etwas anderes als durch Mangel an Macht niedergehalten werden kann. Und weil nun diese Macht nicht im Abnehmen, sondern im Zunehmen ist, so müssen wir erwarten, dass, falls nicht gegen dieses Missgeschick eine starke Schranke sittlicher Überzeugung errichtet wird, unter den gegebenen Umständen eine weitere Vermehrung eintreten werde.
Es wird der Beweisführung zu statten kommen, wenn wir uns, statt auf die These im Allgemeinen einzugehen, vor allem auf einen ihrer einzelnen Zweige beschränken, wobei das hier festgestellte Prinzip von der herrschenden Meinung, wenn auch nicht ganz, so doch bis zu einem gewissen Punkte anerkannt ist. Dieser Zweig ist die Gedankenfreiheit, von der sich die verwandte Freiheit der Rede und der Schrift unmöglich absondern lässt. Obgleich diese Freiheiten in einer ziemlich beträchtlichen Ausdehnung in allen Ländern mit religiöser Duldung und freien Institutionen einen Bestandteil der politischen Moral bilden, so sind doch sowohl die philosophischen wie auch die praktischen Grundlagen, auf denen sie ruhen, dem allgemeinen Bewusstsein vielleicht doch nicht so vertraut, und selbst von den Führern der öffentlichen Meinung nicht so vollauf gewürdigt, als zu erwarten sein dürfte. Richtig verstanden sind diese Grundlagen viel umfangreicher anwendbar als nur auf den vorliegenden Gegenstand, und eine gründliche Erörterung dieses Teils der Frage dürfte sich als die beste Einleitung für das Übrige erweisen. Dies dürfte daher hoffentlich mir zur Entschuldigung dienen, wenn nichts von dem, was ich nun sagen will, Neues bietet und wenn ich nun über einen Gegenstand, der seit drei Jahrhunderten so oft erörtert wurde, eine Erörterung mehr wage.