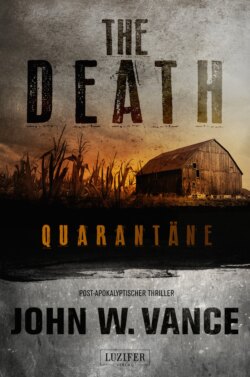Читать книгу QUARANTÄNE (The Death 1) - John W. Vance - Страница 7
ОглавлениеTag 183
2. April 2021
Decatur, Illinois
Egal wie oft er sich die zerknitterten Zeitungsschnipsel anschaute, die er mit ihren schmalen Rändern an die nackte Holzwand geklebt hatte, wollte er sich weiterhin einreden, alles sei ein Albtraum gewesen, aus dem er bald in seinem kleinen, aber gemütlichen Appartement neben Cassidy aufwachte.
Sein Blick huschte von einem Artikel zum nächsten, während er vergeblich nach einem Hinweis suchte – irgendetwas, das ihm eine Antwort auf den ganzen Wahnsinn geben konnte.
4. Oktober: Rätselhafte Krankheit bricht im Mittleren Westen aus.
5. Oktober: Krankheit verbreitet sich bis an beide Küsten.
6. Oktober: Gouverneure in mehreren Staaten rufen den Notstand aus.
8. Oktober: Krankheit wird zur Pandemie.
10. Oktober: Präsident ruft nationalen Notstand aus.
12. Oktober: Zahl der Opfer erreicht 35 Millionen.
13. Oktober: Ausschreitungen.
Beim Lesen kam er nicht umhin, sich von der roten Farbe ablenken zu lassen, mit der er »Gott steh uns allen bei« über die Ausschnitte gesprüht hatte.
Devin machte sich von diesem qualvollen Ritual los und fuhr mit seiner täglichen Routine fort. Dazu gehörte auch Tagebuchschreiben; es erwies sich als therapeutisch und verband ihn in gewisser Weise mit seiner Vergangenheit. Während die Feder seines Stifts über die dünnen Seiten des Spiralblocks jagte, wurde er von der Sonne geküsst, deren erste Strahlen auf ihn fielen. Er gönnte sich einen Augenblick, um durch die einzige Scheibe des Stalls zu schauen. Ein anderes Fenster zur Welt, außer dieser kleinen Öffnung, hatte er nicht mehr. Draußen bot sich ihm das gleiche Bild wie seit einem halben Jahr: Die unendlich weiten Felder, auf denen sorgfältig Mais angebaut worden und eingegangen war. Die hohen Pflanzen standen da wie Statuen. Sie hatten wie alles andere gelitten und ihr Leben gelassen, aber nicht wegen der Pandemie, sondern aufgrund von Vernachlässigung. Jetzt fungierten sie als Barriere zwischen Devins Unterschlupf in dem alten Stall und dem verseuchten Rest des Planeten.
Er erinnerte sich täglich an seine Reise von Indianapolis zum Haus seines Cousins in Decatur, Illinois. Jene Fahrt als Höllenritt zu bezeichnen, hätte an Untertreibung gegrenzt, denn sie war viel schlimmer gewesen. Man hatte im Zuge der Ausbreitung der Seuche alle Flughäfen geschlossen, sodass er in Indianapolis festsaß, ohne sich an irgendjemanden wenden zu können. So war er einzig anhand der Adresse auf seinem Handy zu Toms Bauernhof gefahren. Er hatte ihn nur zweimal getroffen, und zwar jeweils in frühster Kindheit, den persönlichen Kontakt aber, wie es in vielen Familien der Fall war, nicht aufrechterhalten und nur über Facebook mit ihm kommuniziert. Die sporadischen Konversationen waren stets mit dem üblichen »Treffen wir uns mal irgendwann« versehen worden – natürlich in allen Fällen bedeutungslose Worte und vor allem eine Höflichkeitsfloskel für Unterhaltungen, von der sich die Menschen nicht trennen konnten.
Heute genau vor sechs Monaten hatte er das mit Cassidy erfahren. Im Nachhinein wünschte sich Devin, er wäre vor jener halben Ewigkeit ans Telefon gegangen. Er hatte nie zu den Menschen gehört, die nicht ohne ihr Handy leben konnten; für ihn war es nichts weiter als eine praktische Hilfe im Alltag und insbesondere für Notfälle gewesen. Diese Hassliebe zu Mobiltelefonen hatte dazu geführt, dass sein Gerät stummgeschaltet in einem anderen Zimmer liegen geblieben war.
Devin hatte erfolgreich als Texter gearbeitet und ein Umfeld ohne Ablenkungen gebraucht, um produktiv zu sein. An jenem Tag hatte er die Vibrationen des Gerätes gehört, sich aber nicht weiter darum gekümmert. Erst beim späteren Nachsehen war ihm aufgefallen, dass er ein halbes Dutzend Anrufe von einer unbekannten Nummer verpasst hatte. Als er die erste hinterlassene Nachricht abhörte, musste er bereuen, nicht reagiert zu haben. Diese Reue war bald zu Verzweiflung geworden. Nachdem ihn mehrere Personen im Krankenhaus durchgereicht hatten, war er endlich an jemanden geraten, der ihm hatte sagen können, was mit Cassidy geschehen war. Daraufhin hatte er sich ohne Zögern in den nächsten Flieger nach Indianapolis gesetzt.
Die Verzögerung, die sich aus seiner Nachlässigkeit ergeben hatte, sein Handy zu überprüfen, hatte fatale Folgen: Zu dem Zeitpunkt, als er die Klinik in Indianapolis erreichte, war es zu spät gewesen. Dort herrschte reges Durcheinander, und als endlich jemand auf ihn eingegangen war, hatte er erfahren, dass Cassidy nicht mehr lebte. Um alles noch schlimmer zu machen, hatte er nie die Gelegenheit erhalten, ihren Leichnam zu sehen, da dieser von Regierungsbeamten beschlagnahmt und fortgeschafft worden war.
Die letzten Eindrücke, die Devin von ihr bekam, stammten aus der Handykamera des Jungen aus Reihe 22. Das unstete, aber gestochen scharfe Bild des Videos ließ ihn schaudern. Cassidy krank und mit Schmerzen zu sehen, war zu viel für ihn gewesen. Er schaffte es nie, den Mitschnitt bis zum Ende zu sehen, doch jeder örtliche Nachrichtensender hatte ihn tagelang ausgestrahlt, von Youtube und den Sozialnetzwerken ganz zu schweigen. Was zunächst ein Einzelfall war, sollte sich bald häufen, und binnen weniger Tage hatten sich allerorts ähnliche Szenen wie in dem Flugzeug abgespielt. Nicht lange, und es wimmelte vor Handyfotos und -videos von Menschen mit den gleichen Symptomen.
Devin schaute hoch in den dunkelblauen Himmel. Immer noch zogen die Wolken willkürlich dahin, doch ihre Begleiter – die Vögel – fehlten. Er hatte seit Monaten weder sie noch andere Lebewesen gesehen. Seine selbst auferlegte Isolation bot Sicherheit, verschwieg ihm allerdings auch, was außerhalb der 20 Morgen des Gehöfts vor sich ging.
Der Tod war in seiner Raserei nicht wählerisch und rasch mutiert, sodass er bald jegliche Tiere erfasst und umgebracht hatte, genauso wie den Menschen.
Irgendwann fiel Devins Blick auf das Hauptgebäude. Er fragte sich, ob der Gestank endlich so weit verflogen war, dass er sich wieder hineinwagen konnte. Allmählich gingen seine Vorräte zuneige; er hatte das Haus gleich nach seiner Ankunft zum ersten und letzten Mal betreten, dabei alles zusammengerafft, was ihm auf die Schnelle in die Hände gefallen war, und es wieder verlassen, ohne etwas darin zu verändern. Er hielt sich fern, weil sein Cousin fest entschlossen gewesen war, nicht zuzulassen, dass die Krankheit seine Familie umbrachte, es deshalb selbst getan und danach Suizid begangen hatte. Devin war nie dazu gekommen, Toms Kinder kennenzulernen, doch auf Fotos sahen sie sehr niedlich aus: Ein Junge und ein Mädchen, die jeweils nicht älter als acht und sechs hatten sein können. Als er hier ankam, hatte er geklopft und geklopft, und war schließlich eingebrochen. Drinnen hatte ihm der Gestank angekündigt, worauf er schlussendlich stoßen sollte – die ganze Familie, vereint im Elternschlafzimmer des Obergeschosses des alten Bauernhauses. Der Anblick hatte ihn schockiert und abgestoßen. In der Zeit, bis er außer Fassung geraten und zum Stall hinübergeeilt war, hatte er so viel zusammengetragen wie möglich. Hier sollte er sicher verborgen bleiben, doch jetzt würde er, so er weiterleben wollte, zurückkehren müssen, und davor graute ihm.
Während der langen Tage und Nächte in seiner freiwilligen Gefangenschaft verfluchte er sich immer wieder dafür, nie Zeit aufgewandt zu haben, Überlebenstechniken zu lernen, geschweige denn etwas darüber zu lesen. Oft hatte er unverhohlen über Personen gelästert, die sich auf ebendiese Situation vorbereitet hatten, in der er sich nun wiederfand. Wörter wie »dämlich«, »albern« oder »naiv« waren ihm über die Lippen gekommen, um diejenigen zu beschreiben, die sich dem verschrieben hatten, gefolgt von »bescheuert«, »abstrus« und »reif für die Klapsmühle«. Jetzt verwendete er sie, um sich selbst zu beschreiben. Obwohl er überhaupt nichts vom Überleben verstand, überraschte es ihn, wie schnell er sich anpasste. Wäre er zuvor gefragt worden, wie hoch er seine Chancen einschätzte, sich im Zuge eines solchen Ereignisses zu behaupten, hätte er geantwortet, sich überhaupt keine auszurechnen.
Während er auf dem unebenen Erdboden im Stall hin und her ging, versuchte er, Mut zu fassen, um ins Haus zurückzukehren. Es war nicht so, dass er Angst hatte, sich irgendetwas einzufangen; vielmehr wollte er nicht noch einmal riechen, was ihm dort in die Nase gestiegen war. Ihm waren Geschichten über den abartigen Gestank von verwesendem Menschenfleisch zu Ohren gekommen, doch diese konnte er erst bestätigen, seitdem er es selbst gerochen hatte. Ein solches Odeur war ihm noch nie untergekommen und hatte ihm, verbunden mit dem Anblick aufgequollener Leichname, heftige Übelkeit bereitet. Er musste aber wieder hineingehen; von dem, was er aus dem Haus mitgebracht hatte, und den Vorräten, auf die er kurz darauf im Stall gestoßen war, war nämlich so gut wie nichts mehr übrig. Er wusste, bald würde er sich über das Haus und den Bauernhof hinaus auf Nahrungssuche begeben müssen. Bei diesem Gedanken graute ihm ebenfalls.
Im Laufe der vielen Monate im Stall hatte er jede Kiste, jeden Schrank und staubigen Winkel durchsucht. Was er auf seinem Abstecher ins Haus verwenden wollte, war eine Atemschutzmaske, die Toms Frau Jessica angezogen hatte, um ihrem Hobby nachzugehen, alte Möbel zu streichen und zu lackieren. So hoffte Devin, sich vor dem Gestank schützen zu können, falls dieser noch nicht verflogen war, denn dadurch würde ihm leichter fallen, was er tun musste.
Als er das verwitterte Tor des Stalls aufzog, fiel das Licht der Sonne auf ihn, die nun zu fortgeschrittener Morgenstunde höher am Himmel stand. Er hielt inne, um ihre Wärme einen Moment zu genießen. Der ausgetretene Pfad vom Stall zum Haus war noch immer sichtbar; er war noch nicht komplett überwuchert. Devin näherte sich langsam dem Haus, bis er die Treppe erreichte. Als sein Blick darauf fiel, wurde ihm bewusst, wie viele Tausende Füße die Stufen betreten hatten. In ihrer Mitte war die weiße Farbe abgeblättert und das Holz durchgetreten.
Nachdem er auf die Veranda getreten war, versuchte er, die Fliegengittertür zu öffnen, die seit seinem ersten Eintritt über ein halbes Jahr zuvor in einer Ecke aufgerissen war. Er zog sie auf und griff den kalten Messingknauf der massiven Eingangstür. Als er daran drehen wollte, kam ihm ein vertrautes, aber lange nicht gehörtes Geräusch zu Ohr: Das tiefe Bellen eines Hundes.
Er blieb stehen und sah sich um.
Erneut gab das Tier Laut.
Seit er einen Hund oder ein anderes Lebewesen gesehen, geschweige denn gehört hatte, waren sechs Monate vergangen. Die Küchentür, durch die er eintreten wollte, befand sich an der Südseite des Gebäudes, die unbefestigte Landstraße hingegen verlief davor in Richtung Norden, und rings um das Haus erstreckten sich Maisfelder.
Wieder bellte der Hund, diesmal näher, und zwar von der Nordseite her. Devin trat rasch ins Haus und schloss die Tür hinter sich. Den Hund gehört zu haben, machte ihm Angst, weil er befürchtete, er komme mit einem Menschen oder sei selbst hungrig. Nie zuvor in seinem Leben hatte er sich vor Hunden gefürchtet, doch jetzt war ihm klar, dass alles, was noch lebte, essen musste, und große Hunde waren definitiv imstande, einen Menschen zu reißen.
Er ging zügig durch die Wohnung und stellte sich an ein breites Erkerfenster, von dem er die geschotterte Einfahrt und die Landstraße dahinter sehen konnte. Er schob die Vorhänge beiseite und warf einen Blick hinaus, konnte aber nichts Auffälliges entdecken. Sein Herz raste, und er fing an zu schwitzen. »Komm runter, Dev, es ist bloß ein Hund«, redete er sich ein.
Da bellte das Tier wieder.
Er ließ den Blick weiterhin schweifen. Nicht eher wollte er sich auf die Suche nach Nahrungsmitteln begeben, bis er sicher sein konnte, wo der Hund war und wer ihn vielleicht begleitete.
Auf einmal sah er ihn. Es war ein großer Deutscher Schäferhund, der sich auf der Landstraße näherte. Merkwürdigerweise wirkte der Hund vergnügt. Devin wusste nicht, wie er darauf gekommen war, hatte sich sein Aussehen aber bedrohlicher vorgestellt.
Er neigte sich näher zur Scheibe, als würde es ihm helfen, besser zu sehen.
Plötzlich pfiff es laut, und das Tier blieb stehen.
Jemanden pfeifen zu hören, jagte Devin einen kalten Schauer über den Rücken. Er spürte, wie sich sein Herzschlag weiter beschleunigte und Panik in ihm aufstieg. Er sah hektisch hin und her, um die Person zu entdecken, die gepfiffen hatte.
Der Hund blieb vor der Einfahrt stehen und blickte die Straße zurück, doch die toten Maispflanzen hinderten Devin daran, zu erkennen, auf wen das Tier wartete. »Dev, reiß dich zusammen«, murmelte er und konzentrierte sich wieder aufs Atmen.
Er hatte seit seiner langen Reise nach Decatur keinen anderen Menschen mehr getroffen, und jene letzte Begegnung war nicht gewaltfrei gewesen. Schon damals hatte er sich kaum retten können, und jetzt konnte er sich nur zu gut vorstellen, dass die Menschen noch aggressiver waren. Er wusste, Lebensmittel waren unweigerlich knapp, also sollte es ihn nicht überraschen, auf andere Menschen zu stoßen, doch nachdem ihm sechs Monate lang niemand über den Weg gelaufen war, hatte er allmählich geglaubt, er sei der einzige Überlebende.
Schweiß lief ihm von der Stirn in die Augen. Er wischte ihn hastig weg und fuhr sich durch sein ungekämmtes, kurzes Haar; die nasse Hand wischte er daraufhin an seiner Hose ab. Während seines abgeschotteten Aufenthalts im Stall hatte er weiterhin Wert auf Körperhygiene gelegt, so gut es ging. Da er langes Haar nicht mochte, hatte er seinen dichten, schwarzen Schopf mit einer Schere kurzgehalten, die er fand. In seinen gleichfalls schwarzen Bart mischten sich nun graue Stellen. Er stutzte ihn regelmäßig, damit er nicht zu lang wurde.
Devins blaue Augen starrten eindringlich auf den Rand des Maisfelds, während er ungeduldig darauf wartete, wer hervortreten würde. Der Hund begann, am Boden zu schnuppern, und kam dann näher.
Devins quälende Warterei fand ein Ende, als eine schlanke Frau auftauchte. Da sie noch etwa 200 Fuß entfernt war, konnte Devin ihr Alter und ihre Verfassung nicht einschätzen. Sie trug Jeans und Stiefel sowie eine enge Lederjacke. Ihr langes, braunes Haar hatte sie zusammengebunden und hinten durch eine Baseballmütze gezogen. Sie hielt eine Waffe in den Händen – ein AR-Sturmgewehr, soweit er erkennen konnte.
Die Frau wies den Hund an, zum Haus zu gehen.
Devin schnellte zurück und duckte sich, damit sie ihn nicht entdeckte. Jetzt wünschte er sich, all die vergangenen Monate dazu genutzt zu haben, um sich auf angemessene Weise zu wappnen, statt sich in seinem Tun von Emotionen und einem schwachen Magen leiten zu lassen. Er brauchte irgendetwas, um sich zur Wehr setzen zu können – und zwar schnell. Nachdem er sich vergewissert hatte, dass sie ihn nicht sah, eilte er in den einzigen Raum, der ihm einfiel: die Küche. Dort schnappte er sich ein langes Fleischmesser. Als er die Edelstahlklinge betrachtete, fühlte er sich ein wenig sicherer. Dann drängte sich ihm ein Bild auf: Er erinnerte sich, eine Flinte über dem Kamin im Wohnzimmer gesehen zu haben. Warum sie ihm zunächst nicht hatte einfallen wollen, diese Frage würde er sich später stellen. Jetzt lief er nach nebenan und nahm die Waffe herunter. Er kannte sich nicht damit aus – mit keinerlei Waffen. Sein ganzes bisheriges Leben war er davon überzeugt gewesen, keine zu brauchen. Einmal mehr wünschte er sich, die Zeit zurückdrehen zu können, um seine blauäugige Einstellung zu ändern. Er wusste nicht, wie man mit einer Flinte schoss, und jetzt war seine Zeit abgelaufen.
Die Bohlen unter dem Vorbau knarrten, als die Frau und der Hund heraufkamen. Dessen lange Nägel verursachten Klickgeräusche auf dem Holz, während er auf der überdachten Terrasse herumschnüffelte, die rund ums Haus führte.
Devin ging hinter einem breiten Schaukelsessel in Deckung, kniete sich hin und machte sich darauf gefasst, entdeckt zu werden.
Jetzt blieb ihm nur noch sein Hörsinn, weil seine Sicht eingeschränkt war. Angestrengt lauschend erkannte er, dass die beiden die Vordertür erreicht hatten. Er warf einen verstohlenen Blick über den Sessel hinweg zum Eingang, der nur 15 Fuß entfernt war, und sah den Messingknauf wackeln, als sie daran rüttelte, nur um herauszufinden, dass sie vor verschlossener Tür stand.
Devin sah, wie sie zu dem breiten Erkerfenster weiterging, an dem er zuvor gestanden hatte. Dort hörten ihre Schritte auf. Er konnte sich nur vorstellen, wie sie hereinschaute. Ein Winseln machte ihn und die Frau darauf aufmerksam, dass der Hund an der Hintertür stand.
Devin fiel ein, dass er sie nicht verriegelt hatte. Jetzt war er hin und her gerissen: Sollte er versuchen, dies nachzuholen, oder einfach zulassen, dass die beiden hereinkamen? Schließlich sah er ein, dass sie dies sowieso tun würden, abgesperrte Tür hin oder her.
Er schloss die Augen und lauschte weiter. Mit jedem Schritt, den die Frau um das Haus machte, nahm sein Blutdruck zu. Er packte die Flinte fester, während ihm der Schweiß von der Stirn rann.
Schließlich kam sie an der Hintertür an; er konnte hören, wie sie dem Hund etwas zuflüsterte.
Da kam ihm eine Idee: Er wusste nun, was er zu tun hatte.
Zwischen ihm und der Tür in der Küche befand sich eine Wand; er stand auf und lehnte sich dagegen. Jetzt war die Frau nur acht Fuß von ihm entfernt. Er wartete auf das Geräusch, das ihn zur Tat schreiten lassen würde.
Der Knauf drehte sich, und die Tür wurde einen Spaltbreit aufgestoßen; das alte Erlenholz ächzte, als sie vollständig geöffnet wurde.
Das war Devins Zeichen. Er trat mit der Flinte im Anschlag hinter der Wand hervor. Aber wer auch immer diese Frau war – sie hatte sich auf so etwas gefasst gemacht und legte bereits auf ihn an.
»Sofort stehen bleiben, das ist mein Haus!«, schrie er sie an.
»Tun Sie nichts Unbesonnenes, ich suche nur etwas zu essen«, erklärte die Frau. »Es sah so aus, als sei niemand hier.«
»Tja, da täuschen Sie sich!«, krächzte Devin, während er den Griff der Flinte mit seiner klammen Hand noch fester packte. Sein rechter Zeigefinger lag am Abzug, schussbereit falls nötig.
»Nehmen Sie einfach die Waffe runter, dann tue ich es auch«, verlangte die Frau in ruhigem Ton, während sie Devin über den kurzen Lauf ihres AR-15 hinweg anstarrte.
»Sie zuerst«, entgegnete er.
Der Hund begann, kaum hörbar zu knurren. Er fletschte die Zähne und ging in Angriffsstellung. Als Devin ihn ansah, wusste er, dass er unterliegen würde.
»Brando, ganz ruhig. Dieser freundliche Mann wird uns nicht erschießen«, beschwichtigte die Frau, ohne ihre wachsamen Augen von Devin abzuwenden.
Brando trat einen Schritt vorwärts.
Devin war drauf und dran, den Kopf zu verlieren. »Sagen Sie dem Köter, er soll Sitz machen oder so!«
»Er folgt nur, wenn er will.«
Devin wusste nicht, was er tun sollte; Furcht bestimmte sein Verhalten.
Brando hob langsam seine rechte Vorderpfote und stellte sie wieder hin. Er bewegte sich zaghaft auf Devin zu, pirschte sich an wie ein Raubtier auf Beutezug.
»Verschwinden Sie jetzt!«, schrie Devin, dessen Stimme wegen der Schutzmaske dumpf klang.
»Wir gehen ja schon, keine Sorge. Knallen Sie uns bloß nicht von hinten ab.«
Nachdem er das gehört hatte, verspürte Devin einen Hauch von Überlegenheit.
»Komm, Brando, so freundlich ist unser Gastgeber doch nicht.«
Doch der Hund ließ nicht von Devin ab. Sein Knurren war lauter geworden, und seine weißen Zähne ließ er jetzt deutlich erkennen.
Die Frau ging rückwärts, bis sie gegen die Fliegengittertür stieß.
»Brando, Junge, jetzt komm«, befahl sie.
Das Tier wollte nicht hören; ein Streifen seines dichten, schwarzen Rückenfells sträubte sich.
»Ich schieße auf das Vieh, ich sag’s Ihnen!«
»Egal, was Sie tun, zielen Sie nicht auf ihn. Ich bringe ihn dazu, bei Fuß zu kommen, geben Sie mir bloß etwas Zeit«, bat sie.
Brando knurrte immer lauter, bis er wieder bellte. Devin zuckte zusammen und richtete die Flinte auf ihn. Der Hund sperrte sein Maul auf und stürzte los. Er vergrub die Zähne in Devins rechtem Arm. Der schrie vor Schmerz auf und drückte ab, doch nichts geschah, weil die Flinte nicht entsichert war.
Brando schüttelte heftig den Kopf, während er fester zubiss. Solche Schmerzen hatte Devin noch nie erlebt. Er ließ die Waffe fallen und taumelte rückwärts, ehe er über die Kante eines dicken Perserteppichs im Wohnzimmer stolperte.
Das Tier ließ ihn einfach nicht los. Schließlich ging Devin rücklings nieder, und der Hund mit ihm. Dabei brüllte er noch vor Schmerz, was jedoch abrupt aufhörte, als er mit dem Kopf gegen den Couchtisch schlug. Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass sein Blickfeld verschwamm, bevor es endgültig schwarz wurde.
Lager 13 der Katastrophenschutzbehörde, Region VIII, 50 Meilen östlich des internationalen Flughafens Denver
Aus den Lautsprechern plärrte der Morgenappell und beendete Lori Roberts’ kurzen Schlaf. Nachdem sie sich die ganze Nacht lang hin und her gewälzt hatte, war sie gerade eine Stunde zuvor erschöpft weggetreten.
Die anderen, mit denen sie in dem großen Allzweckzelt lag – ihr Ehemann David und ihr Sohn Eric – waren schon wach und machten sich für den bevorstehenden Tag fertig, von dem Lori wusste, dass er exakt so verlaufen würde wie der vorige und der davor.
Am morgigen Tag lebten sie genau vier Monate in Lager 13, doch dies gab keinen Anlass zum Feiern. Was sie als Symbol der Hoffnung und Rettung vor der Seuche aufgefasst hatten, stand jetzt für Verzweiflung.
Ihr Mann David verglich das Lager oft scherzhaft mit einer Kakerlakenfalle: »Man kommt rein, aber nicht mehr raus.«
Genau so war es auch: Als sie vor knapp vier Monaten eingetroffen waren, hatten sie sich gefreut, noch am Leben zu sein und die Chance zu einem Neuanfang zu erhalten, doch diese Zuversicht sollte sich bald zerschlagen, als drastisch klar wurde, wie schlimm die Dinge wirklich standen, sogar für die Regierung.
»Schatz, steh auf. Lass uns vor der Morgenversammlung noch etwas frühstücken«, sagte David, während er sich ein Shirt überstreifte.
Lori wälzte sich herum und sah ihn an, wobei das Morgenlicht nur einen Teil seines Gesichts erhellte. »Du und Eric, esst ruhig etwas; wir sehen uns dann bei der Versammlung.«
»Bist du sicher?«
»Ja, ich bin müde und möchte noch eine Weile liegen bleiben.«
Er kniete sich neben sie und nahm ihre Hand. Nachdem er diese geküsst hatte, fragte er: »Wieder eine schlaflose Nacht?«
»Ich habe alles versucht, liege dann aber doch wach und grüble.«
»Geh heute zu einem Arzt, der soll dir etwas verschreiben.«
»Vergiss es, ich setze mich nicht acht Stunden oder länger in eine Schlange.«
»Was hast du denn sonst zu tun? Du musst ja diese Woche nicht zum Arbeitskreis.«
»Mal sehen. Geh jetzt, nimm auch ein Päckchen Erdnussbutter und Kekse für mich«, erwiderte sie und rieb seinen Arm.
»Geht es Mom gut?«, fragte Eric, der nun auf die beiden hinabschaute. Er war 16 und kam ganz nach seinem Vater: braunhaarig, groß und schlank. Lori witzelte häufig, sie wisse nur deshalb, dass er ihr Sohn sei, weil sie bei seiner Geburt gesehen habe, wie er aus ihrem Körper gekommen war.
»Okay«, sagte David, stand auf und ging los, hielt aber noch einmal inne. »Und nicht verschlafen.«
Ein Streifen Tageslicht fiel in ihr staubiges Zelt, als David und Eric es verließen. Lori kniff die Augen zu, als es auf sie traf, gerade als sie sich umdrehte. Dass sie nicht aufstehen konnte, lag nicht etwa an körperlicher Schwäche, sondern an seelischer Ermattung. David wusste dies, behielt es aber für sich.
Nachdem die beiden endlich gegangen waren, lag sie allein im Zelt, doch diese Einsamkeit – ein Gefühl der Entrückung – spürte sie auch, wenn sie von den Tausenden im Lager umgeben war.
Lori war eine fähige Frau und Teilhaberin an einem Architekturbetrieb gewesen, bevor der Tod Einzug gehalten und alles zunichtegemacht hatte. Früher war sie oft nachdenklich und dankbar für das Leben gewesen, das sie sich hatte schaffen können, doch dann – von einem Moment auf den nächsten – war alles dahin. Sie erinnerte sich noch an die Nachrichten im Fernsehen über die anfängliche Ausbreitung des Virus, wobei sie wie so viele andere geglaubt hatte, es sei etwas, das sie nicht betreffe. Wie oft sahen Menschen etwas und dachten, es sei nur das Elend anderer? Niemand rechnet jemals damit, es könne ihm selbst widerfahren. Wäre sie imstande, in der Zeit zurückzugehen und eines zu ändern, dann wäre dies ihre damalige Ichbezogenheit. Sie wünschte sich, auf das Bauchgefühl ihres Ehemanns gehört und die Kinder aus der Schule genommen zu haben. Allerdings war sie davon ausgegangen, die Obrigkeit kümmere sich bereits um die Krankheit, weshalb sie unmöglich in dem hübschen, kleinen Nest Castle Rock in Colorado einfallen könnte.
Diese einfache, kurzsichtige und leichtgläubige Entscheidung war sie teuer zu stehen gekommen. Die einst selbstbewusste Frau, die sich in die Geschäftswelt gestürzt und diese im Sturm genommen, die eine Bilderbuchehe geführt und die perfekte, kleine Familie gegründet hatte, war durch den schnöden Entschluss, ihre Kinder weiterhin zur Schule zu schicken, zermürbt worden. Ihre einzige Tochter Madeleine, war ein hübsches, neunjähriges Mädchen mit langem, dunklem Haar und einem Gesicht gewesen, das stets ein Lächeln geziert hatte. Sie war glücklich gewesen und hatte ihr Leben sogar schon in jenem zarten Alter vorausgeplant, ja selbst das College bereits ausgesucht, das sie besuchen würde. Nichts von alledem sollte sich erfüllen, denn sie war innerhalb einer Woche gestorben, nachdem sie die Schule wieder besucht hatte. Als sie von dort nach Hause kam, hatte sie unter grippeähnlichen Symptomen gelitten und fiel in ein Koma, bevor irgendjemand eine Diagnose stellen konnte.
Das war schon die zweite falsche Entscheidung gewesen, die Lori bitter bereut hatte. Die erste lag zwei Jahre zurück; seinerzeit war David ihrer Affäre mit einem Ratsmitglied aus Denver auf die Schliche gekommen. Diese fand ein Ende, sodass es ihr nach monatelangen Therapiesitzungen und vielen flehentlichen Worten gelungen war, ihre Ehe zu retten und so die Familie zusammenzuhalten. Daraufhin hatte sie sich geschworen, ein besserer Mensch, eine bessere Mutter und Ehefrau zu sein.
David hatte im Zuge jener Affäre und auch bei Madeleines Tod große Stärke bewiesen. Als das Mädchen starb, hatte sich Lori Vorwürfe gemacht, war aber von ihm getröstet und darauf hingewiesen worden, dass sie keine Schuld traf. Er hatte ständig betont, Madeleine sei nicht immun gewesen und wäre irgendwann sowieso gestorben.
Das hatte die Mutter nie glauben wollen; ihr war es leichter gefallen, mit sich selbst ins Gericht zu gehen, weil sie zugelassen hatte, dass die Kinder in die Schule und unter Menschen gegangen waren, wo sie sich dem Virus ausgesetzt hatten.
Die Zustände in den Vereinigten Staaten waren schnell außer Kontrolle geraten, als sich die Krankheit ausbreitete und alles umbrachte, was nicht immun gewesen war – auch die Tiere. Wer sich vorbereitet und Rückzugspunkte gesucht hatte, war zu dem Glauben verleitet worden, sich schützen zu können, doch auch sie hatte der Tod bald ereilt. Niemand konnte sich vor Erregern schützen, die sich durch die Luft leicht von Mensch zu Mensch beziehungsweise Mensch zu Tier und umgekehrt übertrugen. Etwas Derartiges hatte man nie zuvor erlebt, und wahrscheinlich würde es auch kein weiteres Mal dazu kommen. Diese Seuche blieb in ihrem Ausmaß ohne Beispiel. Die einzige Chance, sie zu überleben, bestand in Immunität.
Nach Madeleines Tod hatten sich David, Lori und Eric in ihrem Haus verschanzt und Tage, dann Wochen verstreichen lassen. Zwei Monate später schließlich waren sie übereingekommen, sich hinauszuwagen, um nach Vorräten zu suchen. Auf einem jener Abstecher war David einer Einheit der Nationalgarde begegnet. Kaum ein paar Stunden, nachdem er diese Soldaten getroffen hatte, waren die drei auf dem Weg zu Lager 13 gewesen. Zwangsevakuierung hatte man es genannt. Zuerst war ihnen der Ort vielversprechend vorgekommen, doch das hatte sich rasch geändert.
Lori bemühte sich, Ruhe zu finden, doch viele Gedanken und Eindrücke schwirrten ihr durch den Kopf. Einer nach dem anderen blitzte auf, jeder schlimmer als der vorige. Sie stellte sich vor, sie könnten Lager 13 nie mehr verlassen, müssten für immer hierbleiben, ohne Hoffnung darauf, die Außenwelt je wiederzusehen.
Jeden Morgen hielt der Kommandant des Lagers eine Versammlung ab; dabei machte er Ankündigungen und rief gelegentlich auch Namen aus. Das waren dann die wenigen Auserwählten, die aus unerfindlichen Gründen ins Camp Sierra umsiedeln durften. Was dort anders sei, belief sich auf Gerüchte, weil niemand es je gesehen hatte. Sie wussten nur, was das Personal des Katastrophenschutzes ihnen erzählte.
Camp Sierra war eine völlig neue Siedlung fernab des Chaos, das im Rest des Landes herrschte. Jeden Morgen besuchten sie die Versammlung und warteten gespannt darauf, selbst ausgerufen zu werden, sahen sich aber stets aufs Neue enttäuscht.
Die unaufhörlichen Gedanken und Bilder versetzten Lori bald in eine Trance. Benebelt durch diesen Zustand schlief sie langsam wieder ein.
»Lori, aufstehen!«, rief David durch die offene Zeltklappe.
Sie riss die Augen weit auf und fuhr hoch. »Was, wie?«
»Die Versammlung, komm schon, die Namen werden gerade aufgerufen!«, drängte er.
Lori sprang auf, griff zu einer kurzen Hose und zog sie an, bevor sie das fleckige, weiße T-Shirt hineinsteckte, das sie trug.
»Wo sind meine Schuhe?«, fragte sie, während sie hektisch unter ihrem Feldbett nachsah.
»Weiß nicht, aber mach schnell, es dauert nicht mehr lange.«
»Da sind sie ja.« Sie hatte die Schuhe gefunden. Als sie sie hervorziehen wollte, blieb einer hängen. Beim Ziehen daran fiel eine kleine Handtasche um, sodass deren Inhalt herauspurzelte. Lori zog noch einmal, wobei sie den Schuh losreißen konnte, aber auch einen Blick auf die verstreuten Sachen warf, unter welchen sich ein Foto von Madeleine befand. Sie hatte es längere Zeit nicht betrachtet und fragte sich, warum es herausgefallen war; dann fiel ihr auf, dass jemand den Reißverschluss der Tasche geöffnet hatte.
»Lori, mach endlich!«
Nachdem sie den Schuh und das Foto unter dem Bett hervorgezogen hatte, warf sie einen unauffälligen Blick auf ihre Tochter und berührte deren Gesicht auf dem Bild.
David war mit seiner Geduld am Ende. Er stürmte ins Zelt, packte sie am Arm und zog sie hoch. »Nimm die Schuhe einfach mit, komm jetzt!«
Sie ließ das Foto fallen. »He, einen Moment.«
»Genau das ist es, Lori, wir haben keinen Moment mehr. Sollten wir unsere Namen verpassen, weißt du, was passiert.«
Er hatte recht, sie durften die Ausrufung nicht verpassen, denn dann würde man sie weniger ersprießlichen Arbeitskreisen zuteilen, und David war der Ansicht, dies bedeutete, sie könnten niemals einen der begehrten Plätze in Camp Sierra erhalten.
Eine kleine, aber lautstarke Gruppe im Lager hatte begonnen, schlecht darüber zu sprechen, doch David hielt Unterstellungen, Camp Sierra sei beileibe keine wünschenswerte Bleibe, für dämliche Verschwörungstheorien. Er war ein sehr gelehriger Mensch und besaß zwei Masterstudienabschlüsse, genauer gesagt in Welt- und speziell amerikanischer Geschichte. In seinen Augen durfte man nichts, was nicht bewiesen oder durch verlässliche Belege und Daten untermauert werden konnte, als Wahrheit erachten. Ihm missfielen Gerüchte, und vor allem Verschwörungstheorien entstammten seiner Ansicht nach von Personen mit üppiger Fantasie.
Die Sonne schien hell, und ihre Strahlen auf der Haut zu spüren, tat Lori gut.
Sie eilten durch das Zeltlabyrinth, bis sie den weiten Platz in der Mitte des Geländes erreichten. Dort standen alle in ordentlichen Reihen – wie Soldaten bei einer Parade –, die Lager 13 ihr Zuhause nannten. Es war in vier Quadranten zu jeweils gleich vielen Zelten unterteilt, die das zentrale Feld und ein Dutzend Hilfsgebäude umgaben.
Lori und David liefen über den Kiesweg zu ihrer Reihe. Während sie sich durch die Reihen drängten, stießen sie ihre Mitbewohner an und entschuldigten sich dafür, ehe sie endlich ihre Plätze erreichten.
»Wo seid ihr gewesen?«, fragte Eric.
»Tut mir leid, hab verschlafen«, antwortete Lori.
»Psst«, mahnte David.
Eine laute Stimme setzte sich über die Menschenmenge hinweg, indem sie einzelne Namen aufrief. Sie gehörte dem stellvertretenden Koordinator für Notfallmaßnahmen und Rettungsdienste Carlos Vasquez, der ihren Quadranten leitete und schon lange beim Katastrophenschutz arbeitete.
»David Roberts!«, rief er.
»Hier.«
»Lori Roberts!«
»Hier.«
»Leidlich pünktlich heute Morgen«, spöttelte Carlos.
Lori warf ihm einen bösen Blick zu und sagte: »Ich bin hier. Das ist das Einzige, was zählt, richtig?«
Der Aufseher schaute sie streng an, hakte ihren Namen ab und fuhr mit den anderen fort.
Als die tägliche Routine vorüber war, folgten Bekanntmachungen und für manche – jeder hoffte darauf – die Erlaubnis zum Umzug.
Die großen Boxen der Beschallungsanlagen, die überall auf dem Gelände angebracht waren, erwachten mit einem Rauschen zum Leben.
»Guten Morgen, Lager 13, wie geht es uns an diesem wunderbaren Morgen?«, fragte eine Stimme.
Alle glotzten bloß unbeeindruckt.
»Hier spricht Lagerkommandant Brockman. Heute ist ein aufregender Tag. Camp Sierra gedeiht prächtig, und dank dieses Erfolges, so ließ man uns wissen, wird dort expandiert. Was bedeutet das nun für 13? Es bedeutet, dass mehr von Ihnen die Möglichkeit erhalten werden, dort hinzuziehen. Deshalb wird die heutige Ausrufung mehr Namen umfassen als üblich. Bitte haben Sie weiterhin Geduld, während wir uns anstrengen, dass jeder ein Zuhause in Sierra finden wird.«
David streckte seinen Arm aus und umfasste Loris Hand.
Sie spürte, wie aufgeregt er war.
Brockman rief sechs Personen auf.
Jubel und Applaus kamen in Quadrant 2 auf, der ihnen gegenüberlag. Die Glücklichen traten aus der Formation hervor und eilten zur Mitte, wo mehrere Angestellte der Behörde sie zu einem geräumigen, roten Zelt begleiteten – dem Big Red, wie man es intern nannte. Dabei handelte es sich um die große Abfertigungsstelle am Eingang des Lagers, die man nur zweimal betrat, bei der Ankunft und vor dem Aufbruch, wann auch immer es dazu kommen mochte. Man konnte die Uhr danach stellen, dass binnen zweier Stunden nach dem Aufruf ein schwerer, weißer LKW ohne Fenster von dort aufbrach, begleitet von gepanzerten Wagen der Nationalgarde.
David wandte sich Lori zu. »Na ja, dann vielleicht morgen«, seufzte er.
Sie schaute ihn an, hielt es aber für besser, nichts zu entgegnen. Sie wollte nicht negativ sein, und eigentlich bedeutete es ihr auch nichts mehr, da sie sich damit abgefunden hatte, sehr lange in Lager 13 bleiben zu müssen.
»Das wäre alles für heute, einen wundervollen Tag wünsche ich. Die Leiter Ihrer jeweiligen Quadranten werden von jetzt an alles Weitere übernehmen«, schloss Brockman. Die Lautsprecher klickten und verstummten.
»Also gut, Quadrant 4, Ihre Zuteilung in Arbeitskreisen bleibt wie gestern«, knarrte Vasquez den 400 Bewohnern des Quadranten entgegen. »Frohes Schaffen.«
Als sich die Reihen auflösten, beobachtete Lori die sechs Personen, die umziehen durften. Ihre Gesichtsausdrücke zeugten von einer Freude, die für sie selbst, so glaubte sie, nicht existierte. Auch David sah die Auserwählten neidisch an. Er war Lager 13 leid und wollte es so bald wie möglich verlassen.
Plötzlich gingen die Lautsprecher wieder an.
»Lori Roberts, Quadrant 4, möchte sich bitte bei der Verwaltung melden, ich wiederhole: Lori Roberts, Quadrant 4, melden Sie sich bei der Verwaltung.«
Sie machte große Augen, als sie das hörte.
David schaute sie an und bemerkt in leicht aufgeregtem Tonfall: »Vielleicht ist es etwas Erfreuliches.«
»Das bezweifle ich.«
»Lori Roberts, folgen Sie mir«, blaffte Vasquez, der mit einem Klemmbrett in der Hand nur ein paar Fuß weit neben ihnen stand.
Lori sah David noch einmal an, hauchte ihm einen Kuss zu und wandte sich ab, um mit Vasquez zum Verwaltungsgebäude zu gehen.
Decatur, Illinois
Das Erste, was Devin spürte, waren pochende Schmerzen, die von seinem Hinterkopf ausgingen. Als ihm bewusst wurde, dass er nicht träumte, öffnete er die Augen und versuchte, sich aufrecht hinzusetzen, was er jedoch nicht konnte. Er schaute an sich hinunter und sah, dass er mit unzähligen Lagen Klebeband an einen Polstersessel im Wohnzimmer gefesselt worden war. Als er sich aufbäumte, um freizukommen, machte sich auch der Schmerz in seinem rechten Arm bemerkbar. Er stellte fest, dass dieser bandagiert und mit weißem Mull umwickelt war. Er ließ seinen Blick hektisch durch den Raum schweifen, um herauszufinden, ob seine Fängerin noch da war. Dunkelgelbes Licht, das von hinten einfiel, ließ darauf schließen, dass es bereits Nachmittag war, also hatte er sein Bewusstsein für mehrere Stunden verloren.
Nach einigen Minuten Gezappel gab er auf und horchte. Dabei kam ihm der Gedanke, falls diese Frau seinen Tod gewollt hätte, wäre es ihr ein Leichtes gewesen, dies umzusetzen. Außerdem war sein verarzteter Arm ein deutliches Zeichen dafür, dass er zumindest vorerst nicht um sein Leben fürchten musste.
»Hallo?«, rief er laut.
Stille.
»He, hallo, sind Sie noch da?«
Nichts.
Er wartete und lauschte, erhielt aber keine Antwort. Langsam machte er sich Sorgen, weil er dachte, sie wollte ihn womöglich langsam zu Tode foltern, indem sie ihn gefesselt im Sessel sitzen ließ. Diese Befürchtung veranlasste ihn wieder dazu, sich gegen die Klebebandwickel zu wehren.
Er grunzte und schimpfte, während er sich wand.
»Ohne meine Hilfe wird das nichts«, sagte die Frau auf einmal von hinten.
Er war so laut und mit sich selbst beschäftigt gewesen, dass er ihr Kommen nicht gehört hatte.
»Werden Sie mich umbringen?«, fragte er.
Sie trat vor und schaute ihn an; das Gewehr hatte sie sich um die Schulter gehängt. Nachdem sie sich auf den Couchtisch gesetzt hatte, antwortete sie ernst: »Nein, aber ich gebe zu, ich habe mit dem Gedanken gespielt.«
»Dann schneiden Sie mich los.«
»Nein, noch nicht. Sie machen mich nervös.«
»Sie sind diejenige, die in mein Haus eingedrungen ist.«
»Was das betrifft, so habe ich, nachdem Sie sich den Kopf stießen, ihre Wunde gesäubert und den Arm verbunden. Übrigens warnte ich Sie vor Brando, doch Ihnen fiel nichts Besseres ein, als mit der Flinte auf ihn anzulegen.«
»Ich dachte, er würde mich anfallen.«
»Nun, das hat er ja. Aber nur, weil Sie ihn mit der Waffe bedroht haben.«
»Was wollen Sie?«
»Zu essen, zu trinken und eine Unterkunft, um mich eine Weile auszuruhen und wieder zu Kräften zu kommen.«
In diesem Moment bemerkte er, dass er den Atemschutz nicht mehr trug. »Wo ist meine Maske?«
»Dort.« Sie zeigte zur Küche. »Wozu haben Sie sie überhaupt getragen?«
»Ich will nicht krank werden.«
»Krank? Ich glaube nicht, dass Sie sich Gedanken darüber machen müssen.«
Devin wusste nicht, was er von dieser Bemerkung halten sollte; er wünschte sich jetzt nichts so sehr, als das ganze Klebeband loszuwerden.
»Wir beide wissen, dass Ihnen dieses charmante Anwesen nicht gehört. Ich habe die Besitzer oben gefunden, mausetot. Jetzt muss ich, wie ich finde, kein schlechtes Gewissen haben, hier eingedrungen zu sein.«
»Sie waren Verwandte.«
»Unsinn.«
»Wirklich.«
»Wie dem auch sei, ich brauche nur ein paar Dinge und bin in ein, zwei Tagen wieder verschwunden.«
»Nehmen Sie sich, was Sie wollen, und gehen Sie, aber würden Sie mich bitte losmachen?«
»Spielen Sie jetzt den Freundlichen?«
»Ich werde keine Dummheiten anstellen, versprochen.«
Sie hielt einen Augenblick lang inne und sah ihn an. »Brando, komm her«, befahl sie dann.
Der Hund tappte ins Zimmer, setzte sich und schaute zu Devin.
»Ich lasse Sie frei, doch er ist meine Versicherung, falls Sie irgendetwas anstellen wollen.«
»Ich schwöre, ich tue nichts. Nur passen Sie bitte auf, dass er mich nicht wieder angreift.«
»Das muss ich ihm nicht sagen; falls es wieder geschieht, haben Sie es sich selbst zuzuschreiben.« Damit zog sie ein Taschenmesser aus ihrer Jeans und klappte es mit einem geräuschvollen Klicken auf. Nachdem sie das Klebeband mit der drei Zoll langen, schmalen Spyderco-Klinge durchtrennt hatte, streifte sie es von seinem Oberkörper und tat das Gleiche mit seinen Beinen.
Er wand und drehte sich, bis er das Band los war. Als er aufstand, wurde ihm schwindlig, weshalb er gezwungen war, sich wieder in den Sessel fallen zu lassen.
»Alles in Ordnung mit Ihnen?«, fragte sie.
»Äh, ja, mir ist bloß schummrig«, antwortete er, während er seinen Kopf in die Hände stützte.
»Nun, ich habe meinen Teil der Abmachung eingehalten; jetzt suche ich weiter zusammen, was ich brauche.«
»Warten Sie einen Moment«, bat Devin.
Da sich viele seiner anfänglichen Bedenken verflüchtigt hatten, wollte er wissen, wer diese Frau war. Er hatte seit sechs Monaten keinen anderen Menschen gesehen, und nun mit jemandem sprechen zu können, war ihm wichtig. Im Hinterkopf behielt er den Gedanken, sie könne ihm einen Großteil der Lebensmittel stehlen, und nach dem, was gerade geschehen war, wollte er nicht mit ihr darum kämpfen müssen.
Sie blieb stehen und wartete darauf, was er wollte.
»Wie heißen Sie?«
»Tess.«
»Ich bin Devin.«
»Gut, damit wären die üblichen Nettigkeiten ausgetauscht; darf ich jetzt weitermachen?«
»Woher kommen Sie?«
Tess ignorierte seine Frage und kehrte in die Küche zurück, um Konserven in ihren Rucksack zu packen.
Er stand vorsichtig auf und haderte mit seinem Gleichgewicht. Bevor er sich in Bewegung setzte, schaute er zu Brando, der seine Augen keine Sekunde lang von ihm abgewandt hatte.
»Dieses Haus ist eine Goldgrube«, bemerkte Tess freudig.
»Stimmt, in ihrer Speisekammer fehlte es an nichts, das steht fest«, entgegnete Devin, während er langsam an Brando vorbeiging. Dann betrat er die Küche.
»Ich schätze, Sie sind selbst gerade erst angekommen, oder?«
»Nein, ich bin seit fast sechs Monaten hier.« Devin zog einen kleinen Stuhl unterm Küchentisch hervor und setzte sich.
Sie unterbrach sich beim Packen und drehte sich um. »Sie wollen mir weismachen, schon so lange hier zu sein, obwohl noch so viel zu essen übrig ist?«
»Genau so ist es.«
»Das erklärt, warum Sie solchen Wert auf diese dumme Maske legen.«
»Was meinen Sie damit?«
»Dass Gasmasken und dergleichen nichts gegen diesen Tod ausrichten, und jeder, der nur eine Minute dort draußen verbracht hat, müsste das wissen.«
»Diesen Tod?«
»Sie wissen schon, das Virus, von dem 90 Prozent des Lebens auf dem Planeten ausgelöscht wurden.«
»Ich wusste gar nicht, dass es einfach nur ›Der Tod‹ genannt wird.«
»Tja, so ist es aber«, bekräftigte sie selbstgefällig.
»Ich kam ein paar Tage nach dem Ausbruch hier an – mit dem Auto aus Indianapolis. Ich schaffte es bis nach Decatur, doch dort wurde ich von einer Bande überfallen, die mir die Kiste geklaut hat. Dabei wäre ich fast draufgegangen. Als ich das Haus erreichte, fand ich meine Angehörigen oben – tot.«
Tess spürte, wie nahe ihm diese Erzählung ging. Sie nahm einen weiteren Stuhl unter dem kleinen Esstisch hervor und ließ sich gegenüber Devin nieder. »Tut mir leid wegen Ihrer Familie.«
»Mir auch. Um ehrlich zu sein, war der Mann mein Cousin zweiten Grades, und ich kannte sie nur flüchtig, aber zu sehen, wie sie gestorben sind, war ziemlich heftig.«
»Vielleicht waren sie klüger, als wir es sind. Hätte ich keine solche Angst vor dem Tod, würde ich mich auch umbringen.«
»Jetzt sagen Sie mir, was Sie herführt, Tess.«
»Das ist eine lange Geschichte, die ich lieber nicht noch einmal durchleben möchte.«
»Können Sie mir dann wenigstens sagen, was gerade vor sich geht? Gibt es irgendetwas Neues, kümmert sich die Regierung darum, wieder für Ordnung zu sorgen? Wird vielleicht gerade ein Impfmittel entwickelt?«
»Diese Fragen lassen sich leicht beantworten: Da draußen ist alles im Arsch. Die Regierung, beziehungsweise das, was von ihr übrig geblieben ist, hat sich im Land verstreut, in Bunkern verkrochen; ein Teil der Bevölkerung, die immun ist, wurde in Lagern eingepfercht, und was einen Impfstoff angeht: Rechnen Sie nicht damit.«
»Wissen Sie was? Sie sind mir keine große Hilfe. Ich begreife überhaupt nicht, wovon Sie sprechen.«
»Ich bin jedenfalls draußen im Stall gewesen und habe dort herumgestöbert; wie es aussah, hausen Sie dort, aber wieso?«
Devin verwies mit einem Blick an die Decke ins Obergeschoss.
»Weil sie tot sind? Warum haben Sie sie nicht einfach begraben?«
»Als ich hier eintraf, stank es erbärmlich nach Verwesung, und ich brachte es nicht übers Herz, später noch einmal herzukommen …«
Tess starrte ihn an. Dass er nicht imstande war, etwas zu tun, das ihr ganz leicht vorkam, überraschte sie.
»Was denn? Weshalb glotzen Sie mich so an?«, fragte Devin.
»Sie haben sie in gewisser Weise als Verwandte betrachtet, es aber nicht fertiggebracht, sie zu begraben? Sie konnten ihnen nicht den Respekt entgegenbringen, der ihnen als Angehörigen Ihrer Familie gebührt?«
»Ich … ach …«
»Alles klar«, sagte sie und stand vom Tisch auf.
»Werfen Sie mir das nicht vor.«
Sie drehte sich um. »Doch, das tue ich. Sie mögen zwar so lange überlebt haben, sollten aber wissen, dass Sie dabei nur Glück hatten. So viele Menschen sind gestorben, die Welt ist praktisch tot. Die wenigen von uns, die übrig bleiben, führen sich auf wie verdammte Tiere. Sie hatten die Chance, ein wenig Menschlichkeit zu beweisen, wären Sie bereit gewesen, Ihre Familie zu bestatten, ließen sich aber von Ihrem Egoismus leiten. Nur ein einziges Mal möchte ich einen Immunen finden, der noch ein humanes Verhalten an den Tag legt.«
Nachdem sie ihre Tirade beendet hatte, wandte sie sich wieder von ihm ab. Während sie weitere Dosen in ihren Rucksack stopfte, überdachte er die zahlreichen Antworten, die ihm unterdessen in den Sinn kamen.
Mehrere Augenblicke vergingen in unbeholfener Stille, ehe er aufmerkte: »Sie nicht begraben zu haben, bereitet mir wirklich Gewissensbisse. Kein Tag verging, an dem ich nicht daran dachte, bloß wollte ich nicht krank werden. Ich weiß nicht genau, warum Tom seine Familie und sich selbst umgebracht hat. Keine Ahnung, ob sie sich mit dem Virus infiziert hatten, sodass er schlicht beschloss, ihnen allen ein schnelles Ende zu bereiten; klar, diese Rechtfertigung lässt zu wünschen übrig, aber ich wollte es mir eben nicht selbst einhandeln.«
»Das können Sie gar nicht, niemals.«
»Warum sind Sie sich da so sicher?«
Sie drehte sich wieder zu ihm um und erklärte: »Weil wir alle infiziert sind. Falls Sie eine Woche nach dem Ausbruch mit irgendjemandem Kontakt hatten, steht so gut wie hundertprozentig fest, dass Sie dabei an einen Kranken gerieten.«
»Ich verstehe nicht.«
»Sie sind immun, genauso wie ich und Brando dort drüben.«
»Immun?«
»Der Tod verbreitet sich schnell; Sie werden angehaucht oder lediglich berührt, schon sind Sie infiziert. Fasst ein Träger des Virus einen Türgriff an, bleibt es daran haften, bis jemand ihn sterilisiert. Der Tod ist das wirksamste Virus, das je entwickelt wurde.«
»Sie sagen entwickelt?«
»Ja, also gut, ich weiß nicht genau, ob das stimmt, doch einige Überlebende dort draußen glauben, die Regierung habe es sich ausgedacht, um das Bevölkerungswachstum zu regulieren, und als es unters Volk gebracht wurde, seien unbeabsichtigte Folgen daraus erwachsen – die Auslöschung allen Lebens.«
»Das kann ich nicht glauben. Eine derart abstruse Verschwörungstheorie zu glauben, ist mir einfach zuwider.«
»Dann sagen Sie mir, woher es stammt«, forderte Tess trotzig.
»Ich vermute, es kommt von dem Einschlag des Asteroiden; es stammt aus dem Weltall.«
»Außerirdische oder Weltraumkeime, das ist eine weitere Theorie, aber spielt das wirklich eine Rolle? Es ist passiert, wir haben es überstanden und wollen weiterleben.«
»Ich schätze, Sie haben recht.«
Nachdem sie den leichtgewichtigen Armeerucksack gefüllt hatte, stellte sie ihn mit ihrem Gewehr neben die Hintertür und ging rasch nach draußen.
Devin wusste nicht, wohin sie wollte, aber es war ihm eigentlich auch egal. Er blieb auf dem Stuhl sitzen und ließ sich durch den Kopf gehen, was passiert war, nicht zu vergessen die seltsamen Offenbarungen, die Tess ihm gemacht hatte.
Die Schatten wurden länger, als die Sonne im Westen unterging. Er sah nicht vor, im Haus zu übernachten, und konnte sich nicht vorstellen, wo sie dies zu tun gedachte.
Die Antwort auf diese Frage erhielt er, als sie zurückkehrte – mit einer Schaufel.
»Ich schlafe hier drinnen«, sagte sie, »aber erst begraben Sie Ihre Verwandten.«
Er sah sie mit hochgezogenen Augenbrauen an.
»Hier.« Sie hielt ihm die Schaufel hin.
»Denken Sie daran, mein Arm ist verletzt.«
»Aber nicht gebrochen, es ist nur eine Fleischwunde. Los jetzt.«
Er hielt ihrem Blick stand. »Meinen Sie das ernst?«
»Es ist an der Zeit, dass Sie aufhören, sich wie eine Memme zu benehmen, und tun, was sich gehört.«
Er hatte ihr einen der Hauptgründe dafür vorenthalten, warum er seine Angehörigen nicht begraben wollte: Wenn er sich mit den Leichen befasste, erkannte er die Realität all der Tode an – insbesondere Cassidys.
»Warum legen Sie solchen Wert darauf? Ich dachte, Sie wollten sowieso morgen verschwinden.«
Sie zog den Reißverschluss ihrer Lederjacke hinunter und hielt die rechte Seite auf.
Devin machte große Augen, als er den Blutfleck auf dem weißen T-Shirt sah, das unter Tess’ Panzerweste herausragte.
»Oh mein Gott, geht es Ihnen gut?«
»Ja, ich werd’s überleben.«
»Wurden Sie angeschossen?«
»Ja, doch ich habe die Wunde sauber verbunden, nachdem sie versorgt war. In erster Linie brennt es heftig. Ich möchte einfach nur einen Tag irgendwo zur Ruhe kommen.«
Er blickte auf die Schaufel und erhob sich. Dann packte er sie am Griff und sagte: »Suchen wir eine Stelle und bringen es hinter uns.«
Tess klopfte die frisch aufgeschüttete Erde der Gräber von Tom und dessen Familie fest. Nachdem sie dies sorgfältig erledigt hatte, legte Devin einige Spielsachen der Kinder an die Kopfenden; einen großen Plüschhasen für das Mädchen und einen langen, gelben Tonka-Laster für den Jungen.
Als sie endgültig fertig waren, betrachteten die beiden die Erdhaufen. Schließlich sahen sie einander an.
»Möchten Sie etwas sagen?«, fragte Tess.
Devin fand es nur angemessen, ein Gebet zu sprechen. »Sicher.« Er faltete die Hände und senkte den Kopf.
Sie tat es ihm gleich.
»Tom, ich verlor dich nach unserer Kindheit aus den Augen, konnte aber sagen, dass du ein guter Mensch, Vater und Ehemann warst. Ich bedaure, dass dies geschehen ist und du glaubtest, keine andere Wahl zu haben. Wäre ich bloß früher hergekommen, vielleicht hätten wir dann eine bessere Lösung finden können. Egal, ich werde stets an dich und deine liebe Familie denken. Amen.«
Tess hob den Kopf und schaute Devin an. Was er gesagt hatte, beeindruckte sie und kam ihr aufrichtig vor.
»Hoffentlich war das gut«, bemerkte er verlegen.
»Es war wunderbar.«
Lager 13 der Katastrophenschutzbehörde, Region VIII, 50 Meilen östlich des internationalen Flughafens von Denver
Das Verwaltungsgebäude zählte zu einer Reihe teilweise feststehender Einrichtungen. Man erreichte sie nur, nachdem man einen Wust aus Stacheldraht, Sandsäcken und Absperrelementen hinter sich gebracht hatte.
Hielt sich Lori vor Augen, wie gut geschützt und bewacht der Verwaltungsbereich und die anderen Gebäude des Lagerpersonals waren, wurde sie das Gefühl nicht los, dass etwas im Argen lag, doch sie verdrängte den Gedanken rasch wieder.
Vasquez führte sie an den üppigen Sicherheitsvorrichtungen vorbei zu ihrem Bestimmungsort, dem Büro der Direktorin für Lagerneueinteilung.
»Warten Sie hier. Gehen Sie nirgendwohin, verstanden?«, schnaubte er.
Sie sah ihn verächtlich an.
Vasquez war schwer zu durchschauen. Viele in Quadrant 4 hielten ihn für arrogant und grausam. Es war nicht so, dass er Aggression gezeigt oder die Menschen gar misshandelt hätte, nur ging ihm jegliches Mitgefühl ab, und er schien sowohl seine Position als auch die Bewohner des Lagers zu hassen.
Jetzt verschwand er über den Korridor.
Lori schaute sich in dem trostlos aussehenden Wartebereich um. Dem Raum fehlte jegliche Ausschmückung; die getäfelten Wände waren einfach stumpf grau gestrichen, und weder die weiße Zwischendecke noch das gelbe Licht der Halogenlampen verbesserten den insgesamt schauderhaften Eindruck, den der Raum hinterließ, was Loris bange Vorahnung noch verschlimmerte.
Neben ihr ging eine Tür auf, und heraus kam eine Frau.
»Lori Roberts?«
»Ja.«
»Hi, ich bin Yvonne Foley, Direktorin für Lagerneueinteilung.«
»Hallo«, erwiderte Lori befangen.
»Bitte treten Sie ein und nehmen Sie Platz«, fuhr Yvonne fort, indem sie auf einen Stuhl vor ihrem Schreibtisch zeigte.
Lori stand auf, ging an ihr vorbei und setzte sich.
Nachdem die Direktorin die Tür geschlossen hatte, ging sie zu ihrem Sessel und begann: »Ich weiß, Sie fragen sich, warum Sie hier sind.«
»So ist es, das frage ich mich tatsächlich.«
Yvonne ließ sich nieder, klappte einen Registerordner auf und fing an, darin zu blättern.
Lori beugte sich nach vorne und sah ihren Namen auf einem Karteireiter.
»Mrs. Roberts – oder darf ich Sie Lori nennen?«
»Lori ist gut, ja.«
»Danke. Ich mag das, so wirkt es … weniger förmlich.«
Lori war eine findige Architektin, und einer der Gründe dafür, dass sie in ihrem Beruf herausragend war, bestand in ihrem Auge für Details. Sie betrachtete Yvonne, den Schreibtisch und die Umgebung, wobei sie auf Einzelheiten achtete, die sie darauf stoßen mochten, weshalb sie hier war oder was außerhalb des Lagers vor sich ging. Informationen waren wertvoll, zumal niemand genau wusste, was passierte. Auch Yvonnes Kleidung gab ihr vielleicht Hinweise. Der Tisch und das Büro insgesamt entsprachen dem Wartebereich dahin gehend, dass sie bar jeglicher hervorstechender Merkmale oder Farben waren. Der Raum hatte die gleichen tristen Wände und eine weiße Rasterdecke, während das Möbel aus schiefergrauem Metall bestand. Die einheitlichen Mauern waren abgesehen von einer einzelnen Uhr auf einer Seite kahl, und die ließ sich nicht gebrauchen, weil sie die falsche Zeit anzeigte. Neben einem Stapel weiterer Ordner stand eine einsame Lampe auf dem Tisch. Lori fielen aber auch die drei Aktenschränke hinter Yvonne auf; sie konnte sich nur vorstellen, welche Fülle an Informationen sie enthielten.
»Ich komme gleich zur Sache. Heute Morgen erwähnte Lagerkommandant Brockman, dass Camp Sierra expandiert. Das ist eine großartige Neuigkeit für alle, doch wenn etwas größer wird, geht dies auch mit wachsenden Sorgen einher. Wir benötigen im Rahmen dieser Expansion mehr Hilfskräfte, verstehen Sie? Dazu zählen auch Architekten, Fachleute wie Sie.«
Lori schluckte und wartete darauf, das Eine zu hören, von dem sie nie geglaubt hatte, es komme ihr einmal zu Ohren: Die Erlaubnis, von hier wegzuziehen.
»Lori, aus diesen Seiten geht hervor, dass Sie Architektin sind und sogar zum Führungspersonal eines Unternehmens gehörten. Das ist einfach klasse.«
»Sie lassen uns also von hier fort?«
Yvonne blickte von dem Ordner auf und erwiderte: »Uns?«
»Sie haben mich doch herbestellt, um mir zu sagen, dass meine Familie und ich ausgesucht wurden, um nach Camp Sierra zu ziehen, oder?«
»Nein, nein, Ihre Familie wird Sie nicht dorthin begleiten, und überhaupt werden Sie noch nirgendwohin ziehen. Wir schicken Sie zum DIA; dort werden Sie mit einem Team arbeiten, das wir zusammengestellt haben.«
»Das begreife ich nicht. Was meinen Sie damit, meine Familie wird mich nicht begleiten, und was ist der DIA?«
»Lori, Sie sehen aufgebracht aus. Ich darf Ihnen versichern, alles wird gut werden. Freuen Sie sich; Sie wurden auserwählt, um uns beim Wiederaufbau zu helfen. Das ist eine Riesengelegenheit für Ihre Familie und Sie.«
»Ich kann sie nicht verlassen, verstehen Sie das?«
»Bitte beruhigen Sie sich, es gibt keinen Grund zur Aufregung«, entgegnete Yvonne.
»Was wird hier gespielt? Da ist doch was faul; wohin bringen Sie mich?«
»Mrs. Roberts, glauben Sie mir, alles ist in bester Ordnung. Wir brauchen Fachpersonal wie Sie, um Pläne zur Erweiterung von Camp Sierra zu entwerfen, das ist alles. Das Team, dem wir dieses Projekt anvertrauen, wird an den DIA ausgelagert, das ist die Abkürzung für den internationalen Flughafen von Denver.« Yvonne betonte dies ausdrücklich, aber im ruhigen Tonfall.
Lori konzentrierte sich auf sie und versuchte, irgendetwas anhand ihrer Körpersprache zu deuten.
»Sie müssen heute Nachmittag zum Aufbruch bereit sein.«
Obwohl sie in Gedanken verschiedene Szenarien durchspielte, beruhigte sie sich letzten Endes und begann, logisch zu denken. Hiermit tat sich eine Möglichkeit auf, das Lager zu verlassen, und falls alles gut ging, würde man ihr erlauben, mit David und Eric nach Camp Sierra überzusiedeln.
»Wie lange werde ich fort sein?«
»Das ist noch nicht sicher und hängt vor allem davon ab, wie schnell Ihr Team mit dem Projekt voranschreitet.«
»Ah, okay, aber warum darf meine Familie nicht mitkommen?«
»Wie in jedem Lager und jeder Noteinrichtung auf dem Kontinent verfügen wir hier nur über begrenzte Mittel und können deshalb nicht jeden versetzen, doch der Hauptgrund besteht darin, dass Sie sich auf Ihre Aufgabe konzentrieren sollen. Ihre Teilnahme ist wichtig.«
»Tut mir leid, aber ich muss nachhaken: Warum ich – abgesehen davon, dass Sie Architekten brauchen?«
»Ihr Fachgebiet war Städteplanung, und genau aus diesem Bereich suchen wir jemanden. Lori, viele Menschen haben ihre Leben gelassen; es gibt einfach nur noch wenige Experten wie Sie dort draußen, und Ihr…«
»Was?«
Yvonne schaute wieder auf und wich aus: »Ach, nichts eigentlich.«
»Was bedeuten diese Zahlen?«, fragte Lori mit Blick auf eine Tabelle, die sie in ihrer Akte sah.
»Es ist eine Liste Ihrer Blutwerte, die wir nach Ihrer Ankunft hinterlegt haben.«
Das beunruhigte Lori. »Ist damit alles in Ordnung?«
»Ja, alles bestens«, versicherte Yvonne und schlug den Ordner zu. »Wir brauchen Sie für dieses Projekt. Wie gesagt, Sie sollten sich freuen. Sie wurden ausdrücklich wegen Ihrer Fähigkeiten und Ihrem persönlichen Wesen ausgewählt. Vertrauen Sie mir, das ist etwas Gutes für Sie und Ihre Familie.«
Lori dachte noch einmal über die Gelegenheit nach. Sie hoffte nur, diese Erklärung ergebe Sinn, denn ansonsten hätte sie nicht gewusst, wie sie es David und Eric unterbreiten sollte.
»Haben Sie noch weitere Fragen?«
»Kann ich mit meinem Mann und meinem Sohn Kontakt halten, während ich weg bin?«
Yvonne zögerte, bevor sie antwortete: »Ich wüsste nicht, was dagegen spräche.«
»Gut. Das ist wirklich gut, danke«, erwiderte Lori und zwang sich zu einem verkniffenen Lächeln.
»Ich danke Ihnen, Lori. Bitte melden Sie sich wegen der Abreisebestimmungen um 16 Uhr im Big Red.«
»Ich werde da sein, besten Dank.«
»Das wäre dann alles, ich wünsche Ihnen eine sichere Reise«, sagte Yvonne, ohne aufzuschauen, und notierte sich etwas auf der Akte.
Lori verließ das Büro und schloss die Tür, ehe sie tief durchatmete.
Die widersetzlichen Empfindungen, mit welchen sie die ganze Zeit gehadert hatte, begannen nun, sich körperlich zu äußern. Sie fing an zu zittern.
Laute Stimmen weiter unten auf dem Flur machten sie hellhörig. Um herauszufinden, was los war, ging sie langsam auf den Lärm zu. Anhand des Tonfalls erkannte sie, dass sich mehrere Männer stritten, doch erst als sie eine halb offene Tür erreichte, verstand sie, was genau geschah: Sie warf einen zaghaften Blick in einen Kontrollraum, wie es aussah. Dort waren an der gegenüberliegenden Wand Monitore und Anzeigetafeln montiert, auf denen sie in einigen Einstellungen Bereiche aus ihrem Quadranten wiedererkannte.
Die Männer brachen in Gelächter aus. Was Lori wie eine erhitzte Debatte vorgekommen war, entpuppte sich als schlichte Alberei. Da ihr die Männer den Rücken zukehrten, konnte sie sie nicht identifizieren. Dann fiel ihr ein Bild ins Auge, das sie entsetzte, den Männern aber anscheinend eine sadistische, groteske Form von Unterhaltung bot; sie lachten und grölten angesichts eines Videos einer Exekution.
Lori neigte sich so weit nach vorne, wie sie konnte, um besser zu sehen, und war umso schockierter, als sie erkannte, dass es kein Spielfilm war, sondern echt. Die Kamera zoomte auf eine Frau, die weinte und um ihr Leben flehte. Dann geschah das Fürchterliche: Ein Mann in einer Uniform ging auf sie zu und schoss ihr in den Kopf. Als Lori dies sah, schluchzte sie auf.
Die Männer im Raum hörten mit dem Lachen auf und schauten einander an.
»Habt ihr das gehört?«, fragte einer, stand auf und drehte sich zur Tür um.
Lori schaute nach links und rechts, um sich zu entscheiden, wohin sie laufen sollte. Da sah sie eine Toilette, keine zehn Schritte weiter, und stürzte darauf zu. Ihr Herz raste; sie huschte in eine Kabine und verriegelte die Tür.
»Nein, nein, nein, du hast das gar nicht gesehen. Es muss ein Film oder so gewesen sein«, sagte sie mehrmals leise vor sich hin.
Die Toilettentür ging mit einem Knarren auf, und eine Männerstimme fragte: »Irgendjemand hier drin?«
Lori geriet in Panik; sie hob die Beine und zog sie an, damit er ihre Füße nicht sah.
Als der Mann eintrat, knirschten Sandkörner und Schottersplitter unter seinen harten Schuhsohlen. Sie hörte, wie er noch ein paar Schritte näherkam und dann stehen blieb. Ihr rasender Puls rauschte in ihren Ohren. Sie bereitete sich darauf vor, fliehen zu müssen, wusste aber nicht, wohin.
Der Mann kam einen weiteren Schritt näher, da knarrte die Tür erneut.
»He, Thomas, hör auf, so herumzuschleichen, der Kommandant will mit dir reden«, sagte eine andere Männerstimme.
»Okay, ich komme«, entgegnete der Erste, drehte sich um und ging hinaus.
Nachdem er die Tür geschlossen hatte, holte Lori mehrmals tief Luft und dachte: Was ist hier nur los?
Decatur, Illinois
Die Sonne war schließlich hinterm Horizont verschwunden und die Dunkelheit brach herein. Nun, da sie Devins Verwandte beerdigt hatten, galt es, sich ins Haus zurückzuziehen.
»Ich nehme das Zimmer des Mädchens«, beschloss Tess.
»Gut, dann schlafe ich im Gästezimmer im Erdgeschoss.«
»Gab es in der Scheune so etwas wie Draht zum Strohbinden?«, fuhr sie fort.
»Ich glaube schon, schauen Sie im Schrank an der hinteren Wand nach.«
Sie machte sich sofort auf den Weg. Da Devin wissen wollte, was sie vorhatte, folgte er ihr.
Neben dem Draht fand sie auch eine Pflanzenschere.
»Was haben Sie vor?«
»Besorgen Sie mir ein paar leere Blechdosen«, verlangte sie nur.
Er zögerte nicht, der Aufforderung nachzukommen. In der Scheune lag ein ganzer Haufen Büchsen. Sie wartete vor den Stufen des Hauses auf ihn, nahm ihm mehrere Dosen ab und stellte sie auf den Boden. Nachdem sie etwas Schotter zusammengesucht und in den Dosen verteilt hatte, zog sie den Draht durch die Zuglaschen an den Deckeln. Als sie so mehrere Dosen an je einem Stück Draht befestigt hatte, spannte sie diese auf Fußhöhe zwischen den beiden Geländern auf, jeweils einen an der untersten und oberen Stufe. Das Ganze wiederholte sie an der Treppe hinter dem Haus.
Danach trennte sie ein kürzeres Stück Draht ab und verband den inneren Griff des Fliegengitters mit dem Knauf der eigentlichen Tür. »Damit wäre dieser Eingang soweit sicher. Für Fort Knox würde es zwar nicht reichen, aber der Draht und die Dosen sollten dabei helfen, Brando aufmerksam zu machen, falls sich jemand Zugang verschaffen will.«
»Sieh an, eine echte Pfadfinderin«, feixte Devin.
»Ist doch kein Kunststück. Liegt einfach nur nahe.«
»Ja, stimmt, das tut es.«
Nachdem sie die Hintertür genommen hatten, verbanden sie das Fliegengitter wieder mit dem Knauf der Tür. Drinnen schoben sie schwere Möbel vor beide Türen.
»So langsam kommt es mir jetzt aber doch wie Fort Knox vor«, meinte Devin.
»Wir dürfen es niemandem zu leicht machen, ins Haus zu kommen. Falls wir uns verteidigen müssen …«
»Ich nehme an, Sie selbst haben das auf die harte Tour gelernt, was?«
»Ja, kann man so sagen.«
»Sagen Sie, sind Sie hungrig?«
»Ja, aber ich wasche mich und gehe zu Bett; ich bin wirklich müde. Oben werde ich eine Dose Thunfisch essen.«
»Na dann, äh … gute Nacht.«
Der Hund kam zu Tess gelaufen und wartete geduldig darauf, dass sie ihm einen Befehl erteilte.
»Bist ein braver Junge, Brando«, lobte sie. »Geh da rüber und mach Platz; halt die Ohren offen.« Sie kniete sich hin, streichelte ihn und kraulte seinen Kopf, bevor sie ihm mehrere Küsse auf die Schnauze gab.
Brando tat prompt, was sie ihm aufgetragen hatte, und verzog sich zur Haustür. Dort ging er ein paarmal im Kreis und ließ sich nieder.
»Eigenartig. Als würde er Sie verstehen.«
»Das tut er.«
Devin schmunzelte.
»Gute Nacht, wir sehen uns morgen früh.«
»Gute Nacht, Tess.«
Sie ging langsam die Treppe hinauf und verschwand im Kinderzimmer.
Devin dachte noch eine Weile über die Ereignisse des Tages nach. So viel war geschehen; er hatte ihn allein begonnen, scheinbar ziellos in seinem Tun, doch jetzt, nachdem er seiner moralischen Pflicht Genüge getan und seine Verwandten bestattet hatte, fand er sich im Haus wieder, allerdings nicht allein, zumindest fürs Erste. Er musste lächeln, denn dieser Gedanke gefiel ihm. Er war realistisch und wusste, es würde nicht von Dauer sein. Doch das bekümmerte ihn nicht. Er wollte diese Zeit genießen, bis sie vorbei war.
Lager 13 der Katastrophenschutzbehörde, Region VIII, 50 Meilen östlich des internationalen Flughafens von Denver
»David, ich kann das nicht tun. Hör mir zu, ich weiß, was ich gesehen habe!« Lori war aufgeregt.
»Ich bin mir sicher, dass du gesehen hast, was du zu sehen glaubtest, aber vermutlich war es nur ein Film oder Aufnahmen irgendeines Chaos, das außerhalb des Lagers losgebrochen ist«, entgegnete David.
»Argh!«, grollte sie und stapfte davon. Dass er ihre Theorie bezüglich dessen, was sie gesehen hatte, nicht glauben wollte, frustrierte sie.
»Lori, Schatz, bitte sei mir nicht böse. Ich bezichtige dich nicht als Lügnerin, aber denk mal darüber nach: Warum würden die jemanden grundlos hinrichten? Das ergibt keinen Sinn.« Er lief ihr nach.
»Ich weiß, was ich gesehen habe.«
»Noch mal: Ich bin davon überzeugt, dass du das tust, doch es war bestimmt ein Film oder Bildmaterial aus irgendeinem Krieg. Klar, das macht das Verhalten dieser Wachleute nicht annehmbarer, sondern im Gegenteil verachtenswert, aber ich glaube nicht, dass sie selbst etwas auf dem Kerbholz haben. Liebling, dieser Auftrag ist eine Chance für uns; er könnte uns alle hier herausholen. Bitte lass dich nicht zu diesen verrückten Verschwörungstheorien hinreißen.«
»Mach dich nicht über mich lustig. Was ich gesehen habe, war verstörend.«
»Das war es gewiss, aber das sagst du mir als Frau, die Horrorfilme und Gewaltdarstellungen hasst, denk daran.«
Innerlich aufgewühlt dachte sie darüber nach, was er gerade gesagt hatte.
»Darf ich fragen, warum du, wenn du dir da so sicher bist, fertig gepackt hast und sofort aufbrechen könntest?«, wollte er wissen.
»Genau das frage ich mich selbst auch. Was ist, wenn sie versuchen werden, mich zu töten?«
David fing an, ihre verspannten Schultern zu massieren. »Schatz, ich kann einfach nicht glauben, dass sie uns eine Unterkunft, Nahrung, Gesundheitsfürsorge und so weiter zugestehen würden, um uns dann nach draußen zu bringen und kaltzumachen. Das ist einfach unsinnig.«
Lori sah die Szene immer wieder vor ihrem geistigen Auge, nie jedoch, ohne sie zu hinterfragen, weil das Bild nicht sonderlich scharf gewesen war.
»Mag sein, dass du recht hast. Ach, ich weiß nicht … es hat mich einfach total aus der Fassung gebracht. Unheimlich echt wirkte es und war grausig, aber diese Typen fanden es witzig, das war so abartig.«
»Als Mann darf ich dir sagen, dass viele von uns so drauf sind; es ist wirklich abartig. Gäbe es keine Frauen, wären wir verloren.«
Lori schüttelte den Kopf; Zweifel an dem, was sie meinte, gesehen zu haben, bestimmten nun ihre Überlegungen.
»Was würde ich ohne deine Vernunft machen? Von uns beiden bist du derjenige, der verhindert, dass wir uns verrennen. Tut mir leid, dass ich ausgerastet bin.« Sie umarmte ihn.
Er gab ihr einen Kuss auf den Kopf. »Wir zwei haben eine Menge durchgemacht. Es war hart, aber wir haben überlebt. Jetzt erhalten wir möglicherweise die Gelegenheit, wieder ein richtiges Leben zu führen.«
Als sie auf ihre Uhr schaute, sah sie, dass es schon spät war. »Ich hol jetzt besser meine Sachen.«
»Ich helfe dir.«
Sie kehrten Hand in Hand zum Zelt zurück.
Sie schaute ihn an, um die feineren Einzelheiten seiner Züge zu verinnerlichen – mentale Schnappschüsse, anhand derer sie sich an ihn erinnern wollte. Sie wusste nicht, wie lange sie fortbleiben würde, und befürchtete insgeheim, ihn niemals wiederzusehen. So viel hatte sich verändert, sowohl für sie beide als auch die Menschheit. Sich jetzt von jemandem zu verabschieden, mochte tatsächlich ein Lebewohl für immer bedeuten. Es gab keine Garantien, und auch wenn sie es so weit geschafft hatten, war ihr schleierhaft, was sie erwarten sollte, sobald sie Lager 13 verließ. Sie drückte seine Hand fester. Diesen Moment und die innige Liebe, die sie für David empfand, durfte sie nicht vergessen.
Schließlich betrat er das Zelt. Als er zurückkehrte, kam auch Eric heraus, ihr Sohn.
Sie umarmte und küsste ihn. Nun flossen Tränen, und sie bekam Magengrummeln.
»Ich liebe dich, Mom«, sagte Eric.
»Ich liebe dich auch. Jetzt seht zu, dass ihr aufeinander achtgebt, dein Dad und du, ja?«, flüsterte sie in sein Ohr.
»Werden wir«, versprach er und drückte sie fester an sich.
Die Tränen kullerten an Loris Wangen hinunter.
Dann fing auch er an zu weinen. »Bitte beeile dich, damit du schnell wieder hier bist«, gluckste er und lief weg.
»Eric, komm zur–«, rief sie.
»Er wird darüber hinwegkommen, schließlich ist er ein zäher Bursche«, bemerkte David.
»Ich sollte nicht fahren, er braucht mich.«
»Wir wollen, dass du fährst.«
»Sicher?«
Sie wischte sich die Tränen ab und betrachtete einmal mehr Davids hübsches Gesicht.
Sie umarmten und küssten sich wieder, dann entzog sie sich, hob ihre Tasche auf und eilte zum Big Red. Ins Ungewisse.