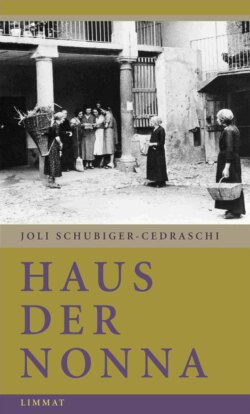Читать книгу Haus der Nonna - Joli Schubiger-Cedraschi - Страница 7
Begrüssungen. Ziu Girumín und Zia Lisa, Ziu Carlín und Zia Maria. Abfahrt des Vaters.
ОглавлениеGegen Abend, noch vor dem Nachtessen, besuchten wir Girumín, Papà und ich. Die Reihe unserer Besuche begann fast immer bei ihm. Er sass beim Feuer, mit dem Rücken gegen das Fenster, wenn wir in die Küche traten. Da das Stehen und Gehen für ihn sehr beschwerlich war, erhob er sich nicht, um uns zu begrüssen. Er freute sich aber, das sah man seinen Augen an. Papà stellte zwei Stühle zum Kamin, und wir setzten uns. Girumín sprach sehr wenig, und das wenige sehr langsam. Er rückte an seiner Schirmmütze und sagte zum Scherz einige Worte auf Zürichdeutsch. Zusammen mit Nonno Pepp hatte er in Zürich gearbeitet. Manchmal zählte er Namen von Strassen und Plätzen auf, die mir halb vertraut waren und die aus seinem Mund sehr fremdländisch tönten: Bellevueplatz, Paradeplatz, Bahnhofstrasse, Limmatquai. Dabei lachte er mich an. Er hatte sein rechtes Bein ausgestreckt und strich mit der Hand darüber hin. Manchmal hielt er auch den Stock, an dem er ging, zwischen den Knien, die Hände über dem gebogenen Griff. Er bot uns Wein an und zeigte dabei auf den Schrank, wo die Flaschen und Gläser standen. Papà goss zwei Gläser voll; ich bekam verdünnten Wein mit etwas Zucker. Das Gespräch verlief dann immer ungefähr gleich. Girumín wollte wissen, wen wir schon besucht hatten und ob wir in Zürich auch Guido, seinen Sohn, hie und da sehen würden, und Papà erkundigte sich nach dem Garten, den Girumín noch besorgte.
Später trat auch Zia Lisa, die uns aus den Reben schon einen Gruss zugeschrien hatte, in die Küche. «Da seid ihr ja», sagte sie und gab uns ihre kleine, raue Hand. Es hiess, sie arbeite wie ein Pferd, und sie sah auch aus wie ein Pferd, vor allem wenn sie, den Kopf vorgebeugt, die Locken wie eine Stirnmähne über den Augen, ihren gelben Leiterwagen hinter sich herzog. Wer dann einen Gruss von ihr wollte, musste sich ihr in den Weg stellen oder sie beinahe anbrüllen.
Jetzt kochte sie Kaffee und lud ein, uns hinüber an den Tisch zu setzen. «Mach doch erst die Stühle frei!», sagte Girumín. Sie räumte die Zeitungen weg. «Hast du nichts für die Jaale?», fragte er dann, und sie suchte im Schrank herum, bis sie schliesslich einen Pfirsich fand, der schon angefault war. Solche Mängel sah sie gar nicht. Wenn Girumín reklamierte, weil ein Glas fettig war oder tote Fliegen sich darin gesammelt hatten, dann schaute sie sich die Sache an, etwas stumpf und verwundert, nicht wie jemand, der kurzsichtig ist, eher wie jemand, der gar nichts sieht.
Ich mochte Zia Lisa sehr gern. Sie wollte nicht so viel von mir wissen, wie Erwachsene sonst von Kindern wissen wollen. Sie war bescheiden. Richetta, ihre Tochter, die im gleichen Haus wohnte, kochte immer so viel, dass es auch für die beiden Alten noch gut gereicht hätte. Doch Zia Lisa nahm kaum etwas an, nicht aus Stolz, sondern weil sie es nicht gewohnt war und es darum nicht brauchte. Milchkaffee mit ein paar Brocken Polenta oder etwas aufgewärmte Minestra genügte den Alten vollauf.
Zia Lisa war die Schwester meiner Grossmutter. Ziu Girumín und Nonno Pepp, die beiden Brüder, hatten zwei Schwestern geheiratet. Was Zia Lisa sagte und unternahm, erinnerte mich denn auch sehr an die Nonna, nur geriet bei Zia Lisa alles noch um eine Spur misstrauischer und eigensinniger.
Ziu Girumín fing an, Reste des Mittagessens auf dem Feuer zu wärmen. Papà sprach mit Zia Lisa, die jetzt auch ein Glas Wein vor sich hatte, über den Tabak, den Mais und die Trauben. Sie klagte über den Regen, der alles ersaufen lasse, oder über den fehlenden Regen oder über den miesen Frühling. Sie klagte immer. Girumín rührte unterdessen in seiner Pfanne.
Dieser Girumín, der wenig und langsam sprach, soll früher ein guter Geschichtenerzähler gewesen sein. Er war ein sehr heiterer Mensch. Mein Vater sagt, er habe Geschichten gewusst, Rittergeschichten vor allem, die so lang waren wie der ganze Winter. Ein Bovo d’Antona kam darin vor und andere Männer mit klingenden Namen. Zur Zeit Pá Cesars soll sich die ganze Familie abends im warmen Stall versammelt haben, um ihm zuzuhören. Vor dem Schlafengehen nahm Pá Cesar dann seinen Hut vom Kopf und sagte: «So, nun erzähle ich meine Geschichte.» Er meinte damit den Rosenkranz. Mein Vater, der damals noch ein kleiner Junge war, versuchte stets, ihm den Hut von hinten wieder aufzusetzen. Manchmal gelang es ihm, das Gebet auf diese Weise noch hinauszuschieben.
Am folgenden Tag besuchten wir Ziu Carlín und Zia Maria. Als ältester Sohn von Pá Cesar hatte Carlín den Hof übernommen. Er starb, als ich etwa sechs Jahre alt war. Ich erinnere mich sehr genau an seinen Kamin: eine riesige Feuerstelle mit Bänken rechts und links wie bei der Nonna. Seine Bänke aber hatten seitliche Abschlüsse, die weit über meinen Kopf hinausreichten. Wie Chorstühle sahen sie aus. Zia Maria sog etwas Schnupftabak aus der Grube hinter dem Daumen, bevor sie uns umarmte. Die Ränder ihrer Nasenlöcher waren vom Schnupfen schwarz. Sie stellte den Wein auf. Sicher sagte sie damals schon: «Quell lí l’è bun! – Der ist gut!», noch bevor mein Vater gekostet hatte. «Ja», sagte mein Vater dann, «der ist gut». Da jeder stolz war auf den eigenen Rebberg und den eigenen Keller, konnte mein Vater nur der Nonna verraten, welche Weine ihn besonders überzeugten. Auch Zia Maria wollte wissen, wem wir schon unseren Besuch gemacht hatten. Sie fragte, wie der Wein dort gewesen sei. «Ganz gut», sagte mein Vater.
Die Familien, die jetzt getrennt lebten, blieben durch eine vorsichtige Neugierde miteinander verbunden. Auf Neues war man dabei allerdings nicht so sehr aus. Wenn man nach dem Wein und den Lebensgewohnheiten der anderen fragte, wollte man viel eher immer neu bestätigt haben, dass nichts sich veränderte, dass alles so war, wie man es kannte und erwartete. Man wollte zum Beispiel hören, dass Zia Lisa den Gästen noch immer bloss einen angefaulten Pfirsich anbot. Man lächelte dann verständnisvoll und befriedigt. Einmal schenkte mir Zia Lisa frische kleine Kuchen, die man nur beim Bäcker erhielt und die sie wahrscheinlich selber geschenkt bekommen hatte. Die Nonna war fast bestürzt, als sie das sah. Auch die Fragen nach unserem Leben in Zürich wurden stets so gestellt, dass es nur eine Antwort gab: In Zürich ist es weniger schön als im Tessin, und man isst dort weniger gut.
Zia Maria war auf Pá Cesars Hof Köchin und Amme gewesen, und sie war es noch jetzt. Die Frauen hatten ihre alten Aufgaben behalten. Wie Zia Lisa ganz bei der Feldarbeit blieb, so arbeitete Zia Maria weiterhin fast nur im Hause. Sie galt als die beste Köchin der Sippe. Sogar aus der Katze des Bürgermeisters, die einer der Männer in einen Keller gelockt und dort erschossen hatte, soll sie einen guten Braten zubereitet haben. In engen Holzkäfigen hielt sie kastrierte junge Hähne, die sie mit Baumnüssen mästete. Ein solcher Kapaun, schwer im Fleisch und reich gefüllt, gehörte zum traditionellen Weihnachtsessen.
Zia Maria hütete in ihrem Hof ihre Enkel und viele andere Kinder dazu. Die Kleinsten standen mit nacktem Hintern in einem Laufgitter und pinkelten, wo es sie gerade ankam. Mitten im Spiel lief ihnen der Urin die Beine hinunter. Windeln gab es keine, wenigstens tagsüber nicht. Im Sommer stand in diesem Hof auch eine Tretnähmaschine, an der die Töchter der Zia Maria, umgeben von Kindern und Hühnern, ihre Leintücher flickten.
Zia Maria war klein und hager. Sie hatte eine lange gebogene Nase und gütige braune Augen, die zwischen den Rändern des eng gebundenen Kopftuchs hervorschauten. Ich habe sie auch im Hause nie ohne Kopftuch gesehen. Sie sass in sich zusammengezogen da in ihren weiten Röcken. Um den feinen Körper herum trug sie erstaunlich viel Stoff, der dann beim breitbeinigen Gehen ins Schwingen kam. «Habt ihr Giovann besucht?», fragte sie. Giovann ist ihr Sohn, der im Nachbardorf Stabio wohnt. Papà versprach, am nächsten Tag mit mir hinzugehen und auch beim Pfarrer, an den sie uns erinnerte, anzuklopfen. Später, als Ziu Carlín tot war, fragte sie regelmässig: «Habt ihr Carlín schon besucht?» Auch die Toten wollten begrüsst und regelmässig aufgesucht sein. Mindestens einmal wöchentlich waren wir auf den Gräbern. Nie hätte jemand gesagt: «Ich war auf dem Grab von Carlín.» – «Ich war bei Carlín» genügte; jedermann wusste ja, wo er sich aufhielt.
Dieser Runde von Begrüssungsbesuchen schlossen sich dann, an Ostern 39, gleich die Abschiedsbesuche meines Vaters an. Er reiste wieder nach Zürich und liess mich für zweieinhalb Jahre bei seiner Mutter zurück.
Er fuhr mit der Post weg. Sicher hatten sich wie üblich Verwandte und Freunde vor dem Postgebäude versammelt, hatten kleine Geschenke mitgebracht, die mein Vater nur mühsam in irgendeinem Gepäckstück noch unterbrachte. Wer zufällig vorbeikam und die Wartenden sah, blieb stehen und fragte: «Chí salta sü? – Wer steigt ein?» Nach und nach bildete sich auf diese Weise eine zweite Schar von Menschen, die im Hintergrund den Abschied mitverfolgten und kommentierten. Beladen mit Koffer und Schachteln und mit Grüssen und Wünschen versehen, bestieg mein Vater schliesslich das Postauto. Die Nonna hatte ihm einen Stoffsack mit gemahlenem Mais mitgegeben, Eier, die sie in den letzten Tagen zurückbehalten hatte, Würste des Dorfmetzgers und eine Flasche Grappa.