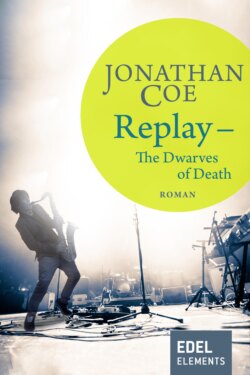Читать книгу Replay - The Dwarves of Death - Jonathan Coe - Страница 7
Erstes Thema
ОглавлениеBoy afraid
prudence never pays
and everything she wants costs money
Morrissey,
»Girl Afraid«
Warum nur kann ich die Musik von Andrew Lloyd Webber einfach nicht ausstehen? Ich denke, es ist der gleiche Grund, aus dem ich London nicht ausstehen kann: weil sie mittelmäßig ist und die Leute trotzdem in Scharen kommen, als wäre sie das einzige auf der Welt, was man unbedingt erleben muß. Zum Beispiel die Vorstellung vom »Phantom der Oper«. Es war an einem Donnerstagabend, mehr als zwei Wochen vor den Ereignissen, die ich bereits geschildert habe. Ich hatte Madeline seit Tagen nicht gesehen, und ich freute mich wirklich darauf, wieder mit ihr zusammenzusein. Eigentlich hätte es ein schöner Abend werden müssen; statt dessen wurde er eine Katastrophe. Und an allem war bloß dieser Scheißkerl schuld.
Es gibt Leute, die Andrew Lloyd Webber vorwerfen, er würde die Melodien anderer Leute klauen, aber damit traut man ihm immerhin eine gewisse Unverfrorenheit zu, die ihn interessanter machen würde, als er eigentlich ist. Zugegeben, eine von den Kadenzen in »Think of Me« klingt haargenau wie Puccinis »O Mio Bambino Caro«; und es gibt da tatsächlich eine wiederkehrende Phrase, die zweifellos aus Prokofjews »Aschenbrödel« abgekupfert wurde. Aber ich bin der Überzeugung, daß hier eine noch ausgeprägtere Form von Unoriginalität am Werke ist. Musikalische Ideen, die Lloyd Webber neu erscheinen, waren vor fünfzig, sechzig, siebzig Jahren einfach allgemein verbreitet. Kein Wunder, daß ihm irgendwelche Spinner Aufnahmen von ihren eigenen Kompositionen schicken und behaupten, er hätte sie plagiiert: Tumbe Menschen liegen meist auf derselben Wellenlänge, und jeder, der auch nur ansatzweise ein Ohr für Melodien hat, könnte so ein Zeug produzieren. Und dann rührt er das alles zusammen, ohne sich um Stil, Zeit oder Genre zu scheren – Elemente aus einer Pastiche-Operette führen zu Passagen stupider Rockmusik (inklusive Drum-Machine), und eine absurde, schauerlich klingende Orgel (genauer gesagt eine DX 31) spielt unaufhörlich genau die chromatischen Tonleitern rauf und runter, die nach der Auffassung eines jeden Teenagers in den Soundtrack eines Horrorfilms gehören. Und das Publikum schluckt das alles einfach so. Die Leute finden es toll. Ein Phänomen, das mir einfach unbegreiflich ist.
Und was für eine Mühe, was für ein lächerliches, zermürbendes Theater hatte ich durchmachen müssen, nur um mir diesen ausgemachten Mist anzuhören. Habt ihr überhaupt eine Vorstellung davon, wie schwer es ist, an Karten für das Musical ranzukommen? Hatte Madeline, so fragte ich mich, überhaupt eine Vorstellung davon, als sie den Vorschlag machte? Nachdem ich immer wieder an der Theaterkasse nachgefragt hatte, wurde mir schließlich gesagt, ich hätte die besten Chancen, wenn ich am Tag der Vorstellung vorbeikäme, und zwar früh. Also reihte ich mich um fünf Uhr morgens in die Schlange – fünf Uhr, ihr habt richtig gelesen –, hinter eine Gruppe japanischer Geschäftsleute, und ich blieb bis fast halb elf (womit ich zwei Stunden zu spät zur Arbeit kam), nur um erleben zu dürfen, daß die letzten Karten an die Leute gingen, die fünf Plätze vor mir in der Schlange standen. Also rief ich dann in meiner Mittagspause eine Theateragentur an, wo man mir sagte, daß sie tatsächlich noch ein paar Karten hatten – zurückgegebene oder so –, aber ich könne sie nur bekommen, wenn ich persönlich vorbeikäme und sie direkt bezahlte, und dann fischten sie sie unter der Theke hervor, und ich mußte neunzig Pfund hinblättern (mir wird schlecht, wenn ich nur daran denke), für zwei Plätze. Sie können sich also vorstellen, in welcher Stimmung ich war, als ich mich mit Madeline am Theater traf, und es wurde auch nicht besser, als wir unsere Plätze einnahmen – die übrigens gar nicht schlecht waren –, denn kurz bevor die Vorstellung anfing, tauchte ein Zweimeterriese auf und setzte sich direkt vor mich, so daß ich den ganzen Abend nichts anderes zu sehen bekam als seine dicke, fette Smokingjacke und seinen pickeligen Nacken. Von der Vorstellung sah ich nicht das geringste. Ich hätte genausogut zu Hause bleiben und mir die Platte anhören können.
Nicht, daß ich besonders auf die Musik geachtet hätte, um ehrlich zu sein. Eine Verabredung mit Madeline war immer etwas ganz Besonderes, und fast die ganze Zeit dachte ich daran, was wir anschließend machen würden, ob wir was trinken gehen würden, was ich zu ihr sagen würde, ob ich sie würde küssen dürfen. Ich bin sicher, daß schon bessere Komponisten als Andrew Lloyd Webber darunter gelitten haben, daß Musicals und Konzerte zu zehn Prozent Kunstwerke sind und zu neunzig Prozent Zwischenstationen beim Paarungsritual. Es ist schon komisch, wenn man sich vorstellt, wie beispielsweise Debussy über der Orchestrierung irgendeiner Taktfolge in »Pelleas et Melisande« gebrütet hat, ohne daran zu denken, daß die meisten Männer im Publikum nur mit der Frage beschäftigt sein würden, ob sie wohl Erfolg haben, wenn sie eine Hand auf das Knie ihrer Freundin legen, eine Frage, die sie so beschäftigt, daß die Musik ihnen schnurzegal ist. Was soll man machen, das ist nur natürlich. Jede ihrer Bewegungen, jede noch so kleine unbewußte Geste war für mich interessanter als alles, was auf der Bühne passierte (wovon ich ohnehin nichts sehen konnte). An der Stelle zum Beispiel, wo angeblich allen der Atem stockt, wenn der Kronleuchter plötzlich von der Decke runterkommt, wischte Madeline sich über die Wange, was viel aufregender war. Ich registrierte auch die kleinste Veränderung des Abstandes zwischen uns. Jedesmal, wenn sie sich in meine Richtung lehnte, schlug mein Herz schneller. Einmal beugte sie sich nach vorn und näher zu mir herüber, und ich dachte schon, mein Gott, gleich berührt sie mich. Aber ihr war der Schuh vom Fuß gerutscht, und sie wollte ihn bloß wieder anziehen.
Ich glaube, alles war besser, als diesem Mist wirklich zuzuhören.
Dann kamen der tosende Applaus und die Schlange zum Ausgang, und wir gingen im Gedränge die Treppe hinab und waren plötzlich draußen, mitten in einer naßkalten und lauten Londoner Nacht. Taxis und Busse fuhren im Schritttempo vorbei, ihre Reifen platschten und zischten, ihre Scheinwerfer spiegelten sich auf der Straßendecke.
Ich dachte, was soll’s, und hakte mich bei Madeline unter. Wie üblich widersetzte sie sich weder, noch ermutigte sie mich. Sie ließ meinen Arm lediglich da, wo er war, und ich hatte nicht den Mut, noch weiterzugehen und ihre Hand zu nehmen. Wir gingen seit fast sechs Monaten miteinander.
»Tja ...«, sagte ich schließlich, als wir ohne besonderen Grund in Richtung Piccadilly Circus schlenderten.
»Hat’s dir gefallen?« fragte sie.
»Dir?«
»Ja. Sehr. Ich fand es wunderbar.«
Ich drückte ihren Arm.
»Du hast einen guten Sinn für Humor«, sagte ich.
»Was meinst du?«
»Das mag ich so an dir. Deinen Humor. Ich meine, wir können zusammen lachen. Du sagst was Ironisches, und ich weiß genau, wie du das meinst.«
»Das war nicht ironisch gemeint. Es hat mir wirklich gefallen.«
»Da, schon wieder. Doppelte Ironie, find ich herrlich. Weißt du, es ist toll, wenn zwei Menschen den gleichen Humor haben, das ... sagt wirklich was über sie aus.«
»William, ich meine das nicht ironisch. Es hat mir heute abend gefallen. Es war ein schönes Musical. Verstehst du?«
Wir waren stehengeblieben. Wir hatten uns voneinander gelöst und blickten einander an.
»Meinst du das ernst? Das hat dir gefallen?«
»Ja, dir etwa nicht? Was war denn daran nicht in Ordnung?«
Wir gingen weiter. Diesmal getrennt.
»Die Musik war oberflächlich und durchschnittlich. Harmonisch primitiv und melodisch zweitklassig. Die Handlung basierte auf billigen emotionalen Effekten und blankem Pathos. Die Inszenierung war protzig, kitschig und zutiefst reaktionär.«
»Du meinst, es hat dir nicht gefallen?«
Einen Moment lang blickte ich direkt in ihre traurigen, grauen Augen. Aber ich schüttelte dennoch den Kopf.
»Richtig, es hat mir nicht gefallen.« Wir gingen schweigend weiter. »Ich meine, was hat dir denn daran gefallen?«
»Ich weiß nicht. Wieso mußt du immer alles analysieren? Es war ... es war schön.«
»Toll. Verstehe. Sag mal, was hast du eigentlich mit der Einladung zum ›Critics’ Forum‹ gemacht? Bist du hingegangen?«
»Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich bin nirgendwohin eingeladen worden.«
»Merkst du nicht, wenn ich was ironisch meine?«
»Nein.«
Wir waren fast am Piccadilly Circus. Vor einer Pizzeria blieben wir stehen. Mir war klar, daß ich sie verärgert hatte, aber ich konnte mich nicht dazu durchringen, irgend etwas dagegen zu unternehmen.
»Was möchtest du jetzt machen?« fragte ich.
»Ist mir egal.«
»Möchtest du was trinken gehen?«
»Ist mir egal.«
»Los, komm.« Ich hakte mich wieder bei ihr ein und führte sie in Richtung Soho. »Weißt du, es wäre schön, wenn du ab und zu mal eine Meinung äußern würdest. Es würde alles einfacher machen. Statt alle Entscheidungen mir zu überlassen.«
»Gerade eben habe ich eine Meinung geäußert, und du hast dich über mich lustig gemacht. Wohin gehen wir überhaupt?«
»Ich hab gedacht, wir gehen ins Samson’s. Einverstanden?«
»Von mir aus. Du willst wieder deinen Freund spielen hören, nicht ?«
»Kann sein, daß er heute abend da ist, ich weiß nicht.« In Wirklichkeit hatte Tony mich noch am Tag zuvor angerufen. Ich wußte ganz genau, daß er an dem Abend dort spielen würde. »Mußt du ihn ›meinen Freund‹ nennen? Du weißt doch, wie er heißt, oder?«
Ich war so sehr in Madeline verliebt, daß ich manchmal bei der Arbeit anfing zu zittern, wenn ich nur an sie dachte: Ich erbebte vor Panik und Freude, so daß ich Stapel von Schallplatten und Kassetten fallen ließ und ein heilloses Durcheinander anrichtete. Daher störte es mich auch nicht weiter, daß wir uns nie besonders gut verstanden. Mich mit Madeline zu streiten war für mich reizvoller, als mit irgendeiner anderen Frau auf der Welt zu schlafen. Die Vorstellung, zusammen mit ihr glücklich zu sein – also im selben Bett zu liegen, schweigend und halb eingeschlafen –, erschien mir so unglaublich schön, daß ich es mir nicht mal ansatzweise ausmalen konnte. Im Grunde meines Herzens war ich sicher, daß es niemals dazu kommen würde, und so schätzte ich mich schon glücklich genug, mit ihr an einem kalten Winterabend im übleren Teil von Soho kleine Nervereien auszutauschen. Ich bezweifle, daß sie dasselbe empfand; aber was genau empfand sie eigentlich?
Sie war immer ein Rätsel für mich, und ich werde mich nicht zu der abartigen Theorie versteigen, daß das Teil ihrer Anziehungskraft auf mich war. Es ging mir ungemein auf die Nerven. Solange ich Madeline kannte, hatte ich immer das Gefühl, daß sie nicht dazugehörte – nicht zu mir, nicht zu London, nicht zum Rest der Welt. Es fiel mir auf, als ich sie das erste Mal sah: Sie wirkte so fehl am Platz in der düsteren Bar, wo ich Klavier spielte. Ich war seit einem Jahr in London, und ich hatte gedacht, der Job würde mir eine erste richtige Chance bieten. Eine Kneipe in einer Seitenstraße der Fulham Road, die einen schäbigen Stutzflügel hatte und sich »Jazzclub« nannte: Ich hatte eine Anzeige in »The Stage« gelesen, und sie boten mir zwanzig Pfund auf die Hand und drei alkoholfreie Cocktails meiner Wahl, und ich sollte an einem Mittwoch abend spielen. Ich war um sechs Uhr da und hatte ganz schön Fracksausen, weil ich fünf Stunden spielen sollte, und das mit einem Repertoire von fünf Standardstücken und ein paar eigenen Songs – Material, das gerade mal für fünfzig Minuten reichte. Meine Sorge war unbegründet, denn den ganzen Abend war nur ein einziger Gast da, eine Frau, die um acht Uhr kam und bis zum Schluß blieb. Es war Madeline.
Ich konnte es gar nicht fassen, daß eine so gut gekleidete und so hübsche Frau den ganzen Abend allein in einer solchen Kaschemme verbrachte. Wenn noch andere Gäste dagewesen wären, hätten sie vielleicht versucht, sich an sie ranzumachen. Ich bin sogar sicher, daß sie das versucht hätten. Weil sich nämlich dauernd irgendwer an sie ranmachen wollte. An dem Abend war nur ich da, und sogar ich versuchte, mich an sie ranzumachen, wobei ich so etwas noch nie zuvor getan hatte. Aber wenn man fast eine Stunde lang seine eigene Musik vor einer einzigen Zuhörerin gespielt hat und sie nach jeder Nummer geklatscht und einen angelächelt und sogar einmal gesagt hat: »Das war schön«, dann hat man das Gefühl, das Recht dazu zu haben. Es wäre unhöflich gewesen, es nicht zu tun. Also holte ich in der nächsten Pause meinen Drink an der Bar ab und ging zu ihrem Tisch und sagte: »Darf ich mich dazusetzen?«
»Ja, sehr gerne.«
»Darf ich dich zu einem Drink einladen?«
»Nein danke, im Moment möchte ich nichts.«
Sie trank trockenen Weißwein. Ich setzte mich auf einen Hocker ihr gegenüber, um nicht zu aufdringlich zu erscheinen.
»Ist es hier immer so ruhig?« fragte ich.
»Ich weiß nicht. Ich bin das erste Mal hier.«
»Ziemlich altmodischer Laden, nicht? Für die Gegend hier, meine ich.«
»Er hat gerade erst aufgemacht. Wahrscheinlich dauert es eine Weile, bis er richtig läuft.«
Sie war so wunderschön. Sie hatte kurze, blonde Haare und einen grauen, taillierten Blazer, einen Wollrock, der bis knapp oberhalb des Knies ging, und schwarze Seidenstrümpfe – nichts Provokatives, wohlgemerkt, einfach nur geschmackvoll. Sie trug kleine, goldbesetzte Ohrringe und Lippenstift, der vermutlich nur deshalb so dunkelrot wirkte, weil sie einen so blassen Teint hatte. Mir fiel gleich auf, daß ihr Mund schlagartig von einem überaus runden und glücklichen Lächeln zu einem bedrückten, melancholischen Ausdruck wechseln konnte, der bei ihr eher normal war. Ihre Stimme war hell und wohlklingend, und ihre Aussprache – wie alles andere an ihr – zeigte, daß sie aus besseren Kreisen stammte. Die Hände waren klein und weiß, und die Fingernägel waren nicht lackiert.
»Mir gefällt es, wie du Klavier spielst«, sagte sie. »Wirst du ab jetzt jede Woche hier spielen?«
»Ich weiß noch nicht. Kommt drauf an.« (Ich habe nie wieder dort gespielt, wie sich später herausstellen sollte.) »Wartest du ... auf jemanden? Oder bist du allein hier?«
»Ich gehe oft allein aus«, sagte sie und fügte hinzu: »Aber heute abend war ich mit jemandem verabredet, wir wollten zusammen essen gehen. Doch dann hat er angerufen und abgesagt, und ich hatte mich schon fertig gemacht und keine Lust, zu Hause zu bleiben. Da hab ich mir gedacht, ich schau mir mal an, wie es hier so ist.«
»Das war rücksichtslos von ihm.«
»Er ist ein alter Freund. Es macht mir nichts aus.«
»Wohnst du hier in der Nähe?«
»Ja, nicht weit von hier. South Kensington. Und du?«
»Oh, für mich ist diese Gegend eine andere Welt. Ich wohne in South East London. In einer Sozialbausiedlung.«
Nach einer Pause sagte sie: »Darf ich dich um was bitten? Ich meine, einen Wunsch äußern. Ein Musikstück.«
Sofort packte mich eine nervöse Beklemmung. Wißt ihr, der Grund, warum ich nie das Zeug zum Cocktailbarpianisten hatte, ist der, daß mein Repertoire einfach nicht groß genug war, und ich hatte einfach kein Talent dafür, nach Gehör zu spielen. Die Gäste bitten einen Pianisten ständig, ein bestimmtes Stück zu spielen, und um mich für solche Situationen abzusichern, hätte ich jedes Standardstück lernen müssen. Das hätte Monate gedauert. Normalerweise brauchte ich einige Stunden, um ein Stück in den Griff zu kriegen, manchmal länger. Zum Beispiel »My Funny Valentine«. Die Melodie ist nicht schwierig, doch die mittleren acht Takte waren eine so harte Nuß für mich, daß ich geschlagene zwei Tage brauchte, bis sie genau so klangen, wie ich es wollte. Ich hatte mir einige der bekanntesten Schallplatten angehört, um zu hören, wie die großen Meister es spielten, und letztlich, wie ich fand, ein paar ganz hübsche Eigeninterpretationen zustande gebracht. Ich kriegte es jetzt ganz gut hin, dachte ich, aber das war das Ergebnis von zwei Tagen harter Arbeit gewesen, und ganz gleich was für ein Stück sie sich jetzt von mir wünschen würde, auch wenn ich in groben Zügen wußte, wie die Melodie ging, es mußte zwangsläufig schrecklich und amateurhaft und peinlich klingen.
»Na ja ... ich kann’s versuchen«, sagte ich dennoch, aus irgendeinem Grund.
»Kennst du ›My Funny Valentine‹?«
Ich runzelte die Stirn. »Also ... der Titel kommt mir bekannt vor. Aber ich hab kein gutes Gedächtnis. Könntest du mir die Melodie kurz vorsummen?«
Hätte das nicht jeder so gemacht?
Ich glaube, es war die beste Version, die ich je gespielt habe. Eine bessere ist mir seitdem nicht mehr gelungen: ein richtiger Herzensbrecher. Die Noten geben zwar im zweiten Takt G7 als Akkord vor, aber meistens – so auch im zehnten Takt – ersetzte ich den d-Moll-Septimakkord durch eine erniedrigte Quinte, nur spielte ich die zweite Umkehrung, mit einem As als Grundton. Ihr solltet das mal ausprobieren. Es färbt die Melodie wirklich dunkler. Im Mittelteil dann nahm ich anstelle der augmentierten Bs simple As-Dur-Septimakkorde – und einmal probierte ich sogar eine kleine None, woran ich zuvor noch nicht einmal gedacht hatte (zum Glück konnte ich die Neuigkeit meiner rechten Hand rechtzeitig mitteilen). Ich zog das Stück zu sechs Variationen in die Länge, spielte zunächst leise, haute aber gegen Ende so fest in die Tasten, daß die Akkorde richtig laut herauskamen. Den letzten Akkord spielte ich in c-moll, und meine letzte Note – jetzt erinnere ich mich wieder – war ein A in der Oberstimme. Ich habe es seither öfter versucht, aber es hat nie mehr so gut geklungen. In diesem Moment klang es jedenfalls genau richtig.
Zunächst herrschte Stille, dann fing sie an zu klatschen, und schließlich kam sie zum Klavier herüber. Ich drehte mich um und sah sie an. Wir lächelten beide.
»Danke«, sagte sie. »Das war wunderschön. So hab ich es noch nie gehört.«
Mir fiel nichts ein, was ich hätte sagen können.
»Mein Vater hat das Stück sehr gemocht«, fuhr sie fort. »Er hatte es auf Schallplatte. Ich hab mir das Stück sehr oft angehört, aber ... du hast es ganz anders gespielt. Und du hattest es wirklich noch nie gespielt?«
Ich lachte bescheiden. »Na ja, es ist erstaunlich, was man so alles kann. Bei der richtigen Inspiration.«
Sie wurde rot.
Nach zwei weiteren Nummern kam der Kneipenbesitzer zu mir und meinte, ich könnte jetzt nach Hause gehen. Er sagte nichts davon, daß ich in der nächsten Woche wieder spielen sollte, sondern gab mir mein Geld und fing dann an, die Stühle auf die Tische zu stellen.
»Tja«, sagte sie, »also mir hat es richtig gut gefallen. Und wenn mehr Leute hier gewesen wären, hätte es ihnen bestimmt auch gefallen.«
Ich packte meine Noten in eine Plastiktüte und sagte: »Darf ich dich nach Hause bringen?« Sie sah etwas verunsichert aus. »Ganz ohne Hintergedanken. Ich meine, nur bis zu deiner Haustür.«
»Na schön, das ist sehr nett. Danke.«
Und weiter kam ich an diesem Abend auch nicht – nur bis zu ihrer Haustür. Aber was für eine Tür: riesig und ganz aus Eiche, mit vergoldetem Klopfer, Briefkasten und Knauf. Sie schien in eine Art Villa zu führen: eins von diesen unglaublich wuchtigen und wundervoll aussehenden georgianischen Häusern, wie man sie am Onslow Square und in ähnlichen Wohngegenden findet.
»Hier wohnst du?« fragte ich und reckte den Hals, um zum obersten Stockwerk hochzublicken.
»Ja.«
»Allein?«
»Nein, mit jemandem zusammen.«
Ich schüttelte den Kopf. »Das muß ja fürchterlich beengt sein.«
»Das Haus gehört mir nicht«, sagte sie lachend.
»Hast du es gemietet? Wirklich? Wieviel zahlst du die Woche? Du kannst ruhig auf die nächsten Tausend abrunden, wenn du willst.«
»Ich arbeite hier«, sagte sie. »Es gehört einer alten Dame. Ich kümmere mich um sie.«
Es war ein warmer Frühsommerabend. Wir standen auf dem Bürgersteig gegenüber. Hinter uns war eine hohe Lorbeerhecke und dahinter ein kleiner Privatpark, über uns das silberne Licht einer Straßenlaterne. Ich lehnte mich gegen den Laternenpfahl, und sie stand ganz dicht neben mir.
»Die alte Dame ist gebrechlich und schläft fast den ganzen Tag. Zweimal täglich muß ich ihr das Essen hochbringen – ich muß es aber nicht zubereiten, das macht eine Köchin. Ich kann nicht kochen. Morgens helfe ich ihr aus dem Bett und abends mache ich sie wieder bettfertig. Am Nachmittag muß ich ihr eine Tasse Tee und Kekse oder Kuchen bringen, aber manchmal ist sie nicht mal lange genug wach, um ihren Tee zu trinken. Ich muß für sie einkaufen, zur Bank gehen und andere Besorgungen machen.«
»Und was kriegst du dafür?«
»Etwas Geld und eigene Zimmer. Da oben, das sind meine Zimmer.« Sie zeigte auf zwei riesige Fenster im zweiten Stock. »Meistens habe ich überhaupt nichts zu tun. Ich bin oben in meinen Zimmern, manchmal den ganzen Tag.«
»Fühlst du dich denn da nicht einsam?«
»Ich habe ein Telefon und einen Fernseher.«
Ich schüttelte den Kopf. »Das klingt, na ja, ganz anders als das Leben, das ich führe. Ganz anders.«
»Du mußt mir davon erzählen.«
»Ja. Vielleicht ...«, wagte ich zu sagen, »... vielleicht ein anderes Mal?«
»Ich muß jetzt rein«, sagte sie und überquerte eilig die Straße.
Ich folgte ihr, und sie schloß die Haustür mit einem Sicherheitsschlüssel auf, der für diese Aufgabe lächerlich klein und kümmerlich wirkte. Drei Stufen führten zur Tür hinauf: Ich stand auf der zweiten und sie auf der dritten, wodurch sie ein ganzes Stück größer als ich wirkte. Als die Tür aufging, erhaschte ich einen flüchtigen Blick von einer dunklen Eingangshalle. Madeline verschwand kurz – ich konnte das Klappern ihrer Absätze auf dem Fußboden hören, der dem Klang nach aus Marmor sein mußte – und dann wurde das Licht eingeschaltet.
»Donnerwetter«, sagte ich.
Während ich hineinlugte, ohne einen Hehl daraus zu machen, wie beeindruckt und erstaunt ich war, hob sie einen Briefumschlag auf, den jemand durch den Briefschlitz geworfen haben mußte. Sie machte ihn auf und las den Brief.
»Eine Nachricht von Piers«, sagte sie. »Er ist doch noch vorbeigekommen. Wie dumm von ihm.«
Ich stand da wie ein Volltrottel und sagte nichts.
»Tja«, sagte sie, »weiter kannst du nicht.« Sie drehte sich schon um. »Gute Nacht.«
»Hör mal ...« Unwillkürlich hatte ich meine Hand auf ihren Arm gelegt. Ihre grauen Augen sahen mich an, fragend. »Ich würde dich gern wiedersehen.«
»Hast du was zu schreiben?«
Ich hatte einen billigen Plastikkuli in der Jackentasche. Sie nahm ihn und schrieb eine Telefonnummer vorne auf den Briefumschlag, unter das Wort »Madeline«, das ihr Freund dort hingeschrieben hatte. Dann gab sie ihn mir.
»Da. Du kannst mich anrufen. Jederzeit, Tag und Nacht. Es macht mir nichts aus.«
Und nachdem sie das gesagt hatte, machte sie mir sacht die Tür vor der Nase zu.
Im Samson’s war es nicht sehr voll – bei dem Wetter blieben die Leute wohl lieber zu Hause –, und wir konnten uns aussuchen, ob wir im Eßbereich Platz nehmen oder nur was trinken wollten.
»Hast du Hunger?« fragte ich. »Oder möchtest du bloß was trinken?«
»Ist mir egal.«
Ich seufzte.
»Hast du denn heute abend schon was gegessen?«
»Nein.«
»Dann mußt du Hunger haben.«
»Eigentlich nicht. Möchtest du in der Nähe deines Freundes sitzen?«
Das Klavier stand im Barbereich, aber in der Nähe der Tür zum Restaurant, so daß die Gäste dort trotzdem der Musik lauschen konnten. Tony spielte mit dem Rücken zu uns und hatte unsere Ankunft noch nicht bemerkt.
»Mir ist es egal, wo wir sitzen«, sagte ich.
»Ich dachte, wir sind seinetwegen hier.«
»Wir sind hier, weil es hier nett ist. Ich hab ja nicht mal gewußt, ob er spielen würde.«
Ich hatte wohl lauter als sonst geredet, denn Tony hörte mich, drehte sich um und winkte mit der linken Hand, während die andere ein hübsches, kleines Arpeggio in fis-moll weiterspielte.
»Gehen wir nach hinten durch«, sagte ich und deutete Richtung Restaurant.
»Ich hab keine Lust, da zu sitzen und dir beim Essen zuzugucken«, sagte Madeline.
»Willst du denn nichts?«
»Eher nicht.«
»Wieso sagst du das denn nicht? Na schön, okay, trinken wir eben nur was.«
»Aber du hast doch Hunger.«
»Himmelherrgott.«
Ich setzte mich an den nächstbesten Tisch und fing an, die Weinkarte durchzusehen.
Sie setzte sich neben mich und sagte, während sie sich aus ihrem Mantel schälte: »Du bist schwierig, William.«
Eine Melodie ging mir durch den Kopf:
There were times when I could have murdered her
But I would hate anything to happen to her ...
I know, I know, it’s serious
»Hallo, ihr Frischverliebten«, sagte Tony.
Wir hatten mit dem Wein angefangen, eine schöne, kalte Flasche Frascati, und jetzt stand Tony vor uns, strahlte uns an und wartete auf eine Einladung.
»Hast du ein paar Minuten Zeit?« fragte ich und winkte ihm, Platz zu nehmen.
»Danke.«
Wir baten um ein drittes Glas.
»Hübsche Fassung«, sagte ich.
»Du meinst den Cole Porter? Ja, ich dachte, ich versuch’s mal in einer anderen Tonart. Hab es noch nie in A gespielt. So klingt es irgendwie sonniger. Also«, er goß sich ein großzügiges Glas ein, »wie läuft’s denn so?«
Ich hatte gehofft, er würde zuerst mit Madeline reden, aber seine Frage war offensichtlich an mich gerichtet, und es war abzusehen, daß wir beim Thema Musik landen würden, wovon Madeline ausgeschlossen wäre.
»Na ja, wir haben in letzter Zeit nicht viel geprobt«, sagte ich. »Morgen wieder zum ersten Mal nach über einer Woche. Wir erholen uns noch vom letzten Auftritt. War ein bißchen hart.«
»Ja, du hast so was erwähnt.«
»Ich hab mit Chester drüber gesprochen. Er war sehr kleinlaut, hat gesagt, er würde uns nicht noch mal in so einem Laden spielen lassen.«
»Und wie geht’s Martin? Hat er den Verband inzwischen ab?«
»Ja, seit zwei Tagen, glaub ich. Er kann seine Gitarre schon fast wieder halten.«
»Übel.«
»Na ja, aus Erfahrung wird man klug. Jetzt wissen wir jedenfalls, daß man nicht in einem Lokal spielen sollte, wo der Kellner sich die Wörter ›Love‹ und ›Hate‹ auf die Knöchel tätowiert hat.«
Tony lächelte vorwurfsvoll, als hätte er wieder einen Punkt in einer schon länger geführten Debatte erzielt.
»Tja, das hast du nun von dieser Rockmusik, nicht? So was ist noch bei keinem Gig passiert, bei dem ich gespielt hab. Und bist du in der Zwischenzeit mal dazu gekommen, richtige Musik zu üben?«
»Ich versuch mich an ein paar von den Stücken, die du für mich arrangiert hast. Apropos – ich glaube, du hast beim Kopieren irgendwo einen Fehler gemacht. Drei Takte vor dem Schluß von ›All the Things You Are‹ – da hast du doch b-moll gemeint, nicht wahr, und nicht Dur?«
»Stimmt. Es ist ein einfaches II-V-I. Wieso, hab ich Dur geschrieben?«
Madeline stand auf und sagte: »Entschuldigt ihr mich kurz? Die Damentoilette ist unten, oder?«
»Klar.«
Tony und ich saßen eine Weile in ziemlich verlegenem Schweigen da. »Ich glaube, sie fühlt sich ausgeschlossen, wenn wir über Musik reden«, erklärte ich. »Vielleicht sollten wir uns über allgemeinere Themen unterhalten.«
»Ist das kein Problem für dich?«
»Wie meinst du das?«
»Ich meine, mit jemandem zusammenzusein, der sich nicht dafür interessiert, was du machst.«
»Sie interessiert sich dafür. Madeline mag Musik, alle möglichen Richtungen. Zum Beispiel hört sie vor allem viel Kirchenmusik.«
»Oh ja, das kann ich mir vorstellen.« Tony schenkte sich Wein nach. »Dann läuft’s also immer noch ganz gut zwischen euch beiden?«
Vielleicht sollte ich an dieser Stelle erwähnen, daß ich Tony seit mehreren Jahren kannte. Er war sogar mein allererster Klavierlehrer. Als ich noch in Leeds Chemie studierte, bevor ich das Studium an den Nagel hängte, schrieb er gerade an seiner Doktorarbeit und verdiente sich noch Geld dazu, indem er Jazzpiano-Kurse gab. Er hatte schon eine kleine Familie zu versorgen: seine Frau Judith und ihren gemeinsamen Sohn Ben, der damals erst fünf war. Ich lernte sie bald darauf näher kennen, als ich wieder anfing, Privatstunden zu nehmen. Sie hatten ein kleines Reihenhaus in der Gegend von Roundhay, ein richtig hübsches Häuschen mit einem Klavier und einem Garten und sogar einer ganz netten Aussicht auf die Landschaft drumherum, so daß ich unter anderem auch deshalb zu Tony ging, weil ich gern mit seiner Familie zusammen war und anschließend vielleicht mit ihnen zusammen zu Abend essen konnte. Judith schien sich zu freuen, wenn ich zu Besuch kam, obwohl ich mir beim besten Willen nicht erklären konnte, wieso. Aus irgendeinem Grund hatte ich nie was übrig für das Studentenleben – all die traurigen Männer, die sich in schäbigen Gemeinschaftsküchen ihre Fertignudeln machten, um sie dann allein in ihrem Zimmer vor einem tragbaren Schwarzweißfernseher, in dem »Doctor Who« lief, zu essen –, und ich genoß die ruhigen Familienabende bei Tony, bei gutem Essen und gutem Rotwein, während im Hintergrund Monk oder Ben Webster oder Mingus oder sonstwer spielte.
Das blieb jedoch nur mein erstes Studienjahr so. Judith wollte nach London, wo sie bessere Aussichten auf eine Ganztagsstelle hatte, und so zog die ganze Familie nach Shadwell, mitsamt Tonys nicht abgeschlossener Doktorarbeit. Dank seiner Kontakte zur Szene in Leeds hatte er glücklicherweise ein paar Musiker in London kennengelernt, so daß er schon bald als Lehrer und Pianist gefragt war. Und als ich zu meinem weisen Schluß kam, daß London die einzig richtige Stadt für ehrgeizige Musiker war, und den aussichtslosen Kampf mit meinem Studium aufgab, bedeutete Tonys Umzug für mich, daß ich zumindest eine erste Anlaufstelle hatte. Tony und Judith halfen mir, wo sie konnten. Ich verdankte ihnen viel. Wie sich herausstellte, suchte Judiths Schwester Tina einen Mitbewohner: Sie hatte eine Sozialwohnung in Bermondsey, mit zwei Schlafzimmern. Ich zog fast sofort bei ihr ein, und ich denke, im großen und ganzen klappte unser Zusammenleben recht gut – aber von Tina erzähle ich später, denn auch sie war in die Ereignisse verstrickt.
Weder Judith noch Tony haßten London so sehr wie ich, aber er haßte es mehr als sie. Vom Temperament her war er schon immer eher stur und prosaisch, neigte zu einer pessimistischen Weltsicht und verabscheute nichts mehr als Arroganz und Heuchelei. Er trug einen gepflegten schwarzen Bart und hatte flinke, intelligente Augen. Er machte sich gern über andere lustig, ohne daß sie es merkten, eine Form von Humor, die ich nie verstanden habe, und ich war immer leicht nervös, wenn ich ihn Leuten vorstellte, denn auch wenn es Freunde von mir waren, konnte ich nie sicher sein, daß er höflich zu ihnen sein würde. Ich hatte zunehmend den Verdacht, daß er Madeline nicht sehr mochte. Er hätte das zwar nie geäußert – jedenfalls nicht mir gegenüber –, aber ich spürte einen Hauch von Feindseligkeit. Sie hatten sehr wenig Gemeinsamkeiten, wißt ihr, und Madeline hatte zudem eine gewisse Einfachheit an sich, eine Art Naivität, die Tony, glaube ich, unangenehm fand. Vielleicht meinte er, sie würde nur so tun, als ob. Daher seine abfällig gemeinte Bemerkung über ihre Vorliebe für religiöse Musik: Er war sehr argwöhnisch, was diese Seite von Madeline betraf, und nahm sie ihr nicht ab, wohingegen gerade diese Seite für mich eines der anziehendsten Dinge an ihr war. Es war eine unaufdringliche, gutmütige Art von Religiosität, die sich darin äußerte, daß Madeline sich bemühte, zu aller Welt freundlich zu sein und nur das Beste von anderen zu denken (ohne daß ich je besonders in diesen Genuß gekommen wäre). Ich mußte an das vorige Mal denken, als wir zusammen im Samson’s gewesen waren und Tony über seinen Vater gesprochen hatte, der zwei Jahre zuvor gestorben war.
»Das tut mir furchtbar leid«, hatte Madeline gesagt. »Es muß schrecklich sein, einen Elternteil zu verlieren, und so früh.«
»Es ist so sinnlos, oder? So willkürlich.«
»Aber weißt du was ...« Und da hatte sie sogar seine Hand berührt, während ich bewundernd zusah. »... wichtig ist, mit Würde zu sterben. Der Tod kann sanft sein, und still und sogar schön. Und wenn wir mit Würde aus diesem Leben scheiden, was gibt es dann zu betrauern?«
»Da ist wirklich was dran«, sagte Tony.
»Woran ist dein Vater gestorben?«
»An Hodensackfäule.«
Tony gehörte also wahrlich nicht zu den Menschen, mit denen ich offen über meine Beziehung zu Madeline sprechen konnte, aber wen hatte ich denn sonst noch? In emotionaler Hinsicht waren die anderen Bandmitglieder – freundlich formuliert – unverbildet. Und nach gut einem Jahr in London hatte ich kaum andere Freundschaften geschlossen. Spricht das nicht Bände über diese Stadt? Ich wohnte in unangenehmer räumlicher Nähe zu meinen Nachbarn in der Sozialbausiedlung; ich konnte durch die Wände hören, wie sie Geschirr durch die Gegend warfen und sich gegenseitig die Hucke voll hauten, aber ihre Namen erfuhr ich nie. Ich konnte in der überfüllten U-Bahn gegen einen anderen Mann gepreßt stehen, ohne daß sich unsere Blicke trafen. Ich konnte dreimal die Woche in denselben Supermarkt gehen, ohne auch nur einmal mit der jungen Frau an der Kasse zu plaudern. Was für eine bescheuerte Stadt. Aber ich komme vom Thema ab. Ich wollte eigentlich sagen, daß ich froh über Tonys Frage war, froh über die Gelegenheit, über Madeline sprechen zu können, solange sie weg war.
»Ja, es läuft noch immer ganz gut zwischen uns«, sagte ich. »Jedenfalls nicht schlechter als sonst.«
»Hast du schon mit ihr geschlafen?«
Das ging ihn natürlich nichts an, aber ich nahm ihm die Frage nicht übel.
»Wir halten es für wichtig, nichts zu übereilen.«
»Na, den Vorwurf kann dir weiß Gott keiner machen. Aber an deiner Stelle würde ich doch versuchen, sie vor der Menopause noch ins Bett zu kriegen.«
»Na ja, du weißt ja, sie hat’s mit dem Katholizismus ...«
»Ist das nicht frustrierend für dich?«
»Ich versuche, auf andere Weise damit klarzukommen. Ich glaube, Musik ist für mich ein Ersatz für Sex.«
»Im Ernst? Ab sofort spielst du nie wieder auf meinem Klavier, ohne dir vorher die Hände zu waschen. Hast du mit ihr drüber gesprochen? Redet ihr über so was?«
»Ich warte noch auf den richtigen Zeitpunkt.«
»Aber das geht doch jetzt schon sechs Monate so, William. Und eine Freundin wie Madeline ist bestimmt nicht billig. Wohin hast du sie heute abend ausgeführt?«
Ich erzählte es ihm.
»Wie bitte?«
»Es war ihre Idee. Sie wollte schon seit einer Ewigkeit hin.«
»Wieviel hast du für die Karten bezahlt?«
Ich erzählte es ihm.
»Wie bitte? William, so was kannst du dir nicht leisten.«
»Ich mache jede Menge Überstunden. Ich kann es mir leisten, ab und an mal. Jedenfalls hab ich an ein paar Zeitschriften geschrieben, und ich glaube ... ich glaube, über kurz oder lang krieg ich bei einer einen Job. Ich hab ein paar Rezensionsproben mitgeschickt und meinen Lebenslauf. Am Telefon hab ich mit einem Typen gesprochen, der ganz ermutigend klang.«
»Journalisten erzählen jede Menge Stuß. Wie oft muß ich dir das noch sagen? Ich meine, vielleicht hast du ja Glück, aber du kannst dich einfach nicht auf diese Leute verlassen.«
»Na, früher oder später muß ich beruflich irgendwas Solides machen, sonst dreh ich noch durch. In dem Laden halte ich es nicht mehr lange aus.«
»William, du bist jung. Bleib locker, bleib, wie du bist, sammle soviel Praxiserfahrung, wie du kannst. Du hast Talent, das hab ich immer gesagt, man kann nie wissen, was sich mal für Chancen auftun, wenn du am Ball bleibst. Es gibt nicht den geringsten Grund, warum du zur Zeit an einen sogenannten soliden Beruf denken mußt.«
»Und angenommen, ich will heiraten?«
»Heiraten, in deinem Alter? Du machst Witze. Wen würdest du denn heiraten wollen?«
Ich legte die Stirn in Falten und goß Wein nach. Tony schüttelte den Kopf.
»Tut mir leid, William, ich glaube nicht, daß das eine gute Idee wäre.«
»Du bist doch schließlich auch gern verheiratet, oder? Du bist froh, daß du ein Haus hast und ein Kind und den ganzen Kram.«
»Ja, aber man muß doch bereit dafür sein. Zum Donnerwetter, du warst schon mal verlobt, und wie alt bist du – dreiundzwanzig? Komm wieder auf den Teppich. Nur weil du dich ab und zu gern mit einer Frau triffst, mußt du nicht den Rest deines Lebens mit ihr verbringen. Sieh das mal lokker.« Er blickte auf seine Uhr. »Ich muß wieder spielen, meine zwanzig Minuten sind um.«
»Okay. Wir bleiben noch ein Weilchen und hören zu.«
»Ach ja, da fällt mir was ein – könntest du mir einen Gefallen tun?«
»Was denn?«
»Es geht um Ben. Hast du am elften schon was vor? Sonntag in vierzehn Tagen?«
»Ich glaube nicht. Wieso?«
»Judith ist von ihrem Chef zu einem Brunch in Cambridge eingeladen worden, und sie möchte, daß ich mitkomme, aber für Ben ist das nichts. Könntest du vielleicht babysitten? Wir sind bestimmt am Abend wieder zurück.«
»Klingt gut.«
Mir gefiel der Gedanke, einen Tag lang in Tonys Haus zu sein. Das gab mir Gelegenheit, sein Klavier zu benutzen.
»Dann halt dir den Termin frei, ja? Ich wär dir dankbar.« Tony stand auf und dehnte seine Finger. »Irgendwelche Wünsche?«
Auf der anderen Seite des Raumes sah ich Madeline von der Toilette zurückkommen.
»Wie wär’s mit ›I Got It Bad and That Ain’t Good‹?«
Er folgte meinem Blick und lächelte.
»Dein Wunsch ist mir Befehl.«
Worüber sprachen Madeline und ich den Rest des Abends? Wenn ich an all die Male zurückdenke, die wir zusammen waren, kann ich mich kaum an die Themen unserer Gespräche erinnern. Mich beschleicht der unangenehme Verdacht, daß wir überwiegend geschwiegen oder so banale Gespräche geführt haben, daß ich sie absichtlich aus meinem Gedächtnis verbannt habe. Ich weiß, daß wir uns an dem Abend nicht wieder gestritten haben, und ich weiß, daß wir nicht über das Musical gesprochen haben. Vielleicht sind wir nur noch so lange im Samson’s geblieben, bis wir den restlichen Wein getrunken hatten. Ich kann mich noch genau erinnern, daß wir anschließend in der U-Bahnstation Tottenham Court Road standen, an der Stelle, wo sich die Wege zu unseren jeweiligen Linien trennten, und ich sie im Arm hielt und mich streckte, um sie auf die Stirn zu küssen.
»Also dann, gute Nacht«, sagte ich.
»Danke für die Einladung. Tut mir leid, daß dir das Musical nicht so gut gefallen hat.«
Ich zuckte die Achseln und fragte: »Wann kann ich dich wiedersehen?« Plötzlich spürte ich den drohenden Schmerz, von ihr getrennt zu sein, so schneidend wie eh und je.
Auch sie zuckte die Achseln.
»Wie wär’s mit ...« Ich nannte wahllos einen Tag, der in halbwegs annehmbarer Entfernung lag: »... Dienstag?«
»Okay.«
(Sie hätte dasselbe gesagt, wenn ich vorgeschlagen hätte, daß wir uns morgen oder in sechs Monaten treffen.)
Wir vereinbarten eine Uhrzeit und einen Treffpunkt, und dann küßten wir uns zum Abschied. Es war kein schlechter Kuß. Er dauerte etwa vier oder fünf Sekunden, und unsere Lippen waren leicht geöffnet. Er überstieg sogar meine Erwartungen.
Trotzdem war ich nicht gerade beschwingt, als ich nach Hause fuhr. Ich fuhr mit einem Zug der Northern Line zum Embankment und nahm dann die Circle Line nach Osten zu Tower Hill. Es war die letzte Bahn, glaube ich. Es war sicherlich weit nach Mitternacht, als ich aus der Station ins Freie trat und mich auf den dreißigminütigen Fußweg zu meiner Wohnung machte. Der Mann an der Fahrkartenschranke erkannte mich, nickte müde und wollte nicht meine Fahrkarte sehen. Ich kam so regelmäßig um diese Uhrzeit an der Station an, daß er vermutlich dachte, ich würde irgendwo in der Spätschicht arbeiten. Tower Hill. Kein schlechter Titel für das Klavierstück, an dem ich gerade schrieb, dachte ich plötzlich. Es sollte eine müde und melancholische Stimmung haben – wie man sich am Ende eines langen Tages fühlt, vielleicht verbunden mit der vagen Hoffnung, daß es nur noch besser werden kann. Die ersten zwei Phrasen waren ganz spontan beim Improvisieren entstanden, und ich werkelte inzwischen schon über eine Woche daran herum, versuchte, eine Struktur reinzubringen. Vielleicht kam ich ja weiter, wenn ich einen Titel hatte.
In meiner Wohnung angekommen, ging ich direkt in mein Zimmer, schaltete das Keyboard und den Verstärker ein und spielte, was ich bisher geschrieben hatte:
Weiter war ich noch nicht gekommen. Ich hatte zwar ein paar Ideen für den Mittelteil, aber ich war noch nicht soweit, daß ich schon daran gearbeitet hätte. Was sollte als nächstes kommen? Aus C7 ergab sich f-moll, das war kein Problem; und plötzlich, als ich mir ein deutlicheres Bild von der Stimmung machen konnte, die ich zum Ausdruck bringen wollte, schrieb ich die nächsten vier Takte flüssig nieder:
Ich spielte alle acht Takte durch, mehrmals, und war mit ihnen zufrieden; aber nach wie vor hatte ich keine Idee, wie ich die mittleren acht in Angriff nehmen sollte. Ich probierte dreizehn verschiedene Akkorde aus, und keiner klang richtig, also gab ich auf. Statt dessen ging ich in die Küche, um mir eine Tasse Tee zu machen.