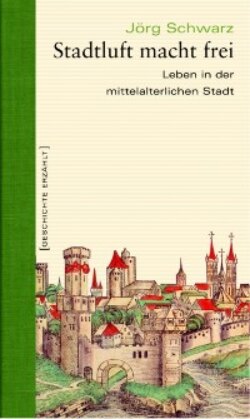Читать книгу Stadtluft macht frei - Jörg Schwarz - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Stadtluft macht frei – warum?
ОглавлениеAm Anfang war die Grundherrschaft. „Grundherrschaft“ ist kein aus dem Mittelalter selbst stammender Ausdruck, sondern ein moderner Begriff. Dennoch kennzeichnet das, was der Begriff meint, eine der wichtigsten Erscheinungsformen des Zusammenlebens der Menschen im Mittelalter überhaupt. Der Begriff verweist freilich nicht auf die Stadt, sondern auf das Gegenteil von ihr, auf das Land und auf die Landwirtschaft.
Grundherrschaft war eine Herrschaft über Land und Leute. Dem Besitzer einer Grundherrschaft gehörte nicht nur das Land, er gebot auch über die auf diesem Land lebenden Personen, die Grundholden oder Hintersassen, wobei stets eine große Bandbreite an Abhängigkeiten geltend zu machen ist. Neben Personen, die dem Grundherrn zwar formal-rechtlich unterstanden und ihm Abgaben leisten mussten, aber doch mit sehr weitgehenden Eigentums- und Verfügungsrechten das Land bewirtschaften durften, gab es auch solche, deren Freiheitsrechte praktisch nicht vorhanden waren. Die Grundherrschaft ist bereits sehr früh im Mittelalter nachweisbar; in einigen Teilen des Frankenreiches finden wir sie bereits um das Jahr 600. In den königlichen Domänen, das heißt, den Besitzungen der Merowinger – der Familie, die das Frankenreich formte – taucht sie dort erstmals auf. Dann begann ihre Erfolgsgeschichte.
Als seit dem 11. Jahrhundert neben den traditionellen, vorwiegend aus der Römerzeit stammenden Städten aus Siedlungen rund um Burgen und Klöster neue Städte entstanden, setzten sich immer mehr
Nach Jahr und Tag bist du frei!
Schon in den lateinischen Rechtsquellen der fränkischen Zeit als annus et dies nachzuweisen, ist der Ausdruck „Jahr und Tag“ in der deutschen Rechtssprache eine der gängigsten Formeln für den Zeitraum eines Jahres. In vielen Fällen ist der Begriff einfach wörtlich aufzufassen, das heißt, der „Tag“ ist als Zugabezahl zum „vollendeten Jahr“ (annus integer) zu deuten. Der Satz wurde aber, je nach Region, im Laufe des Mittelalters oftmals auch als Frist von einem Jahr, sechs Wochen und drei Tagen gedeutet.
Menschen aus den Grundherrschaften in diese Orte ab. Dort waren sie in der Regel unauffindbar. Sie tauchten unter im „Gewühl“ der Stadt – manchmal noch ein eher bescheidenes und recht überschaubares Gewühl, doch es war eines der Tore zur Freiheit. Vielerorts entstand der Rechtsbrauch: Ein Leibeigener kann nach „Jahr und Tag“ nicht mehr von seinem Grundherrn zurückgefordert werden. Er war frei. Ein neues Leben konnte beginnen.
Die Formulierung „Stadtluft macht frei“, die diesem nachweislichen Rechtsbrauch einen prägnanten Ausdruck gibt, stammt freilich nicht aus dem Mittelalter selbst, sondern erst aus der Neuzeit. Hier ist sie zum ersten Mal 1759 in der umgekehrten Formulierung „Luft macht leibeigen“ bezeugt. Sie spiegelt die tatsächliche mittelalterliche Gewohnheit wider, wonach die „Luft“ wirklich etwas Besonderes war: nicht allein das Gasgemisch der Erdatmosphäre, das, wie bekannt, überwiegend aus Stickstoff und Sauerstoff besteht und im ursprünglichen Zustand geruchs- und geschmacklos ist, sondern ein Element der Rechtsgeschichte. Die „Luft“ bestimmte den rechtlichen Status einer Person. Die Freiheit der Stadt war jedoch nicht grenzenlos. Die mittelalterliche Freiheit war – kaum anders als die heutige – mit einer Reihe von Verpflichtungen verbunden: einem Grundzins, einer Anerkennungsgebühr für die freie Erbleihe sowie einer Aufnahmegebühr. Verließ der Zugezogene das Rechtsgebiet der Stadt, war es in der Regel nicht möglich, sich einfach „auf und davon“ zu machen. Im Gegenteil, es musste ein Abzugsgeld an die Stadt entrichtet werden. So leicht verzichtete man auf Neubürger in den Städten nicht. Niemand sollte glauben, hier einfach so wieder gehen zu dürfen.
Stadtluft war nicht gleich Stadtluft
Stadtluft war nicht gleich Stadtluft. Nicht jede Luft innerhalb der Mauern einer städtischen Siedlung machte „frei“. Es gab Städte, denen vom Stadtherrn die Aufnahme von Unfreien verboten wurde oder in denen die Leibeigenen bestimmter Herrschaften oder Klöster vom Erwerb der Bürgerrechte ausgeschlossen waren. Setzten diese sich dennoch in die betreffenden Städte ab, so erwarb der Stadtherr die Rechte des früheren Grundherrn an den Dienstleistungen des Zugezogenen. Dieser geriet somit nur von einer Unfreiheit in die andere. Rechtlich gesehen, änderte sich für ihn gar nichts. Dennoch wagten viele diesen Schritt. Die Verlockungen des Neuanfangs erschienen größer als alle Risiken. Die Stadt lockte. Sie zog an.
Stadtluft stank auch –
und konnte gefährlich sein
Stadtluft machte also frei. Doch es ist ein Irrtum anzunehmen, dass sich die befreiende Wirkung der Stadt, ihre ungeheure Attraktivität, nur auf den rechtsgeschichtlichen Aspekt bezog. Die Stadt des Mittelalters war ein Ort von großer Anziehungskraft, die alles überwand, was als Lebensraum gegen sie sprechen mochte. Das scheint zunächst nicht wenig zu sein. Nichts gibt es, erzählt man von der Stadt des Mittelalters, zu beschönigen. Ein magischer Ort sieht anders aus. Die Häuser waren meist aus Holz, ihre Ritzen primitiv verklebt mit Lehm und Reisig. Häuser ganz aus Stein waren lange noch die Ausnahme. Nur wenige Familien, zumeist reiche Patrizier, konnten sich diesen Luxus leisten – dass sie im Gewirr der Behausungen aus Holz und Lehm auffielen, verrät die Bezeichnung „Steinhaus“ noch heute. Erst zum Spätmittelalter hin setzen sich zumindest in einigen Teilen Deutschlands, so vor allem im Norden, Steinbauten in größerem Maße durch. Die wenigsten Dächer waren anfangs schon mit Ziegeln bedeckt; Stroh oder Schindeln waren die Regel. Nur den Kirchenbauten war zunächst der Ziegel vorbehalten.
Tödliche Gefahr – Feuer in der Stadt
Entstand in einer Stadt ein Brand, war die Katastrophe da: ein Inferno, das von Haus zu Haus übersprang, angeheizt vom Heu, Stroh oder Hopfen, die auf den Dachböden zum Trocknen lagerten. Immer wieder wurden so ganze Straßenzüge oder Stadtteile in Asche gelegt. Die Erfurter Peterschronik meldet zum Jahr 1222 einen großen Brand, der die Krämerbrücke und die Breite Straße, die von der Brücke bis zum Platz vor St. Marien führte, vollständig vernichtet haben muss. Zum gleichen Jahr brannte, den Angaben eines süddeutschen Chronisten zufolge, die ganze Stadt Konstanz nieder. 1240 wiederholte sich in der Bodenseemetropole die Katastrophe; die Folgen waren diesmal so schlimm, dass der König den Konstanzer Bürgern sogar die Reichssteuern nachließ.
Der Schrecken derartiger Ereignisse war den Bürgern noch Jahrzehnte später präsent. Der bedeutende Straßburger Geschichtsschreiber Fritsche Closener berichtet in seiner Chronik detailliert von verheerenden Bränden in seiner Stadt für die Jahre 1280, 1298, 1319, 1343 und 1352. Allein beim Brand von 1298 sollen 355 Häuser zerstört worden sein. 1319 und 1352 befand sich der Brandherd jedesmal in der Sporergasse.
Als man das Jahr 1319 zählte, da brannte die Sporergasse und der Schneidergraben. Da man aber das Jahr 1352 zählte, an dem fünften Tag nach Sankt Michael (4. Oktober), da entstand ein Feuer in der Sporergasse um die Vesperzeit und brannte bis an die Münze und bis an dieselbe Zeile herab. Und zu derselben Zeit brannte die große Gasse bis an die Pfalz.1
Noch heute stockt einem bei der Lektüre dieser Berichte der Atem. Immer wieder musste ganz von vorn begonnen werden, immer wieder standen die Überlebenden buchstäblich vor dem Nichts.
Nur langsam bemühte man sich durch Bauvorschriften und Brandschutzordnungen um eine Eindämmung des Problems. In einer gemeinsamen Sitzung von Rat und Domkapitel der Stadt Konstanz wurde 1296 beschlossen, dass niemand an seinem Haus über die Straße hinausragende hölzerne Vorbauten – Stuben, Lauben, Gemächer oder Erker – errichten dürfe. In einem nächsten Schritt teilte man die gesamte Stadt in Bezirke ein, in denen jeweils ein Feuerschauer auf ausbrechende Brände zu achten und, im Notfall, weitere Mannschaften zu informieren hatte. Trotzdem: Das Feuer konnte immer kommen, jeden Tag, jede Nacht.
Bretter und Bohlen auf Schlamm
Die wenigsten Straßen in einer mittelalterlichen Stadt waren bereits gepflastert; von den holprigen Landwegen, die in die Städte hineinführten, waren die städtischen Hauptstraßen oft kaum zu unterscheiden. Bretter und Bohlen, die den bei schlechtem Wetter schmierigen Grund überdeckten, machten die Ränder notdürftig für den Fußverkehr gangbar. Wo es sie nicht gab, musste man sich mit hölzernen „Trippen“ unter den Schuhen fortbewegen. Straßenkehrer trugen diese Trippen bei ihrer Arbeit wohl ganz grundsätzlich – sonst wäre ihr Schuhwerk bald ruiniert gewesen.
Nur mühsam setzte sich wenigstens in größeren, reicheren Städten Pflaster für Hauptstraßen und Marktplätze durch: 1331 in Prag, 1368 in Nürnberg, 1399 in Bern. Auf den Straßen lagen Dreck und Unrat, überall. Eine geregelte Abfallentsorgung gab es nicht. Glücklich die Städte, die von einem Bach durchzogen wurden, der, zum Kanal geformt, das Schlimmste fortschwemmen konnte. Auch wenn keineswegs so viel Abfall anfiel wie heute, da man versuchte, das meiste wiederzuverwenden: Die Bürger kippten das, was übrig blieb, einfach vor die Tür. Wir wissen es von den zahllosen Verboten, mit denen Stadträte versucht haben, dem Einhalt zu gebieten. Zumeist vergebens. Auf den Straßen vieler Städte streunten Schweine, wir wissen es aus Chroniken, wir sehen es auf Bildern der Zeit. Die Schweine sorgten zwar einerseits für eine Verminderung der Abfälle, doch ihr Kot sowie alles, was sonst noch herumlag, waren ideale Brutstätten für ansteckende Krankheiten – und gegen eine Epidemie war in einer Stadt, in der man dichtgedrängt zusammenhockte, nur schwer anzukommen.
Zweifelsohne: Stadtluft machte nicht nur frei, sie stank auch. Oftmals bis zum Himmel. „Stadtluft macht ein bleiches Gesicht“ – auch dieser Satz stammt erst aus der Neuzeit. Aber: Was nicht in den Akten steht, ist dennoch in der Geschichte. Und wie sein Pendant von der freimachenden Wirkung der Stadt trifft auch dieser Satz bereits für das Mittelalter zu. Trotz alledem: Die Städte des Mittelalters wuchsen nahezu ungebremst, der Zustrom an Menschen in die Siedlungen riss nicht ab, neue Städte wurden gegründet. Die Attraktivität der Stadt schien grenzenlos zu sein. Wie ist das zu erklären?
Waren aus Nah und Fern – Die Märkte
Menschen müssen essen und trinken. Wer auf dem Land lebte, zumal in gebirgigen Regionen, die seit dem Hochmittelalter zunehmend aufgesiedelt wurden, konnte sich mit frischem, fließendem Wasser in der Regel problemlos versorgen; in der Stadt hingegen wurde vor dem Gebrauch von Wasser oftmals gewarnt. Mit dem Essen sah es schon anders aus. Immer wieder sorgten Missernten auf dem Land für große Hungersnöte. Tausende fielen diesen Nöten zum Opfer. Frühmittelalterliche Quellen berichten in diesem Zusammenhang sogar von Kannibalismus – für das christliche Mittelalter schier unglaublich, aber dennoch wahr. Zwar brachten neue landwirtschaftliche Produktionsmethoden wie die Dreifelderwirtschaft und neue technische Geräte wie der schollenwendende Pflug entscheidende Verbesserungen. Doch die Möglichkeit von Missernten und damit die Gefahr von Hungersnöten waren weiterhin stets präsent. Der Hunger war – letztlich bis zur Einführung der stärkehaltigen Kartoffel in der Neuzeit – nie wirklich gebannt. Allein im 12. Jahrhundert haben drei große Hungerkrisen den kompletten Westen Europas überzogen: 1125/26, 1144/46 und 1196/77. Der Hunger kam immer wieder. Er konnte die verschiedensten Ursachen haben. 1338 fraßen Heuschreckenschwärme, die sich wie Schnee auf den Feldern niederlegten, ganze Landschaften regelrecht kahl. 1446 im fränkischen Raum: Würmer zernagten die Wurzeln des Getreides in einem katastrophalen Ausmaß – mit schlimmen Folgen. Der Augsburger Chronist Burkard Zink berichtet, dass selbst alte Menschen sich nicht an ein vergleichbares Unglück erinnern konnten.
Im Herbst des Jahres 1446 gab es so viele Krautwürmer wie ich sie noch nie in meinem Leben gesehen habe. Und auch alte Leute berichteten mir, dass es so etwas in diesem Ausmaß noch nie gegeben hätte. Hier und überall im Land haben die Würmer die Wurzeln der Pflanzen in den Gärten fast vollständig zerfressen. Das Kraut sah aus wie pösemreis, die Würmer haben alles zerfressen. Als ich in diesem Jahr von Augsburg nach Venedig reiste, habe ich in Höllenstein, einem Ort bei Brixen, übernachtet. Und auch dort dasselbe: Die Würmer krochen in der Kammer die Wand hoch, sodass einem das kalte Grausen kam. Und auch in dieser Gegend habe ich nirgendwo Pflanzen auf den Feldern gesehen. Es war alles zerfressen.2
Die Stadt des Mittelalters war mit dem Land, das sie umgab, eng verzahnt. Missernten auf dem Land schlugen sich auch in der Lebensmittelversorgung der Stadt nieder. Doch schon im Mittelalter regierten die Gesetze von Angebot und Nachfrage. Missernten in der einen Region konnten durch Zulieferungen aus anderen Regionen aufgefangen werden. Umschlagplatz der Waren aus dem Land war in der Stadt der Markt. „Markt“ war nicht gleich „Markt“. Zu unterscheiden sind vor allem Jahrmärkte und Wochenmärkte. Die Jahrmärkte, für deren Abhaltung in der Regel ein spezielles königliches Privileg nötig war, wurden von Fernhändlern beliefert, die Wochenmärkte hingegen von Bauern und Händlern aus der Umgebung. Neben Jahrmärkten und Wochenmärkten bildeten eine dritte Kategorie oftmals die Spezialmärkte – Handelsplätze für Pferde, Milch, Holz oder Eisen. Sie lagen bis ins hohe Mittelalter zumeist noch außerhalb des Mauerrings der Stadt. Erst die Stadterweiterungen des 14./15. Jahrhunderts haben sie in das urbane Leben einbezogen. Die Wege zu diesen Plätzen verkürzten sich, sie lagen jetzt unmittelbar „vor der Haustür“. Noch einmal wurde die städtische Attraktivität dadurch erheblich erweitert.
Wochenmarkt – Der Bauch der Stadt
Die Wochenmärkte waren der eigentliche „Bauch“ der Stadt; sie waren ganz auf die Bedürfnisse der täglichen Küche der Stadtbewohner ausgerichtet. Neben Produkten, die nur die entsprechende Jahreszeit liefern konnte, gab es hier auch Dinge, die davon unabhängig waren und die es das ganz Jahr über zu kaufen gab: Fleisch in hoch- oder minderwertiger Qualität, das die Händler vor den Augen der Käufer zerwirkten; Fisch aus Flüssen der Umgebung oder auch – in konservierter Form bis tief ins Binnenland hineingetragen – aus dem Meer; daneben Butter, Käse, Gewürze und Honig, das wichtigste Süßungsmittel des Mittelalters überhaupt. Doch nicht nur Lebensmittel, sondern auch Waren, die man benötigte, um Lebensmittel zu transportieren oder zu konservieren, wurden hier angeboten: geflochtene Körbe, Töpferei- und Metallwaren.
Der Markt als zentraler Ort im Leben der Stadt schlug sich auch im Stadtbild nieder, in den Ordnungen, in denen die Stadt entstand und weiterwuchs und wie sie noch heute – blickt man von einem Flugzeug auf die Stadt – erkennbar sind. Am häufigsten war der in der Mitte der Stadt gelegene Platzmarkt; es war der Platz, der alle anderen Plätze in der Stadt an Größe übertraf. Es gab aber auch, häufig vor allem in Bayern und Österreich, Straßenmärkte; wie an einer Perlenschnur zogen sich hier die Stände an den Straßenrändern hin, oft Hunderte von Metern lang.
Kleinere Städte scheinen fast nur aus einem einzigen langgestreckten Markt bestanden zu haben. Links und rechts davon stand oftmals nur eine ein- oder zweizeilige Häuserreihe. Dahinter begann bereits das Land, die andere Welt.
Vom Marktplatz zum Kaufhaus
Im späten Mittelalter verlagerte sich das Marktgeschehen, zumal in größeren Städten, von den offenen Märkten und Plätzen in die damals neu entstehenden Kaufhäuser. Wichtig waren vor allem die Vorhallen, unter denen die Waren, geschützt vor Regen, aufgestellt werden konnten. Größere Städte besaßen sogar mehrere Kaufhäuser. In Köln entstanden 1247 das Leinenkaufhaus, die Tuchhäuser Griechenmarkt und Oversburg, das Kaufhaus am Malzbüchel für Gewürze und Drogwaren (1388), die Tuchhalle (nach 1373), das Fischkaufhaus (vor 1426) sowie das berühmte Kaufhaus Gürzenich (1447).
Und doch auch eine Welt, die auf eine extreme Weise mit der Stadt immer wieder zu tun hatte. Das Wachstum der Städte hing auch mit der Leistungsfähigkeit ihres landwirtschaftlichen Umlands zusammen. Um 1200 wurde Paris zur eigentlichen französischen Hauptstadt. Und zu einer europäischen Metropole, einer der größten Städte des Kontinents im Mittelalter überhaupt. Nichts davon wäre denkbar gewesen, wenn Paris nicht inmitten der fruchtbaren Île-de-France gelegen hätte, die die Metropole mit Gütern versorgen konnte.
Schlafen und Übernachten,
Essen und Trinken
Der Globus ist heute ein Dorf, zumindest empfinden wir es so. Große Distanzen können mittels technischer Mittel von fast allen mühelos bewältigt werden. Beweglichkeit gehört zum modernen Leben. Man wird in einem Ort geboren, zieht von ihm weg, sieht ihn unter Umständen nie wieder; die Bindungen reißen ab.
Im Mittelalter – und noch lange darüber hinaus – blieben viele Menschen an ihrem angestammten Platz, ein Leben lang. Sie kamen über ihren engeren Umkreis nie hinaus. Die Kate und die Schenke, das Dorf und seine Weiden, die Ebene, die verschleierten Berge am Horizont – das war alles. Doch die mittelalterliche Gesellschaft war mobiler, als man lange glaubte; wer die Beständigkeit des Ortes, die stabilitas loci, für das ausschlaggebende Merkmal der Epoche hält, verkennt die Zeit. Nicht nur die Mächtigen und die Reichen, Kaiser und Könige, sondern, sofern sie die Mittel hatten, dies zu tun, Angehörige vieler gesellschaftlicher Gruppen waren unterwegs. Und je länger das Mittelalter dauerte, desto mehr nahm die Beweglichkeit der Menschen zu. Kaufleute und Fernhändler, Handwerker und Pilger, Juristen, Magister, Scholaren, Gesandte, Schreiber, Boten, sie alle mussten reisen. Sie kamen in die Stadt – nicht dauerhaft, sondern nur für einen Tag, höchstens zwei oder drei; dann zogen sie weiter. Doch sie brauchten ein Bett, ein Lager für die Nacht; sie mussten irgendwo untergebracht werden. Die herkömmlichen Formen der Gastlichkeit reichten dafür nicht mehr aus.
Um den wachsenden Bedarf an Übernachtungsmöglichkeiten zu decken, entstanden im 11. und 12. Jahrhundert in den Städten sogenannte Hospize (von lat. hospitium = Herberge, Gastzimmer). Gegen ein Entgelt konnten die Gäste hier nächtigen, zum Teil wurden sie auch verpflegt, doch meist mussten sie sich durch Einkäufe auf dem Markt selbst versorgen. Eine klare Unterscheidung von Gastwirtshäusern und einfachen Schenken lässt sich erst relativ spät, seit dem 14. Jahrhundert, ziehen; lange Zeit vermischten sich die Funktionen. Auch in einer einfachen Taverne konnte, wenn Not am Mann war, ein Lager bereitgestellt werden. Größe und Aussehen der Wirts- und Gasthäuser in der Stadt, die anfangs eher am Stadtrand lagen, mit dem Wachstum der Städte aber immer mehr in die Zentren wanderten, unterschieden sich oftmals sehr.
Es gab einfachste Absteigen, die in der Regel nur aus einem einzigen Raum bestanden und sich von den sonstigen Häusern in der Stadt äußerlich kaum unterschieden. Wirte, Gäste, Vieh, Reit- und Zugtiere, alles hielt sich hier auf; von Entspannung, gar von Komfort konnte da kaum die Rede sein. Es gab andererseits auch Häuser, die großzügig gestaltete, mehrteilige Anlagen waren. In der Mitte ein rechteckiger Hof, zu ebener Erde Ställe und Vorratskammern; in den Obergeschossen, beheizt durch die Wärme der Ställe, die Schlafgemächer. Das Ganze wirkte wie eine orientalische Karawanserei – ein Märchen aus Tausendundeiner Nacht, mitten in Europa. Je größer die Stadt, desto größer die Auswahl an Wirts- und Gasthäusern. Vor allem im Süden und Westen Europas, in den großen Städten Italiens, Frankreichs und Englands, gab es Häuser, die beste Qualität boten. Es war alles da: Ställe, Lagerkammern, Speise- und Aufenthaltsräume, Ein- oder Zweibettzimmer zur Wahl, mit frischer Bettwäsche, Schränke und Truhen zum Verstauen des Reisegepäcks, Tische und Stühle. Der Gast war hier buchstäblich König. Oder durfte sich zumindest für einen Tag lang so fühlen.
Gastlichkeit im frühen Mittelalter
Gastlichkeit im frühen Mittelalter war, von wenigen Ausnahmen abgesehen, vor allem nichtkommerziell; sie brachte den Gastgebern in der Regel keinerlei finanziellen oder wirtschaftlichen Gewinn. Sie beruhte zum einen auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit, der Gastfreundschaft, von welcher der Gastgeber erhoffte, dass er irgendwann einmal auch selbst davon profitieren konnte. Zum anderen bestand für den Hof des mittelalterlichen Herrschers, der ja nur in den wenigsten Fällen über eine dauerhafte Residenz verfügte, sondern sein „hohes Gewerbe im Umherziehen ausübte“ (A. Schulte), eine sogenannte Gastungspflicht. Man war verpflichtet, den König und sein Gefolge aufzunehmen und zu beherbergen. Vielfach galt dies auch für viele Personen, die im Auftrag des Herrschers öffentliche Funktionen verrichteten.
Wirtshäuser und ihre Kennzeichen
Die Gasthäuser in den Städten waren auf besondere Weise gekennzeichnet. Das war unbedingt notwendig in einer Zeit, in der viele Menschen nicht lesen und schreiben konnten. Schilder mit grün belaubten Ästen, Kränzen und Reifen zeigten die besondere Funktion dieser Häuser an; sie wurden gleichsam zu ihrer Signatur. In nicht wenigen Fällen haftet der mittelalterliche Name noch heute an diesen Häusern. Manchmal wies auch eine auffällige Farbe auf das Gasthaus hin. Das wohl älteste Gasthaus Deutschlands, der „Bären“ in Freiburg, für den eine Nutzung seit dem 12. Jahrhundert nachgewiesen ist, war signalrot angestrichen. So konnte jeder erkennen, dass es kein Haus war wie andere, dass sich etwas Besonderes dahinter verbarg. Wer nicht auf ein Haus mit Übernachtungsmöglichkeit angewiesen war, sondern, sei es als Einheimischer oder Reisender, nur essen oder trinken wollte, nutzte das Angebot der Bier- oder Weinschenken. Weinregionen und Bierregionen – die Unterscheidung gab es bereits im Mittelalter. Die Regionen an Rhein, Mosel und Main sind alte, zum Teil uralte Weinbaugebiete; bereits in römischer Zeit wurde dort die Weinrebe kultiviert und zum Getränk vergoren. In anderen Teilen Deutschlands dominierte an alkoholischen Getränken lange Zeit das Met, das mit dem Aufkommen städtischer Braukunst durch die Biere, die es – vom reinen Gerstensaft bis zum „vollgehaltigen“ Haferbier – in einer großen Bandbreite gab, zunehmend verdrängt wurde.
Was in den Gasthäusern und Tavernen hauptsächlich ausgeschenkt wurde, kam somit sicherlich stark auf die Gegend an, wobei sich auch in den klassischen Weinregionen im Spätmittelalter zunehmend das Bier, das wegen seines hohen Kaloriengehalts auch als Nahrungsmittel galt, als preisgünstige Alternative zum Wein durchsetzen konnte. Der Ausschank „harter Sachen“ wie Schnaps, Branntwein oder Weinbrand war im Mittelalter eher die Ausnahme. Destillate galten als Heil-, nicht als Genussmittel, und nur in einigen wenigen Städten deuten hohe Mengen an Schnapsverbrauch auf einen Konsum hin, der über eine medizinische Versorgung hinausgegangen sein muss. Wein und Bier im Ausschank: Der Bedarf scheint nicht gering gewesen zu sein. In der Stadt Schaffhausen lebten im 12. Jahrhundert etwa 1000 Einwohner. Ein um 1150 entstandenes Verzeichnis nennt zwölf bebaute Hofstätten mit neun Bier- und Weinschenken. Die Schaffhausener waren also in dieser Hinsicht gut versorgt – und in anderen Städten sah es nicht anders aus.
Spiele und Turniere –
Die Stadt als Ort der Vergnügungen
In der mittelalterlichen Stadt – vorausgesetzt, sie zählte zu den größeren – war so gut wie immer etwas los; es war schwer, sich in einer Stadt zu langweilen. Die Stadt war – freilich zu unterschiedlichen Jahreszeiten mit unterschiedlicher Intensität – der Ort der Spaßmacher und Entertainer der verschiedensten Couleur. Da waren die Spielleute, die mit Geige, Leier, Pfeife, Trommel oder Tamburin im Wirtshaus, bei Festen, Jahrmärkten und Messen für gute Laune sorgten. Da waren die Gaukler; seien es die Seiltänzer, die hoch zwischen den Häusern ihr Seil spannten, um unter dem bangen Staunen des Publikums darauf herumzubalancieren; seien es die Kunstreiter, die auf dem Rücken ihrer Pferde atemberaubende Übungen vorführten; seien es die Bärenführer, die ihre Bären tanzen und kunstvolle Akrobatik treiben ließen.
Da waren die Fechter, die mit ihren auf Nachahmung echter Rivalität ausgerichteten Künsten den Zuschauern einen Nervenkitzel der ganz besonderen Art boten. Da waren aber auch Wahrsager, Kristallseher, Zauberer und Teufelsbanner; mit ihren anrüchigen Praktiken boten sie dem Publikum einen verbotenen Schauder und geheimen Reiz. Teils waren diese ganz unterschiedlichen Gruppen in der Stadt selbst ansässig oder wurden es im Laufe des Mittelalters mehr und mehr; in nicht wenigen Fällen übten sie nebenher noch einen anderen Beruf aus, da von den Späßen und Possen allein kaum zu leben war. Teils wurden sie sogar – wie die Spielleute – vom Rat einer Stadt für die verschiedensten Gelegenheiten engagiert; städtische Rechnungsbücher zeigen, dass sich die Stadtväter derlei Aktivitäten durchaus etwas kosten ließen. Mehrheitlich aber zogen sie einzeln oder in größeren Gruppen vagabundierend von Ort zu Ort, um sich ihren zumeist kargen Unterhalt zu verdingen, sie zählten zum „Fahrenden Volk“.
Gewiss: Die mittelalterliche Stadt hatte in den wenigsten Fällen ein Monopol auf Unterhaltung. Viele dieser Künste, wenn sie denn als „Kunst“ galten, gab es andernorts zu bestaunen: an den Höfen, in königlichen Kreisen und in den Burgen des Hochadels, wo es stets ein begieriges Publikum gab. (Wie sonst hätte wohl der ottonische Kaiser Heinrich II. auf die Idee kommen können, einen Mann mit Honig einstreichen und ihn anschließend von einem Bären abschlecken zu lassen, um sich an der Angst des Mannes zu weiden? Der Bärenführer gehörte zum Hof wie zur Stadt.) Fahrendes Volk traf man aber auch in der dörflichen Gesellschaft, in den Schenken und Krügen auf dem Land, wo die Menschen zusammenströmten, wann immer sich Abwechslung vom täglichen Einerlei, den immer gleichen Diensten und Verrichtungen bot. Gaukler und Entertainer fanden sich im mittelalterlichen Heer, in dem Pfeifer und Trompeter zum Angriff bliesen, um den Kämpfenden Mut und die Schrecken des Kampfes vergessen zu machen. Aber die wachsende Welt der Städte bot für sie doch ein ganz besonderes Betätigungsfeld. Sie wurde zu ihrem Ort par exellence.
Nur in den Städten konnte man ein Seil zwischen hohen Häusern spannen. Nur in den Städten waren die Wirtshäuser immer voll. Nur in den Städten gab es Jahrmärkte und Messen. Auf der Frankfurter Messe wurden im 15. Jahrhundert von einem Schausteller exotische Tiere gezeigt – Elefanten, Pelikane, Auerochsen. Auf der Leipziger Messe im frühen 16. Jahrhundert führten Schausteller einen beweglichen Automaten vor. So bunt gewürfelt, so verschieden die Gruppe auch ist: Die Spielleute zählten in vielen Fällen zu den Randgruppen und Außenseitern der mittelalterlichen Gesellschaft. Ihre Tätigkeit wurde vor allem in kirchlichen Kreisen als sündhaft bezeichnet. Sie wurden in scharfer, ja ätzender Form kritisiert. Doch merkwürdig (oder auch nicht): Die Gesellschaft, die sie ächtete, bediente sich ihrer auch; sie ließ sich von den Spielleuten von Sorgen und Nöten des Alltags nur allzu gern für einen Moment befreien.
Das Turnier
Auch die höfische Welt des Mittelalters, die nicht in den Städten, sondern an den Höfen der Könige und Fürsten ihren Ursprung besaß, hatte ihre Ableger in der Stadt. Nicht nur im Rahmen glanzvoller Feste des Hochadels, auch von den Städten wurden Ritterspiele abgehalten – nicht nur vor ihren Mauern, wie das vor den Toren Würzburgs 1127 in Deutschland erstmals überhaupt bezeugte Turnier, sondern bald auch innerhalb der Mauern selbst. Die ritterlich-höfische und die bürgerlich-städtische Kultur des Mittelalters vermischten sich zusehends. Reiche Stadtbürger wollten es dem Adel mehr und mehr gleichtun, sie ahmten seine Lebensformen zunehmend nach, in ihren Bauten wie in ihrem Freizeitverhalten. Zu diesen adeligen Lebensformen gehörte auch das Turnier.
Zu Pfingsten 1280 luden die Constofler Magdeburgs zu einem großen Turnier in die Mauern ihrer Stadt. Die Einladungsschreiben der Constofler gingen hinaus nach Goslar, Hildesheim, Braunschweig und in viele andere Städte. Die Geladenen kamen in Scharen. Mit ihren teuren Turnierrössern, geschmückt mit wappenverzierten Pferdedecken, wurden die Delegationen auf einem freien Feld vor Magdeburg feierlich empfangen. Auf dem Marktplatz hatte man derweil einen Baum aufgeschlagen, an dem die Constofler, die an den Spielen teilnehmen wollten, ihre Schilde aufgehängt hatten. Am Pfingstsonntag, nach der feierlichen Messe, begann das Turnier. Die Ritter der fremden Städte berührten die Schilde der Magdeburger an dem Baum – Zeichen der Herausforderung des Gegners zum Kampf. Danach Schwertergeklirr und das Krachen der Lanzen, das Gedonner der Hufe und der Jubel der Massen. Als Preis für den Sieger ausgelobt, so der Chronist, der uns die Ereignisse überliefert, hatten die Magdeburger eine Prostituierte, eine Frau namens Feie, die in der Stadt wohl gut bekannt war. Der sie gewann, war ein „alter Kaufmann“ (ein olt kopman) aus Goslar. Der nahm sie mit und sorgte dafür, dass sie verheiratet wurde – ritterliches Verhalten nach Gewinn eines Preises, der uns heute recht unritterlich erscheinen mag, der jedoch typisches Merkmal städtischen Lebens war.
Die Constofler
Die Constofler waren eine der großen Geschlechtergesellschaften Magdeburgs. Sie setzten sich zusammen aus der erzbischöflichen Ministerialität sowie den bedeutendsten Kaufleuten in der Stadt. Die Magdeburger Kaufleute spielten in der Geschichte der Stadt eine besondere Rolle; wurden sie doch vom Magdeburger Erzbischof Wichmann im 12. Jahrhundert weitreichend privilegiert. Bei den Constoflern verbanden sich also die beiden Machtzentren der Stadt, der erzbischöfliche Hof und die Kaufleute.
Die Städter – so scheint es – waren regelrecht süchtig nach solchen Turnieren. Über die dichte Folge derartiger Darbietungen geben die Kölner Stadtrechnungen Aufschluss, die solche Schauspiele für die Jahre 1371–1375 und von 1378–1380 verzeichnen. Die Spiele wirkten wie ein Magnet, kaum jemand blieb fern, jeder wollte zusehen – auch die Ratsherren. Der Kölner Rat mietete sich am „Alten Markt“, dem Schauplatz der Turniere, extra ein Haus, weil das Rathaus damals noch keine Aussicht auf den Ort des Geschehens bot.
Pflegen und Heilen
Pflege und Heilung von Kranken und Schwachen gab es im frühen Mittelalter nur im Kloster. Hier entstand das mittelalterliche Spital. Hervorgegangen aus dem Gebot der christlichen Nächstenliebe wurden Kranken und Schwachen nicht in der Stadt, sondern zuerst in der Gemeinschaft der Mönche Unterkunft, Hilfe und Pflege zuteil. Als die Städte wuchsen, nahm die Zahl derer, die Hilfe bedurften, sprunghaft zu. Der Krankheiten waren viele: so der schreckliche Mutterkornbrand, das „heilige Feuer“ (ignis sacer) oder auch Antoniusfeuer genannt, eine Krankheit, die durch den Verzehr von mit Mutterkorn-Pilz befallenem Roggen verursacht wurde und ein quälendes Leiden, ein Absterben der Finger und Zehen sowie – im schlimmsten Fall – auch den Tod zur Folge haben konnte; so die Lepra, der Aussatz. Diejenigen, die sich dieses Problems annahmen, waren zunächst die Mitglieder spezieller Spitalorden. Einer davon war der Antoniter-Orden, der 1095 als Laienbruderschaft in Südfrankreich gegründet und von Papst Urban II. noch im gleichen Jahr bestätigt wurde; seine Aufgabe war zunächst hauptsächlich die Behandlung der am Antoniusfeuer Erkrankten, dehnte sich aber auch auf die Heilung anderer Krankheiten aus. Der Antoniter-Orden nahm einen ungeheuren Aufschwung; im 15. Jahrhundert unterhielten die Antoniter – seit 1247 nach den Ordensregeln des hl. Augustinus lebend, 1298 in einen Chorherrenorden umgewandelt – ca. 370 Spitäler in ganz Europa. Aber auch die Ritterorden, die im Gefolge der gewaltigen, das gesamte Abendland erfassenden Kreuzzugsbewegung um 1100 entstanden waren, hatten einen karitativen, dem Spitaldienst gewidmeten Aspekt.
Ritterorden und Spitaldienst
Der älteste geistliche Ritterorden, der in der Spitalpflege tätig war, war der Orden der Johanniter, der in der 2. Hälfte des 11. Jahrhunderts zu Jerusalem gegründet wurde. Auch der 1118 gegründete Templerorden war in der Spitalpflege aktiv. Der Deutsche Orden wurde im Zuge des 3. Kreuzzuges 1189/90 durch Lübecker und Bremer Kaufleute im Hospital St. Marien der Deutschen zu Jerusalem gegründet. Er wurde 1198 zu einem Ritterorden, mit Sitz in Akkon, umgewandelt, ohne dass er damit seine ursprüngliche Aufgabe – die Krankenpflege – aus dem Auge verlor.
So waren es die Ritterorden, die in den Städten die ersten Spitäler errichteten oder diese übernahmen – eines der bekanntesten Beispiele dafür ist das von der hl. Elisabeth, der ungarischen Königstochter und Gemahlin des thüringischen Landgrafen Ludwigs IV., in Marburg an der Lahn errichtete Spital, das nach Elisabeths frühem Tod 1231 in die Hände des Deutschen Ordens überging. Neben den Spitälern, die von den Kreuzzugsorden errichtet wurden, entstanden aber bald auch solche Anlagen, die von einem Orden unterhalten wurden, der – ohne den Rittergedanken – speziell für die Bedürfnisse der Kranken und Schwachen in den Städten gegründet worden war: dem Heiliggeist-Orden.
Der Heiliggeist-Orden
Gegen Ende des 12. Jahrhunderts schlossen sich in Frankreich unter Guido von Montpellier eine Reihe von Bruderschaften der Hospitalorden sowie Männer und Frauen aus dem Laienstand zusammen und gründeten einen neuen Orden. Sie setzten sich das Ziel, als bürgerlicher Hospitalorden ihre Unabhängigkeit zu erringen. Bereits 1198 wurde der Heiliggeist-Orden in Montpellier von Papst Innocenz III. privilegiert; die Privilegierung sah vor, dass die Hospitäler des Ordens der weltlichen Verwaltung unterstellt werden konnten. 1204 berief Innocenz den Orden an das Spital Santo Spirito in Sassia zu Rom, das schließlich zu seinem Hauptsitz wurde.
Der Heiliggeist-Orden wurde im Laufe des Mittelalters überaus erfolgreich; sein Name wurde immer mehr zu einem Markenzeichen, man könnte auch sagen: einem Gütesiegel. Bald wurden in den Städten auch Hospitäler gegründet, hinter denen nicht der Heiliggeist-Orden selbst, sondern der städtische Rat stand; doch auch sie verwendeten häufig den Namen „Heiliggeist-Spital“. Immer häufiger nahm der Rat die Spitäler in seine Hand, sei es, dass er den bisher dominierenden Heiliggeist-Orden aus der Leitung verdrängte, sei es, dass er selbst solche Spitäler gründete. Am Ende des Mittelalters waren die städtischen Spitäler sehr reich. Sie besaßen vielfach großen Grundbesitz – in der Stadt selbst, aber häufig auch im Umland. Die Spitäler waren auch Wirtschaftsunternehmen, welche die technischen Möglichkeiten ihrer Standorte nutzten und mit den Produkten ihrer Ländereien Handel trieben. Das Nördlinger Spital betrieb beispielsweise eine eigene Mühle und engagierte sich im Pferdehandel. Das Würzburger Julius-Spital machte aus dem Wein seiner Rebberge ein lukratives Geschäft. Ökonomie hin, Ökonomie her: Die Spitäler waren und blieben Einrichtungen geistlichen Ursprungs. Sie waren letztlich Gott verpflichtet, besaßen alle eine eigene Kapelle, um den täglichen Gottesdienst abhalten zu können, und der Spitalsbetrieb selbst war zuweilen einem fast klösterlichen Reglement unterworfen, in das sich die Kranken zu fügen hatten.
Die Kirche des Spitals war eine der Hauptursachen dafür, dass sich viele Stadtregierungen so sehr um die Lenkung des Spitals bemühten. Über das Spital vermochten sie so gleichsam eine eigene Kirche zu unterhalten, unabhängig von den städtischen Pfarrkirchen, auf die sie keinen oder nur geringen Einfluss nehmen konnten. Der Aufenthalt in einem Spital war kostspielig, zumal sich die Spitäler immer mehr von der Armen- und Krankenfürsorge für alle zur Versorgung der Stadtbürger, auch unter dem Aspekt eines Altersheimes, wandelten. Nur die reichsten Bürger konnten sich schließlich einen Aufenthalt in einem solchen Spital ohne Weiteres leisten. Und die soziale Unterscheidung der Patienten wurde, je länger das Mittelalter dauerte, immer schärfer. So etwa im Spital zu Biberach in Schwaben: Die Unterschiede sind krass bezeugt. Vier Tische standen im Speisesaal nebeneinander: der Tisch der Armen, der Tisch der Kinder, der Tisch der Narren; schließlich der Tisch der Reichen, die sich groß eingekauft hatten und alles besaßen, was die anderen entbehrten: vor allem Fleisch und helles, leicht zu kauendes Brot.