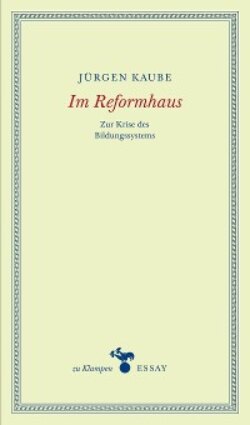Читать книгу Im Reformhaus - Jürgen Kaube - Страница 7
Was Schule leisten soll und kann
ОглавлениеDREIERLEI steht fest, wenn heute in Deutschland über Bildung gesprochen wird: Wir haben, erstens, zuwenig davon. Die Chancen, an Bildung zu gelangen, sind, zweitens, zu ungleich verteilt. Die Schule kann, drittens, beides ändern.
Mitunter scheint es geradezu, als könne Schule, wenn sie nur richtig eingerichtet wäre, an den Individuen alles gutmachen, was die Gesellschaft an Unvernunft und Ungerechtigkeit oder jedenfalls Ungleichheit verwirklicht. Die Belege dafür, daß das geht, kommen aus dem Ausland. Schon beim Verweis auf das bildungspolitische Arkadien, Finnland, mochte man sich allerdings fragen, ob die Schüler aus den Schulen des Pisa-Spitzenreiters im Bereich Lesen nicht auch deshalb so gleich herauskommen, weil sie in entscheidender Hinsicht so gleich hineingekommen sind. Es gibt in Finnland keine Kinder, die nicht die Unterrichtssprache sprechen; es gibt keine ethnische Unterschichtung; es gibt wenig Großstädte; und die Einkommensungleichheit ist eine der geringsten unter den entwickelten Ländern.
Der Soziologe Heinz Bude hat jetzt auf vergleichbare Korrekturen hingewiesen, die an dem Bild vorgenommen werden müssen, das vom japanischen Schulsystem existiert, insofern es auch hier gelungen sein soll, Leistungsstärke – vor allem im Bereich der Mathematik und Naturwissenschaften – mit der Kompensation von Herkunftsnachteilen zu verbinden.1 Tatsächlich wechseln 97 Prozent der Schüler in Japan nach sechsjähriger Elementar- und dreijähriger Mittelschule auf die Oberschule, wodurch das »Abitur« zum Bildungsminimum wird. Sitzenbleiben ist ausgeschlossen.
Die gesellschaftliche Selektion der Bildungszertifikate setzt darum von oben ein: Das Ansehen der Hochschulen bestimmt sich nach der Übergangsquote ihrer Absolventen zu den großen Firmen. Die Oberschulen werden danach sortiert, welche die meisten Übergänge zu den erfolgreichen Hochschulen vorweisen kann, und so weiter bis zum Kindergarten hinunter. Auf jeder Stufe lösen Aufnahmeprüfungen das Knappheitsproblem. An fünfzigtausend Ergänzungsschulen werden die Schüler von privaten Anbietern abends und an den Wochenenden bearbeitet. Das mobilisiert erhebliche Ersparnisbildung und erheblichen Druck, der sich allerdings an staatlichen Schulen nicht zeige, weil sich die Schüler dort von ihrem Zusatzunterricht erholten.
Zurück zur Beschreibung der deutschen Bildungsproblematik. Den Beleg dafür, daß es zuwenig Bildung gibt, liefern die Zahlen der Schulabgänger ohne Zeugnis sowie die Pisa-Daten, die von Scharen Fünfzehnjähriger berichteten, die nicht wissen, was »desinfizieren« bedeutet. Hinzu kommen die niederschmetternden Zahlen zum Analphabetismus in der Bevölkerung. Geschätzte 7,5 Millionen Erwachsene sind in diesem Land nicht in der Lage, auch nur kurze Texte zu verstehen.2
Zugleich werden allerdings Abiturientenanteile an den Geburtsjahrgängen von deutlich mehr als dreißig Prozent ermittelt. Daß das Gymnasium ein »Refugium der Selbstähnlichkeit« und ein Ort »sozialer Endogamie« sei, der von Abstiegs- und sozialer Ansteckungsangst geplagten Mittelklassen zäh verteidigt werde, wie Bude formuliert, dürfte angesichts der Bevölkerungsanteile, die es inzwischen aufnimmt, eine etwas kompakte Darstellung sein. Nimmt man die Fachhochschulreife hinzu, so ist abzusehen, daß bald die Hälfte eines Jahrganges zum Studium berechtigt ist. Wie homogen soll man sich die Hälfte der Bevölkerung vorstellen?
Der Bildungspolitik jedenfalls erscheinen die heutigen Zahlen noch zu gering. Zuletzt hat der allgemeine Parteienkonsens, die Hauptschule abzuschaffen, der in vielen Regionen, vor allem aber in Großstädten praktisch auf die Abschaffung der Realschule hinausläuft, an die nun die schwächsten Schüler überwiesen werden, den bildungspolitischen Willen unterstrichen, die Bevölkerung um jeden Preis mit höherwertigen Zertifikaten auszustatten. Unter Verweis auf die Wissensgesellschaft und auf die Abitursquoten anderer nationaler Bildungssysteme – Finnland und Irland mehr als neunzig Prozent, OECD-Durchschnitt um sechzig Prozent, die Schweiz allerdings unter dreißig Prozent – kann sie sich weitere Steigerungen vorstellen.3
Bei den Hochschulen und Gymnasien trifft das zumindest dort, wo das Interesse am Wachstum der eigenen Organisation nicht völlig die Sprechweise beherrscht, auf eine eigene Diagnose von Bildungsdefiziten. Man konstatiert mangelnde Hochschulreife der Erstsemester, also einen erheblichen Nachschulungsbedarf. Man beobachtet Unvertrautheit mit elementaren Lektüren, ja mit dem Lesen selber, von Mathematik ganz zu schweigen, deren Stoff der achten Gymnasialklasse von angehenden Betriebswirten nachgeholt werden muß. Man hält es an Universitäten nicht für ausgeschlossen, demnächst Einheimische in Deutschkursen unterweisen zu müssen, an den Schulen beobachtet man Verschiebungen von Unterrichtsstoff in spätere Klassen, und in allen Bildungseinrichtungen hat man sich seit langem an Prüfungen gewöhnt, die kein »nicht bestanden« mehr kennen. Die Tatsache, daß die entsprechenden Klagen über den Zusammenhang von »upgrading access and downgrading skills« bildungsgeschichtlich nichts Neues sind, sagt übrigens nichts darüber, ob sie heute zutreffen. Forschung dazu fehlt.
Immerhin ist aber seit langem klar, was Bude als die »Exklusivitätsfalle« und als den »perversen Effekt der Inflation von Bildungszertifikaten durch Bildungsexpansionen« bezeichnet. Wenn ein Betriebswirtschaftsstudium und nicht nur die Mittlere Reife samt Sparkassenschule von denen verlangt wird, die in Bankfilialen Bausparverträge verkaufen dürfen, geht das nicht auf neue Bedürfnisse der Wissensgesellschaft zurück, sondern auf die Bildungsexpansion. Es entwerten sich alle Abschlüsse unterhalb des Abiturs, und wenn daraufhin der Zugang zum Gymnasium zusätzlich erweitert wird, verliert auch das Abitur an Informationswert, und es setzen neuerliche Distinktionsbemühungen ein. Wer in sie – Privatschulen, Kindergärten mit Frühchinesisch, Auslandsjahre etc. – am besten investieren kann, ist nicht schwer zu beantworten. Der starre Blick auf die Verteilung der Zertifikate und die Illusion, gesellschaftliche Gleichheit lasse sich durch pädagogische Gleichheit herbeiführen, verschärft in Wahrheit die Positionskämpfe und die Lage der in ihnen Unterliegenden.
Der zweite stets wiederholte Befund gilt dieser Lage und betrifft den in Deutschland besonders ausgeprägten Zusammenhang zwischen Bildungserfolg und sozialer Herkunft. Kinder leitender Angestellter, heißt es beispielsweise, hätten eine 2,4 mal so hohe Chance, ein Gymnasium zu besuchen wie Facharbeiterkinder. Allerdings dürften sich auch leitende Angestellte, sofern sie nicht in der Ungleichheitsforschung tätig sind, unsicher sein, was das genau heißen soll. Es ist zumeist die etwas eigenwillige Formulierung dafür, daß 52 Prozent der Angestelltenkinder das Gymnasium tatsächlich besuchen und 26 Prozent die Realschule, wohingegen die Verteilung bei den Facharbeiterkindern 21 Prozent zu 25 Prozent ist. Berechnet man nun das Verhältnis der Kreuzprodukte (52 mal 25 geteilt durch 21 mal 26), so erhält man das Chancenverhältnis.
Daß der entsprechende Wert vor sechzig Jahren noch bei 36 lag und fast niemand das erwähnt, ist so bemerkenswert wie die Tatsache, daß er gar nichts mit der Wahrscheinlichkeit der Bildungschancen einer bestimmten Person zu tun hat. Die nämlich ist ja nicht nur »Facharbeiterkind«, sondern eventuell auch Mädchen, Tochter einer Mutter, die vorliest, Schülerin einer ländlichen Grundschule, Migrantin, Freundin von Kindern leitender Angestellter und so weiter – mit jedes Mal anderen Chancenverhältnissen.
Aber die Bildungssoziologie interessiert sich, wie man ihren Lehrbüchern entnehmen kann4, nicht sehr für die Wirklichkeiten, aus denen ihre Daten stammen, sie hält die Daten selber für die Wirklichkeit. Eine Berechnung beispielsweise, wie hoch die relativen Bildungschancen für Arbeiterkinder und Oberschichtenkinder sind, deren Eltern jeweils schuladäquat bzw. -inadäquat erziehen, wird nicht angestellt. Dabei wäre es soziologisch ja gerade wissenswert, wodurch eine solche gängige »Variable« wie die Schichtzugehörigkeit, der Beruf oder der Bildungsgrad des Vaters Einfluß auf die kognitiven Möglichkeiten und das Verhalten von Kindern hat. Sind die Ressourcen (Geld, Zeit, Kraft, Wissen) ausschlaggebend, die Einstellungen zur Schule, die Kommunikationsstile, die Risikowahrnehmung? Studien wie die des italienischen heute in Oxford lehrenden Soziologen Diego Gambetta, die sich nicht mit pauschalen Verweisen auf ungleich verteiltes »kulturelles Kapital« begnügen, sondern Lebensentwürfe und ungleich verteilte Risikobereitschaften sowie Kostenkalkulationen einbeziehen, sind die Ausnahme geblieben.5
Die gängige Bildungssoziologie führt also vor das Paradox, daß sie die Familien und die Schulen als die Ursachen der Bildungsungleichheit bezeichnet, aber weder über Familien noch Schulen viel zu sagen hat. Wieso beispielsweise werden überhaupt Eigenschaften des Haushaltsvorstandes zur »Erklärung« von Schulerfolgen herangezogen, wo es doch in vielen Fällen nach wie vor – und selbst bei Doppelverdienern – die Mütter sind, denen die meisten familiären Erziehungsaufgaben zufallen? Oder: Was ist aus den Bildungsambitionen der Arbeiterschaft geworden? Weshalb wird die soziale Lage in vielen Milieus inzwischen oft als schicksalhaft interpretiert? Weil sie objektiv fataler ist als in der Unterschicht vor hundert Jahren?
Einer Antwort auf solche Fragen kommt man nicht durch Statistiken näher. Die Bildungsforschung aber ist in Deutschland eine Art Filiale des Statistischen Bundesamtes und des Pisa-Konsortiums geworden. Das Max-Planck-Institut gleichen Namens befaßt sich mit allem Möglichen – Altern, Rationalität unter Ungewißheit, Geschichte der Gefühle –, aber nicht mit Unterricht, Erziehung und familiärer Sozialisation. Und was als »empirische Bildungsforschung« immer mehr Lehrstühle an sich zieht, ist tatsächlich eine Disziplin, deren Empirie selbsterzeugte Zahlenkolonnen sind.
Wie das statistische Bewußtsein die Soziologie der Schule überlagert, zeigen Untersuchungen wie eine am Berliner Wissenschaftszentrum durchgeführte, in der eine Kritik des gegliederten Schulsystems daraus gezogen wird, daß die Ergebnisse von Intelligenz- und Persönlichkeitstests an siebzehn- bis neunzehnjährigen Schülern gegenüber der Verteilung derselben Schüler im Alter von zehn Jahren auf die hergebrachten drei Schultypen abwichen.6 Auf dem Gymnasium fanden sich sowohl überproportional Schüler mit akademisch gebildeten Eltern als eben auch Schüler, die weniger Punkte in jenen Tests erzielten als Real- und sogar Hauptschüler, die zumeist Eltern ohne Abitur und Studium haben. Das könnte dem schon bei Gambetta ausgeführten Befund entsprechen, daß die Mittelschicht dazu neigt, ihre Kinder zu überschätzen, in Arbeiterfamilien hingegen Bildungslaufbahnen eher konservativ geplant werden. Für Gambetta war letzteres allerdings keine Frage der Fehleinschätzung, sondern einerseits der ökonomischen Ressourcen, andererseits der größeren Empfindlichkeit der Arbeiterfamilien für schulische Mißerfolge, die schneller als Hinweis auf eine gebotene »bescheidene« Bildungskarriere gedeutet werden.
Die Berliner Forscher hingegen hielten nicht nur Intelligenztests an und Selbstauskünfte von Achtzehnjährigen zu ihrer Persönlichkeit für informativ in der Frage, wie sich das Lernverhalten dieser Schüler während ihrer Sekundarschulzeit darstellte. Die Möglichkeit, daß die Realschülerin durch ihre Schule – was mehr heißt als »durch den Schultyp ihrer Schule« – zu dem wurde, als was sie mit achtzehn dann im Test erschien, wird nicht erwogen. Wozu die Schüler ihre Intelligenz verwenden, kommt im Argument ebenfalls nicht vor. Bude, der die Berliner Untersuchung zitiert, weist auf die Möglichkeit hin, dass Begabung auch zum Normbruch und zur Distanzierung gegenüber Leistungserwartungen eingesetzt werden kann.
Die Forscher jedoch schließen daraus, daß Intelligenztests nur »12 bis 26 Prozent« der Schulleistung erklären und dreißig Prozent ihrer Stichprobe zu hoch oder zu niedrig plaziert waren, auf ein fehlkonstruiertes Schulsystem. Da die Lehrer offenbar entweder nicht zutreffend benoten bzw. die falschen Laufbahnempfehlungen abgeben oder Lehrer wie Eltern die Potentiale der Kinder nicht erkennen, sei eine möglichst späte Selektion geboten. Daß die Schule nicht Intelligenztests, sondern Unterricht, Klassenarbeiten und Urteile von Lehrern anbietet, erscheint vor den Prämissen dieser Art Bildungssoziologie erstaunlich. In ihrer Konsequenz läge es deshalb nicht einmal, die Schultypen abzuschaffen, sondern die schulische Selektion durch eine soziologisch-psychologische zu ersetzen und die Laufbahnempfehlung aus Intelligenztests abzuleiten.
Das Desinteresse der Bildungssoziologen an der tatsächlichen Schule, von deren richtiger Einrichtung sie doch zugleich alles erwarten, hat methodische Gründe. Der in Chicago lehrende Soziologe Andrew Abbott hat vor längerem schon in brillanten Aufsätzen auf die Blindheiten einer Forschung hingewiesen, für die soziale Wirklichkeit aus den kausalen Zusammenhängen besteht, die zwischen Personenmerkmalen (Geschlecht, Konfession, Einkommen der Eltern, Wohnort etc.) und anderen Personenmerkmalen (Bildung, Berufstätigkeit, Einkommen) herrschen.7 Dabei gerate aus dem Blick, wie, wo und wann konkret es die Ursachen denn machen, daß sie Wirkungen haben. Und es verliere sich das soziologische Urteilsvermögen für die Vieldeutigkeit sozialer Tatbestände: Wenn Gymnasiasten, so Abbott, weniger oft straffällig werden als arbeitslose Jugendliche gleichen Alters, dann könne es an ihren Einstellungen liegen, an normativen Gepflogenheiten ihres Milieus, an ihrem durchschnittlichen Wohlstand – oder einfach daran, daß ihnen die Schule weniger Zeit für Straftaten läßt. In der Statistik erscheint nur ein »Zusammenhang« von Bildung und Devianz, der sozial eventuell aber gar keine Rolle spielt.
Auch die Bildungsforschung ist ein solcher Fall von Variablensoziologie. In ihr kommt nicht vor, daß ein und dieselbe Merkmalszuschreibung entgegengesetzte Verhaltenserwartungen begründen könnte. Führt die Tatsache, daß die Eltern Migranten sind, wegen der durchschnittlichen Einkommensschwäche dieser Gruppe zu Bildungsrückständen oder wegen der Ambitionen dieser Gruppe auf Neuanfang sowie ihrer Bereitschaft, Entbehrungen auf sich zu nehmen und sich auf unbekannte Umgebungen einzustellen, gerade zu Bildungsaspirationen? Die Variable selber gibt darüber keine Auskunft. Wieso korreliert der sozioökonomische Status der Eltern auch mit ihrer Bereitschaft, den Kindern vorzulesen, wenn Vorlesen in einer Gesellschaft mit Leihbibliotheken gar kein Geld kostet? Weshalb schrecken Studiengebühren angeblich Abiturienten aus einkommensschwachen Milieus vom Studium – aber nicht vom Mobiltelefonieren und vom eigenen PKW – ab, ohne daß die regional unterschiedliche Einführung von Studiengebühren Wanderungsbewegungen auslöst? Hängt es, in den Worten Abbotts, mit einer fundamentalen Zweideutigkeit der Kategorie »Einkommen« als Quelle sowohl des Sparens wie auch des Konsums zusammen, die es verwehrt, aus der Einkommenshöhe eindeutige Schlüsse auf Verhalten zu ziehen? Wie soll es kommen, daß das Kind eines Facharbeiters zu jedem Zeitpunkt seiner Bildungslaufbahn das Kind eines Facharbeiters ist, sobald es jedoch die Hochschulreife erworben und studiert hat, seine eigenen Kinder Akademikerkinder sind, die gewissermaßen der Herkunftsklasse ihrer Eltern verlorengegangen sind und nicht mehr in deren Erfolgsbilanz eingestellt werden?
Würde die Bildungssoziologie mehr über ihre Variablen und ihre Kausalitätsbegriffe nachdenken, was sie nicht tut, so wäre dadurch allerdings die Frage nach der schulischen Wirklichkeit, die daraus Folgerungen zu ziehen hätte, noch nicht beantwortet. Ob überhaupt Unterricht stattfindet, ist in bezug auf die zur »Restschule« heruntergeredete Hauptschule vielerorts die wichtigere Frage als die nach der sozioökonomischen Zusammensetzung ihrer Schülerschaft. Der Kampf gegen die Schulstruktur, der sich mit Ungleichheitsforschung munitioniert und insofern zum Denken in Variablenkausalität paßt, verdeckt womöglich, wie sehr die Bildungserfolge vom Unterricht und von der professionellen Stabilität des Lehrpersonals abhängen anstatt von der Struktur des Schulwesens. Daß die Schule nicht voraussetzungslos arbeitet, kommt hinzu. Soziologisch betrachtet, ist es unwahrscheinlich, daß eine Organisation, die über wenig mehr verfügt als Unterrichtsstunden, auszugleichen vermag, was, je nach Deutung, der Kapitalismus, die Klassengesellschaft, die Medien oder die Familien angerichtet haben. Vermutlich wäre viel gewonnen, wenn man sie tun ließe, was sie kann, anstatt sie ständig im Hinblick auf etwas zu reformieren und zu kritisieren, was ohnehin nicht in ihrer Macht steht.