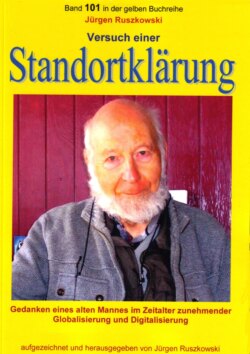Читать книгу Versuch einer Standortklärung - Gedanken eines alten Mannes im Zeitalter zunehmender Globalisierung und Digitalisierung - Jürgen Ruszkowski - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Frühe Erfahrungen zur Standortklärung
ОглавлениеDie Psychotherapeutin Verena Kast schreibt in ihrem Buch ‚Was wirklich zählt, ist das gelebte Leben’: „Aspekte der Lebensgeschichte … zu erzählen … kann helfen sich mit dem Leben zu versöhnen. In ihnen zeigt sich unser Gewordensein, und mit ihnen zeigen wir anderen Menschen, wie wir geworden sind.“
Meine Vaterstadt Stettin – Schiffe auf der Oder
Im Januar 1935 in Stettin geboren und im Herbst 1941 eingeschult, habe ich noch gute Erinnerungen an die braune deutsche Vergangenheit und die schlimmen Folgen.
„Gebt mir zehn Jahre Zeit, und ihr werdet Deutschland nicht wiedererkennen“, hatte der Rattenfänger Adolf aus Braunau verkündet.
Am 1. September 1939 war ich vier Jahre alt. Unser ‚Führer’, der „größte Feldherr aller Zeiten“ (mit vorgehaltener Hand GröFaZ genannt) Adolf, Gastarbeiter aus Braunau in Österreich, verkündete über den Volksempfänger im Wohnzimmer, es werde in Danzig seit 5 Uhr in der Früh „zurückgeschossen“. Meiner Mutter Vater war im 1. Weltkrieg gefallen. Sie wusste also, was Krieg bedeutet. Ich kann mich an ihre Angst bei Kriegsbeginn vor der „Goebbelsschnauze“ noch sehr gut erinnern. Die meisten Deutschen waren – anders als Anfang August 1914 – gar nicht begeistert von des Führers Kriegsspiel.
Im Herbst 1941 wurde ich in Stettin-Altdamm eingeschult.
Meine erste Schule in Stettin-Altdamm überlebte den 2. Weltkrieg.
Für kurze Zeit lernte ich auch noch die alte deutsche Sütterlin-Schreibschrift.
Mein Schulweg führte mich an einem Gefangenenlager für russische Kriegsgefangene vorbei, die damals als Untermenschen galten und erheblich schlechter behandelt wurden als gefangene Engländer und Franzosen.
Einmal gab es im nahen Wald einen großen Menschenauflauf. An einem Baum wurde ein Pole erhängt, der irgendein „Verbrechen“ an Deutschen begangen haben soll. Die in Lagern gefangen gehaltenen polnischen „Fremdarbeiter“ mussten „zur Abschreckung“ in langen Kolonnen unter dem Gehängten vorbeidefilieren.
Ich erinnere mich auch noch daran, dass sich eines Tages vor einem Haus in unserer Straße ein Drama abspielte, indem die Obrigkeit im Zuge der Euthanasie einen geistig behinderten jungen Mann gegen den Willen der Mutter „abholte“.
Der Krieg kam dann 1943 auch an die „Heimatfront“: Immer öfter musste meine Mutter mit uns Kindern nachts in den Luftschutzkeller. Im Herbst 1943 sollten wir, ich war acht Jahre alt, mit meiner Schule wegen des Bombenkrieges nach Grimmen in Vorpommern evakuiert werden. Meine Mutter zog es vor, mit uns auf den Bauernhof ihres Bruders Walter nach Dischenhagen (heute Dzisna / Dzieszkowo) im Kreis Cammin in Hinterpommern zu gehen. Das Haus meines Onkels wird seit 1945 wird von Polen bewohnt.
Unten rechts im Bild als Schuljunge bei der Ernte in Hinterpommern
Im Sommer 1943, meine Mutter war 33 Jahre alt, sah sie ihren Lieblingsbruder Walter zum letzten Mal, als sie ihn mit Pferd und Wagen durch den Wald nach dem Fronturlaub zum Bahnhof Honigkaten fuhr. Auf dem Wege offenbarte er ihr, dass er den Krieg für verloren und Hitler und seine Helfer für Verbrecher halte. Er habe in Russland zu viel gesehen: „Vom Unteroffizier aufwärts sind das alles Schweine. Diesen Hunden gönn’ ich den Sieg nicht. Ich hab’ das Gefühl, ich komm’ in russische Gefangenschaft und da nie wieder raus.“ Er setzte sich dafür ein, dass man den polnischen Zwangsarbeiter Jan, der während seiner kriegsbedingten Abwesenheit vom Hof die landwirtschaftlichen Arbeiten erledigen musste, gut behandeln soll. Seine letzte Post kam im August 1944 aus Rumänien, bevor die Rumänen sich von Deutschland ab und den Sowjets zuwandten. Das besiegelte auch sein Schicksal. Er galt seither als „vermisst“.
Im Januar 1945 erhielten wir in Hinterpommern die ersten nächtlichen Einquartierungen von Flüchtlingstrecks aus Ostpreußen, die am nächsten Morgen wieder weiter ziehen. Hitler glaubte offenbar immer noch an den Endsieg und schickte zu dieser Zeit noch deutsche Truppen, die zum Aufhalten der Russen in der eignen Heimat dringen nötig gewesen wären, nach Ungarn, um „die Bolschewiken von dort aus in die Zange zu nehmen“.
Der gummibereifte Pferdewagen wurde, als die Front immer näher rückte, mit einer Plane versehen und für die Flucht mit den wichtigsten Sachen, wie Bettzeug, Kleidung und Lebensmittelvorräten beladen. Porzellan, Bestecks und Wertsachen wurden in Kisten verstaut und im Garten hinter dem Haus vergraben. Wenn wir nach dem Kriege zurückkehren würden, wollten wir die Sachen wieder hervorholen. Aus Bettlaken nähte meine Mutter Rucksäcke. Um den 3./4. März 1945 sahen wir in der Nacht im Nordosten Feuersschein am Horizont und wundern uns darüber. Niemand ahnt, dass er schon die nahen brandschatzenden Russen ankündigt, die mit überwältigender Übermacht, nur auf geringen Widerstand stoßend, in wenigen Tagen große Gebiete überrennen. Die Flucht darf aber erst nach obrigkeitlicher Weisung angetreten werden. Im kalten frühen März 1945 kam die behördliche Anordnung: Evakuierte dürfen den Ort verlassen, Ortsansässige haben noch zu bleiben. Ich war 10 Jahre alt, meine Mutter 34, mein Vater als Soldat auf dem Rückzug im Westen. Wäsche wurde doppelt und dreifach auf den Körper gezogen, die gepackten, aus Bettlaken genähten Rucksäcke wurden geschultert. Meine Tante brachte uns mit dem Pferdewagen zum Bahnhof Kantreck (heute Łoznica). Dort den ganzen Tag und die darauffolgende Nacht vergebliches Warten auf einen Zug. Mehrere Flüchtlingszüge fuhren ohne uns weiter. Zwischendurch wurde ich noch einmal zu Fuß über die Kleinbahngleise zurückgeschickt, um irgendetwas Vergessenes zu holen. Meine Mutter erwartete derweil besorgt meine Rückkehr. In der Nacht der feuerrote Horizont im Nordosten. Die Russen meldeten sich schon per Telefon aus der nächsten nördlichen Bahnstation. Cammin wurde am 5. März. bedrängt, um den 5. März. setzten sich deutsche Militärdienststellen aus dem Nachbardorf Hammer (heute Babigoszcz) ab. Hagen vor Wollin wurde am 7.03.1945 von den Russen eingenommen. Es gelang uns, im letzten Eisenbahnzug am 5.03.1945 dank der beherzten Durchsetzungsfähigkeit einer Mitevakuierten und späteren Freundin der Familie aus Westfalen, die Türen einer offenen Kohlenlore von außen zu öffnen und uns gegen den heftigen Widerstand der bisherigen „Passagiere“ Einlass zu verschaffen. Die Flucht im unbedachten Güterwagen, den Russen noch gerade im letzten Augenblick entkommen, führte uns durch Gollnow südwärts, später durch das brennende Altdamm und durch Stettin immer weiter nach Westen. Für die Strecke bis Stettin, die man sonst mit dem Bummelzug in einer Stunde fuhr, benötigte unser Flüchtlingszug mit unserem dachlosen Güterwaggon bei winterlicher Kälte fast eine Woche. Immer wieder blieb er auf freier Strecke im stark umkämpften Gebiet südlich von Gollnow stundenlang stehen, bis die zerbombten Schienen wieder notdürftig repariert wurden. Mehrere Züge stauten sich hintereinander auf den Gleisen. Es war riskant, den Zug zu verlassen, etwa um ein menschliches Bedürfnis zu erledigen. Er konnte nach kurzem Pfeifen der Lokomotive jeden Moment wieder anfahren. Die russischen – „Nähmaschinen“ genannten – Jagdflugzeuge beharkten auf der parallel laufenden Landstraße die zurückflutenden deutschen Militärkolonnen mit Maschinengewehrfeuer, verschonten aber unseren Flüchtlingszug. Es fanden bereits unweit der Bahngleise Kämpfe statt: Gollnow (heute Goleniow) wurde am 7.03.1945 von den Russen bedroht, Lübzin (heute Lubczyna) am 8.03. Bei Hornskrug (heute Rzesnica) nördlich vor Altdamm (heute Dabie) stürmen die Sowjets am 11. März. gegen den bis zum 20.03.1945 von den Deutschen gehaltenen Brückenkopf Altdamm. Lange stand der Zug auch vor Altdamm, und meine Mutter überlegte ernstlich, dort auszusteigen, weil unsere unversehrte Wohnung sich ganz in der Nähe befand. Von Stettin aus ging es dann an einem Tag durch Vorpommern und Mecklenburg bis an unser Ziel, das uns aber noch unbekannt war. Nur ab und zu hält der Zug, um einige Kinderleichen oder an Erschöpfung gestorbene alte Leute auszuladen. Ein Mann in SA-Uniform reichte unterwegs den durstigen Flüchtlingen auf deren Bitte einen Eimer mit Trinkwasser aus einem Bahnwärterhäuschen in den Waggon.
In Grevesmühlen in Westmecklenburg, kurz vor Lübeck, hielt der Zug, und wir mussten alle aussteigen. Hitlerjungen mit Handwagen halfen auf dem Weg zum Notquartier. Eine Woche lang fanden wir zusammen mit vielen anderen Flüchtlingen eine erste Unterkunft in der Fremde im Gemeindesaal der evangelischen Kirche auf einem Strohlager. Am nächsten Tag konnte ich nicht mehr laufen. Meine im offenen Güterwagen angefrorenen Füße heilten aber langsam wieder. Einem Altersgenossen mussten die erfrorenen Zehen amputiert werden.
Der Gemeindesaal der Kirche in Grevesmühlen
Dann erhielten wir zusammen mit der mit uns geflohenen Evakuierten aus Westfalen und deren Tochter für zwei Frauen und drei Kinder ein kleines Zimmer mit Strohsäcken auf dem Fußboden bei einem Malermeister.
Die in Dischenhagen (heute Dzieszkowo) zurückgebliebenen Verwandten wurden, wie wir erst viel später von Großtante Emma erfuhren, von den Russen überrollt und erlebten deren Vandalismus grauenvoll am eigenen Leibe. Als erstes buddelten sie unsere vor wenigen Tagen im Garten vergrabenen Kisten zielstrebig aus. Auf ihrem Vormarsch durch Ost- und Westpreußen hatten sie darin schon hinreichend Erfahrung sammeln können. Die betrunkenen Russen holten die Flaschen mit eingeweckten Blaubeeren aus dem Keller und warfen sie gegen die Hauswand, weil sie keinen Wodka enthielten, zerrten die Federbetten heraus und schlitzen sie auf, stocherten mit Forken im Heu herum, worin sich die Frauen versteckt hatten und feierten Orgien der Vergewaltigung. Monate später wurden die verbliebenen Deutschen von den Polen von ihren Höfen vertrieben und unter dramatischen Umständen in die sowjetische Besatzungszone umgesiedelt. Wie es anderen Menschen aus dieser Gegend erging, habe ich in meinem Band 15 der gelben Reihe in Zeitzeugenberichten zusammengetragen. Dem sind wir noch gerade rechtzeitig entkommen! Von meiner Cousine erfuhr ich Jahrzehnte später, ihre Mutter habe nie über diese grauenvollen Erlebnisse gesprochen.
Der Krieg lag in seinen letzten Zuckungen. Ich warn enttäuscht, dass ich nach Erreichen des 10. Lebensjahres in Grevesmühlen nicht mehr Pimpf werden sollte, aber meine Mutter meinte, das sei nun nicht mehr angebracht. Mit unserem Führer und seiner Hitlerjugend gehe es trotz aller Endsiegparolen und Hoffnungen auf Wunderwaffen eindeutig dem Ende entgegen. Der Traum von der Weltherrschaft des Großdeutschen Reiches war ausgeträumt. Im April und Anfang Mai fluteten in dieser letzten, von deutschen Truppen „beherrschten“ Gegend aus Ost und West deutsche Militärkolonnen und endlose Flüchtlingstrecks zusammen. Die Flüchtlinge biwaketen in den ‚Kohlsteigen’ und Gartenwegen mit ihren Pferdewagen, die Soldaten in Wäldern und auf Feldern. Der „Heldentod des Führers“ am 30. April 1945 wurde im Großdeutschen Rundfunk bekannt gegeben. Es gab um Grevesmühlen, das den Krieg bislang ohne Bombardements heil überstanden hat keine Kämpfe. Ein Haus wurde in den letzten Kriegstagen durch eine Bombe zerstört, die einer benachbarten Eisenbahnbrücke gegolten hatte und ihr Ziel verfehlte. Anfang Mai wurden in der Stadt weiße Fahnen gehisst. Einige SS-Fanatiker holten die weiße Fahne wieder vom Wasserturm, und es gab eine wilde Schießerei zwischen ihnen und den hissenden Wehrmachtssoldaten.
Der trotz seines hohen Alters den Kirchsprengel immer noch betreuende Propst Münster, der mich später konfirmierte, berichtet in der von ihm sehr gründlich geführten Gemeindechronik über diese Tage:
„Die ersten Tage des Monats Mai waren äußerst spannungsreich und aufregend. Der Einmarsch alliierter Truppen war täglich zu erwarten. Es war aber zu befürchten, dass der wahnwitzige Befehl, unter allen Umständen äußersten Widerstand zu leisten, von fanatischen Hitlerleuten befolgt werden und namenloses Unheil über die Stadt heraufbeschwören könnte. Es traten hier und da SS-Männer mit derartigen Drohungen auf. Es hieß, Himmler hielte sich in Kalkhorst auf, um den verzweifelten Kampf zu leiten. Einige entschlossene Männer taten sich zusammen, um solche Versuche zu verhindern, und brachten es fertig, auf dem Kirchturm und auf dem Wasserturm die weiße Fahne zu hissen – am 2. Mai. Um diese Fahne, die den nahenden Truppen die Unterwerfung der wehrlosen Stadt kundtun sollte, entbrannte ein heißer Kampf zwischen SS-Soldaten und ihren Gegnern. Die Fahne wurde aufgesetzt, wieder heruntergeholt und wieder aufgezogen, auch der Verfasser dieses Berichts wurde am Nachmittag des 2. Mai zweimal von angetrunkenen SS-Männern wegen dieser Fahne mit dem Revolver bedroht. Das Ende war die Unschädlichmachung der SS-Kämpfer und der widerstandslose Einzug der amerikanischen Truppen.“
Man bedeutete mir, ich solle nun nicht mehr mit „Heil Hitler“ grüßen, das sei jetzt vorbei, was ich erst nicht verstehe, denn ich habe mit meinen zehn Lenzen gar nicht assoziiert, dass dieser Gruß etwas mit „unserem Führer“ zu tun hat. Für mich ist „heilitler“ gleichbedeutend mit „Guten Tag“. Warenlager wurden plötzlich zum Plündern durch die Bevölkerung freigegeben.