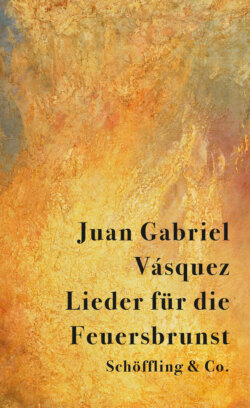Читать книгу Lieder für die Feuersbrunst - Juan Gabriel Vásquez - Страница 7
ОглавлениеDer Doppelgänger
Ernesto Wolf. In der Schule stand sein Name in der Jahrgangsliste unter meinem, auf den in Kolumbien nur selten einer folgt (höchstens ein ausländischer oder einer der ausgefalleneren: Yáñez oder Zapata, Yammara oder Zúñiga). Am Tag der Auslosung für den Militärdienst sorgte die alphabetische Reihenfolge dafür, dass ich vor ihm meine Kugel zog. Im weinroten Samtbeutel lagen nur noch zwei, eine blaue und eine rote, wo eben an die fünfzig gelegen hatten, die Zahl der Schüler, die in diesem Jahr zur Einberufung anstanden. Die rote Kugel würde mich zum Militärdienst schicken, die andere meinen Freund. Ein simples Verfahren.
Das Spektakel fand im Teatro Patria statt, einem Nebengebäude der Kavallerieschule, wo heute schlechte Filme gezeigt und gelegentlich eine Komödie, ein Konzert oder Zauberkunststücke aufgeführt werden. Wie ein Zauberkunststück, so wirkte unsere Auslosung. Das Publikum bildeten die Abiturienten und einige halbwegs solidarische Lehrer, auf der Bühne drei Schauspieler: ein Oberleutnant mit Gel im Haar, das wie Rauputz wirkte, (beim Dienstgrad bin ich mir nicht sicher, ich habe Schultern, Revers oder Brusttasche nicht mehr vor Augen und ohnehin niemals die Ränge unterscheiden können), eine uniformierte Assistentin und ein Freiwilliger, der widerstrebend zu ihnen hinaufgestiegen war, um an dem Zauberkunststück teilzunehmen und eine Kugel zu ziehen, die ihn vielleicht für ein Jahr aus dem Zivilleben verbannte. Die Assistentin, die nach Naphthalin roch, hielt den Beutel mit den Kugeln. Ich griff hinein, zog die blaue Kugel heraus, und bevor ich mir bewusst geworden war, dass ich meinen Freund verurteilt hatte, war der schon auf die Bühne gestürzt und umarmte mich unter dem empörten Blick des Offiziers und dem verschwörerischen der Assistentin: Ein blaues Lid zwinkerte mit üppig getuschten Wimpern.
Der Offizier, Oberleutnant oder was auch immer, unterschrieb mit Tintenschreiber ein knochenweißes Papier mit Wasserzeichen und Prägesiegel, kniffte es zweimal und reichte es mir, als übergäbe er einen stinkenden Lappen, die Plastikkappe des Stifts steckte ihm noch zwischen den Zähnen. Weiß und speichelnass leuchtete sie zwischen gelben Zahnreihen. Währenddessen sprach Ernesto mit der Frau. Er wollte die rote Kugel nicht ziehen, denn es war die letzte, somit ein überflüssiger Akt und keine Überraschung für das Publikum, diese Masse von Abiturienten, die sich alle dasselbe von diesem Unterhaltungsprogramm erhofft hatten: dass der Nachbar rekrutiert wurde. Aber die Frau oder vielleicht ihr Make-up überredeten ihn dazu, hineinzugreifen und die Kugel zu ziehen, und nicht nur dazu. Am nächsten Tag schrillte zur Mittagszeit bei mir das Telefon.
»Junge, hatte die einen Körper«, teilte mir Ernestos sumpfige Stimme mit. »Das hat man ihr in der Uniform gar nicht angesehen.«
Wir trafen uns noch ein paarmal, bis weitere Treffen nicht mehr in unserer Hand lagen. Mit bedenkenloser Leidenschaft und irritierendem Gehorsam trat Ernesto Ende August seinen Dienst in Tolemaida an, bei der Kompanie Ayacucho, Zehnte Brigade. Ayacucho: Diese Kakofonie sagte ihm nichts, war höchstens eine blasse Erinnerung aus der Grundschulzeit. Als Enkel eines eingebürgerten Ausländers, der sich dem Koreakrieg verweigert hatte und daraufhin von einer einflussreichen Zeitung als vaterlandsloser Geselle bezeichnet worden war, und als Sohn eines Vaters, der herangewachsen war, ohne recht zu wissen, wohin er gehörte – auch wenn sein Taufname dem Heiligenverzeichnis entstammte und daher unauffällig war –, wusste Ernesto wenig über Ayacucho im Besonderen oder die Unabhängigkeitskriege im Allgemeinen. Aus Freundschaft fühlte ich mich verpflichtet, seinem Patriotismus auf die Sprünge zu helfen. An einem Sonntag stand ich in aller Frühe auf, machte am Heldendenkmal ein Sofortbild und brachte es ihm nach Tolemaida, in eine Zeitungsseite gewickelt.
Ayacucho
Pichincha
Carabobo
Zwei Kakofonien und zum Abschluss eine verschleierte Beleidigung – Schafsgesicht – waren in den fast schon heiligen Stein der nationalen Unabhängigkeit gemeißelt. Das überreichte ich dem Rekruten Wolf. Es war August, wie gesagt, der Herbstwind blies bereits, und auf den Grünflächen um das Denkmal herum waren Leinen gespannt, an denen Drachen zum Verkauf hingen, geometrische Figuren aus Seidenpapier mit Bambusskelett, die keiner Bergböe standhalten würden. In Tolemaida, das im heißen Flachland lag, wehte kein Wind. In Tolemaida regte sich die Luft nicht, schien sich niemals zu regen. Der Gefreite Jaramillo ließ die Kadetten eine alte Boaschlange schultern, die Dauer entsprach der Schwere ihrer Vergehen; der Gefreite Jaramillo erzählte der Kompanie, als Drohung oder zur Abschreckung, von der einzigen urbanen Legende in dieser ländlichen Gegend, dem Kerker von Cuatro Bolas, wo ein Bauer, ein Ungetüm von Mann, sich mit den Aufmüpfigen gottlos vergnügte. Ein Jahr lang erzählte Ernesto Wolf vom Gefreiten Jaramillo mehr, als er je über einen anderen erzählt hatte. Der Gefreite Jaramillo war verantwortlich für die Reglosigkeit der Luft, für das Fieber, für die Blasen an den Händen, die man bei den Schießübungen vom Gewehrhalten bekam. Er war verantwortlich für die Tränen der jüngeren Rekruten (manche mit vorzeitigem Abitur waren erst fünfzehn), die sich hinter den Schuppen oder in den Waschräumen versteckten und nachts das Gesicht unter dem erstickenden Kopfkissen verbargen. Der Gefreite Jaramillo. Nie erfuhr ich seinen Vornamen, bekam ihn nie zu Gesicht, lernte ihn jedoch hassen. Sonntags, wenn ich Ernesto in der Escuela de Lanceros besuchte oder zu Hause bei den Wolfs in Bogotá, setzte er sich nieder – auf das dürre Gras, wenn der Besuch in Tolemaida stattfand, in Bogotá ans Kopfende des Tischs – und erzählte. Seine Eltern und ich aßen währenddessen, sahen einander an, und gemeinsam hassten wir den Gefreiten Jaramillo. Aber nein, ich irre mich vielleicht: Vater Antonio war nur bei Ernestos Heimurlauben anwesend, er hatte nie einen Fuß in die Escuela de Lanceros gesetzt, wie auch damals nicht in das Teatro Patria.
Als wir an einem dieser Sonntage zusammen im Auto saßen, die Fenster hochgekurbelt (der Staub, der Lärm an der Puente Aranda), und auf den Bus warteten, der Ernesto zum Heimurlaub aus Tolemaida bringen würde, sagte Antonio Wolf, der mich immer mehr ins Herz schloss, plötzlich zu mir: »Aber du hättest nicht gewollt.« Diesen seltsamen Satz sagte er, der unvollständig zu sein schien und es doch nicht war, und nahm dabei nicht die Hände vom Lenkrad, diese Hände eines alten Boxers, eines bayerischen Bauern, die den Neuankömmling nie würden abschütteln können, auch wenn nicht er der Einwanderer gewesen war, sondern sein Vater. Er sprach, ohne mich anzusehen, denn in einem Wagen sieht man sich gewöhnlich nicht an. Wie ein Feuer oder eine Kinoleinwand fesselt die Windschutzscheibe die Blicke, hält sie fest, bannt sie. Deshalb sagt sich in einem Wagen manches leichter.
»Was hätte ich nicht gewollt?«, fragte ich.
»Einfach so weggehen«, sagte er. »Weggehen und deine Zeit verlieren. Aber Ernesto wollte hin. Wozu? Um blödsinnige Schwüre zu lernen und das Schießen mit einem Gewehr, das er sein Lebtag nicht mehr benutzen wird.«
Ich war damals achtzehn. Ich verstand seine Worte nicht, verstand nur, dass Antonio Wolf, ein Mann, den ich respektieren gelernt hatte, ganz offen mit mir sprach und vielleicht auch mich respektierte. Ein Respekt, den ich mir nicht verdient hatte, denn verantwortlich war das Glück, keine Idee, keine Prinzipientreue gewesen, dass ich mich nicht an dem verfluchten Ort befand, wo man blödsinnige Schwüre lernte und das Schießen mit Gewehren, die man nie wieder benutzen würde, wo man jedoch vor allem seine Zeit verlor, die eigene wie die der Eltern, und wo das Leben sich verhedderte.
Und tatsächlich verhedderte sich Wolfs Leben. Siebzehn Tage vor Ende des Militärdiensts starb Ernesto bei irgendwelchen Manövern, deren Bezeichnung ich nicht kenne. Eine Seilrolle gab nach, Ernesto fiel dreißig Meter tief in eine Schlucht zwischen zwei Bergen, sein Körper schlug mit siebzig Stundenkilometern auf die Steine auf, und alle waren sich einig, dass er bereits tot gewesen sein musste, als er auf dem Talboden aufkam, bei einem kleinen Wasserfall, an dem sich die Liebespaare der Gegend treffen, um ihr erstes Mal zu erleben. Ich hätte zur Beerdigung gehen können, tat es aber nicht. Ich beschränkte mich auf einen Anruf, bei den Wolfs war besetzt, und ich versuchte es kein zweites Mal. Stattdessen schickte ich Blumen und einen Brief, in dem ich erklärte, ich sei in Barranquilla, was natürlich eine Lüge war, und ich weiß noch genau, wie unsinnig schwer es mir fiel, mich zwischen Barranquilla und Cali zu entscheiden, die Stadt zu wählen, die wahrscheinlicher klang oder weniger Skepsis erweckte. Ich erfuhr nicht, ob die Wolfs mir geglaubt oder die plumpe Lüge durchschaut hatten. Sie beantworteten den Brief nicht, und ich besuchte sie nach dem Unfall nie mehr. Ich begann Jura zu studieren, wusste jedoch schon nach der Hälfte des Studiums, dass ich niemals in dem Beruf arbeiten würde, denn ich hatte ein Buch mit Erzählungen geschrieben, und mir war klar geworden, dass ich nichts anderes in meinem Leben tun wollte. Ich ging nach Paris. In Paris lebte ich fast drei Jahre. Ich ging nach Belgien. In Belgien verbrachte ich, in der Nähe eines unaussprechbaren Orts in den Ardennen, neun Monate. Im Oktober 1999 zog ich nach Barcelona, im Dezember desselben Jahres lernte ich in den Weihnachtsferien, die ich bei meiner Familie in Kolumbien verbrachte, eine deutsche Frau kennen, die 1936 nach Kolumbien ausgewandert war. Ich stellte ihr Fragen über ihr Leben, über die Flucht ihrer Familie vor den Nationalsozialisten, über das Kolumbien zur Zeit ihrer Ankunft, und sie beantwortete alles mit einer Freimütigkeit, die mir seitdem nie wieder begegnet ist, ich notierte ihre Antworten auf einem kleinen karierten Notizblock, einer von denen mit einem Logo oder einer Textzeile oben am Rand (in dem Fall ein berühmtes italienisches Zitat: Guardati dall’uomo di un solo libro). Jahre später benutzte ich die Aufzeichnungen, die Antworten – das heißt: dieses Leben – für einen Roman.
Der Roman erschien im Juli 2004. Er handelte von einem deutschen Immigranten, der gegen Ende des Zweiten Weltkriegs im Sabaneta interniert worden war, einem Luxushotel, das die kolumbianische Regierung vorübergehend in ein Internierungslager für feindlich gesinnte Staatsbürger umgewandelt hatte (Feinde Roosevelts, Sympathisanten Hitlers oder Mussolinis). Die Recherchen für den Roman hatten sich als schwierig erwiesen, denn das Thema ist für viele Familien von Bogotás deutscher Gemeinde noch immer heikel, ja tabu. Deshalb erschien es mir umso ironischer, dass nach Veröffentlichung viele Leute auf mich zukamen und mich baten, ich solle doch nun ihnen zuhören, ihre Geschichte erzählen. Noch Monate später erhielt ich Mails von Deutschen oder ihren Kindern, die das Buch gelesen hatten und ein, zwei Angaben korrigierten – die Farbe einer Hauswand oder das Vorkommen einer Pflanze an einem bestimmten Ort –, und sie tadelten mich, weil ich mich nicht besser informiert hatte, und boten mir dann ihre eigenen Geschichten für mein nächstes Buch an. Ich antwortete höflich ausweichend (aus einem Aberglauben heraus, den ich nicht erklären kann, habe ich noch nie ein Angebot kategorisch abgelehnt). Und Wochen später bekam ich eine ähnliche Mail oder die Mail von dem Bekannten eines Bekannten, der im Hotel Sabaneta interniert gewesen sei und mir notfalls Auskunft erteilen könne. Deshalb überraschte es mich nicht, als ich im Februar 2006 einen Umschlag erhielt, auf dessen Rückseite ein deutscher Name stand. Ich gestehe, dass ich einige Sekunden brauchte, bis ich ihn identifizierte, dass ich erst auf der zweiten, dritten Stufe zu meinem Hauseingang ein Gesicht zu dem Namen vor mir sah. Ich öffnete den Brief auf der Treppe, fing im Aufzug mit dem Lesen an und beendete ihn stehend in der Küche meiner Wohnung, die Reisetasche noch über der Schulter, die Eingangstür sperrangelweit geöffnet, der Schlüssel noch im Schloss.
Stell dir vor, wie komisch (stand in dem Brief), im Spanischen gibt es kein Wort für das, was ich bin. Wenn deine Frau stirbt, bist du ein Witwer, wenn dein Vater stirbt, bist du eine Waise, aber was bist du, wenn dein Sohn stirbt? Der Tod eines Sohnes ist so grotesk, dass die Sprache kein Wort dafür gefunden hat, obwohl Tag für Tag Kinder vor ihren Eltern sterben und Eltern Tag für Tag unter dem Tod ihrer Kinder leiden. Ich habe deinen Weg verfolgt (stand in dem Brief), wollte mich aber bis jetzt nicht melden. Wollte dir weder begegnen noch schreiben. Weißt du, warum? Weil ich dich gehasst habe. Jetzt hasse ich dich nicht mehr, das heißt, nur an manchen Tagen, dann verlasse ich morgens voll Hass auf dich das Bett und wünsche deinen Tod, oder ich stehe auf und wünsche mir, dass deine Kinder sterben, falls du Kinder haben solltest. Aber nur an manchen. Verzeih, wenn ich dir das brieflich sage, so etwas sollte man einem ins Gesicht sagen, direkt und persönlich, aber das ist in diesem Fall nicht möglich, weil du drüben lebst, in Barcelona, und ich hier, in einem Häuschen in Chía, das ich mir nach der Scheidung gekauft habe. Du weißt bestimmt von der Scheidung, ganz Bogotá hat in dem Jahr davon gesprochen, all die hässlichen Einzelheiten kamen ans Licht. Nun gut, darauf will ich nicht näher eingehen, will dir jetzt nur gestehen, dass ich dich gehasst habe. Ich habe dich gehasst, weil du nicht Ernesto warst, denn es fehlte so wenig, und du wärst Ernesto gewesen, warst es aber nicht. Ihr habt dieselbe Schule besucht, wusstet dieselben Dinge, wart in derselben Fußballmannschaft, habt in derselben Reihe im Teatro Patria gesessen, aber du hast zuerst die Kugel aus dem Beutel gezogen, die für Ernesto bestimmt gewesen war. Du hast ihn nach Tolemaida geschickt, und das will mir einfach nicht aus dem Kopf. Würdest du Yammara oder Zúñiga heißen, mein Sohn wäre noch lebendig, und ich hätte mein Leben noch im Griff. Aber mein Sohn ist tot, er hat diesen Scheißnachnamen, dieser Scheißname ist schuld an seinem Tod, der Name, der auf seinem Grabstein steht. Vielleicht kann ich es mir selbst nicht verzeihen, dass ich ihm diesen Namen gegeben habe.
Aber weshalb solltest du all das verstehen (stand in dem Brief)? Da du nicht mal den Schneid gehabt hast, auf dem Friedhof zu erscheinen, um dich von deinem langjährigen Freund zu verabschieden. Da du drüben lebst, fern von diesem Land, wo man seinen Militärdienst leistet und womöglich mit dem Leben dafür bezahlt. Du lebst bequem, was soll dich das kümmern? Da du dich seit dem Tod deines Freundes versteckst, weil du Schiss hast, den Dingen ins Auge zu sehen und dir bewusst zu machen, dass eine Familie zerstört wurde, eine Familie, die deine hätte sein können und es bloß aus glücklichem Zufall nicht war. Wovor hast du Angst? Dass es eines Tages dich trifft? Das wird es (stand in dem Brief), glaub mir, eines Tages kommt der Moment, an dem du merkst, dass man manchmal die anderen braucht, und wenn sie nicht im richtigen Augenblick für dich da sind, kann dein Leben in die Brüche gehen. Ich weiß nicht, was mit meinem geschehen wäre, wenn ich dich am Tag der Beerdigung hätte umarmen und dir für dein Kommen danken können, oder wenn du einmal die Woche zum Mittagessen gekommen wärst wie damals, als Ernesto beim Militär war und Ausgang hatte. Wir haben über den Gefreiten Jaramillo gesprochen, Ernesto hat uns von dem Kerker erzählt und von der Boa, die man den Rekruten um die Schultern gelegt hat. Manchmal glaube ich, all das hätte ich besser verkraftet, wenn ich es mir gemeinsam mit dir am Tisch hätte in Erinnerung rufen können. Ernesto hat dich geliebt, Freunde fürs Leben wärt ihr gewesen. Und du hättest uns eine Stütze sein können, wir haben dich geliebt (stand in dem Brief), hatten dich ebenso ins Herz geschlossen, wie Ernesto es getan hat. Aber nach all dem (stand in dem Brief) kräht kein Hahn mehr: Du bist nicht da gewesen. Wir haben dich gebraucht, und du warst nicht da, hast dich versteckt, uns deine Unterstützung verweigert, und dann lief es immer schlechter, bis alles zusammenbrach. Das war an Weihnachten, zehn Jahre ist das her, wie die Zeit vergeht. Ich erinnere mich nicht mehr genau daran, aber die Leute haben mir nachher gesagt, ich hätte sie um den Tisch gejagt, Pilar hätte sich ins Bad flüchten müssen. Dagegen erinnere ich mich noch gut daran, dass ich die Feier verlassen, den Wagen genommen habe und einfach drauflosgefahren bin, und erst beim Parken habe ich gemerkt, dass ich an der Puente Aranda war, auf demselben Parkplatz, wo immer die Busse von Tolemaida angekommen sind, auf demselben Platz, wo wir beide manchmal auf Ernesto gewartet haben und einmal eine Unterhaltung hatten, die ich nie vergessen werde.
All das stand in dem Brief. Ich weiß noch, dass ich als Erstes dachte: Er ist krank. Er stirbt. Und gleich darauf kam ein Gefühl der Bestürzung, nicht der Traurigkeit, der Nostalgie oder Empörung (auch wenn eine gewisse Empörung über Antonio Wolfs Anschuldigungen sicher legitim gewesen wäre). Ich beantwortete den Brief nicht, überprüfte die Rückseite des Umschlags, sah, dass der Absender – dieses Häuschen in Chía – vollständig war, und verwahrte Umschlag und Brief im Bücherregal meines Arbeitszimmers zwischen zwei Fotoalben mit Bildern meiner Töchter, dieser Töchter, denen Antonio Wolf den Tod gewünscht hatte. Vielleicht wählte ich diesen Platz, um den Brief zu bannen, zweifellos mit Erfolg, denn oft schlug ich im folgenden Jahr die Alben auf und sah mir die Fotos meiner Töchter an, doch den Brief las ich kein zweites Mal. Vielleicht hätte ich ihn nie wieder gelesen, hätte ich im Januar 2007 nicht von Antonio Wolfs Tod erfahren. An einem bitterkalten Montag war ich aufgestanden, hatte mein Mailprogramm geöffnet, und da war die Sammelnachricht, verschickt von der Vereinigung ehemaliger Absolventen meiner Schule. Man meldete das Hinscheiden – ein Wort, das ich schon immer gehasst habe –, Datum und Uhrzeit der Begräbnisfeierlichkeiten – das Gleiche gilt für dieses Wort – und erinnerte daran, dass der Verblichene – noch so ein Wort – Vater eines früheren Schülers gewesen war, erwähnte jedoch nicht den Tod des Sohnes, so viele Jahre vor dem seinen. Als ich drei Monate später wieder nach Bogotá reisen musste, steckte ich den Brief in meine Unterlagen. Denn ich kenne mich, kenne meine Eigenarten und Obsessionen und wusste, dass ich es später bereuen würde, das Häuschen nicht gesehen zu haben – und sei es nur von Weitem –, wo Antonio Wolf seine letzten Jahre verlebt hatte, die Jahre seines Niedergangs und seines Todes, und wo der feindseligste und zugleich intimste Brief entstanden war, den ich jemals erhalten hatte. Nach meiner Ankunft ließ ich zwei Tage verstreichen, doch am dritten nahm ich den Umschlag und legte mit einem Leihwagen die circa dreißig Kilometer zurück, die zwischen Bogotá und Chía liegen.
Das Haus zu finden, war nicht schwierig. Chía ist ein winziger Ort, in einer knappen Viertelstunde hat man ihn durchquert. Die Nummerierung der Straßen führte mich zu einer geschlossenen Wohnanlage: zehn Häuser aus billigen Ziegeln, die einander in zwei Fünferreihen gegenüberstanden und von einer Fläche aus den gleichen Ziegeln getrennt waren, in diesem Lachsrot, das immer wie neu wirkt. Auf dem Platz lagen ein Fußball (einer von den neuen: silbern-gelb gemustert) und eine Plastikthermosflasche. Vor einigen Häusern standen Motorräder, weiter hinten beugte sich ein Mann in Sandalen mit bloßem Oberkörper über den laufenden Motor eines Renault 4. So stand ich auf dem Gehweg gegenüber dem Pförtnerhäuschen mit den getönten Scheiben, verengte die Augen, um die Nummern zu entziffern und das Haus von Antonio Wolf zu identifizieren, als der Pförtner herauskam und mich fragte, wohin ich wolle. Ich hätte nicht überraschter sein können, als er ins Häuschen zurückging, über die Sprechanlage anrief, wieder herauskam und sagte: »Folgen Sie mir.« Und ich folgte ihm. Zehn, zwanzig, dreißig Schritte. Leute sehen hinter Spitzenvorhängen hervor, um den Besucher zu begutachten; eine Tür geht auf, eine Frau kommt heraus. Sie ist um die vierzig, trägt eine Schürze mit Weihnachtsmotiven, obwohl schon vier Monate seit Weihnachten vergangen sind, und trocknet sich die Hände. Unter dem Arm hat sie eine gerippte Plastikmappe, eine von denen mit Klettverschluss.
»Das hat Don Antonio für Sie dagelassen«, die Frau reichte mir die Mappe. »Er hat gesagt, Sie würden kommen. Er hat auch gesagt, ich soll Sie nicht hereinlassen, nicht einmal auf ein Glas Wasser.«
In ihrer Stimme lag Groll, aber auch Fügsamkeit: die Fügsamkeit von jemandem, der einen Auftrag erfüllt, den er nicht versteht. Ich nahm die Mappe, ohne sie mir anzusehen, und wollte mich verabschieden, aber die Frau hatte mir bereits den Rücken gekehrt und ging zur Haustür.
Als ich wieder im Wagen saß, legte ich die Mappe auf den Brief: zwei Schriftstücke, durch die Antonio Wolf in meinem Leben präsent blieb, sechzehn Jahre, nachdem wir uns das letzte Mal begegnet waren. Ich fuhr los (aus seltsamer Scham), damit ich nicht vor der Wohnanlage, vor dem Pförtnerhäuschen stehen blieb, hatte mir aber schon überlegt, zum Centro Chía zu fahren, dessen riesiger Parkplatz gebührenfrei ist und von niemandem kontrolliert wird. Das tat ich auch, gelangte zu dem Einkaufszentrum, parkte vor dem Kaufhaus Los Tres Elefantes und machte mich daran, den Inhalt der Mappe durchzugehen. Nichts von dem, was ich darin fand, überraschte mich. Bereits vor dem Öffnen wusste ich im Grunde, was ich finden würde, wie manches Wissen schon im Hinterkopf existiert, noch bevor das einsetzt, was wir Intuition oder Vorahnung nennen.
Das älteste Dokument war eine Seite aus dem Jahrbuch des Gymnasiums. Darauf hielten wir beide, Ernesto und ich, im Trikot der Fußballmannschaft den Pokal eines Bogotaer Turniers hoch. Dann kam ein Exemplar der Zeitschrift Cromos vom April 1997, aufgeschlagen auf der Seite, die in fünf kurzen Zeilen von der Veröffentlichung meines ersten Romans berichtete. Unwillkürlich schob ich den Beifahrersitz nach hinten, um mehr Platz zu haben, und verteilte alle Dokumente über das Wageninnere, benutzte jede verfügbare Fläche – das Armaturenbrett, die geöffnete Klappe des Handschuhfachs, den Rücksitz, die Mittelarmlehne –, um mein Leben chronologisch anzuordnen, ausgehend von Ernestos Tod. Da waren all die Artikel über meine Bücher, alle Rezensionen, alle Interviews, die in der kolumbianischen Presse erschienen waren. Manche Dokumente waren keine Originale, sondern verblichene Fotokopien, als hätte Antonio über andere davon erfahren und die Zeitschrift in einem Archiv kopieren müssen. Manche Zeilen waren unterstrichen, nicht mit Bleistift, sondern mit billigem Kugelschreiber, Passagen, in denen ich zu großspurigen oder schlicht dummen Erklärungen ausholte, Gemeinplätze abspulte oder hohle Antworten auf hohle Journalistenfragen gab. In den Rezensionen zu meinem Roman über die Deutschen in Kolumbien waren mehr Passagen unterstrichen, und in jedem Kommentar über das Exil, das Leben anderswo, die Schwierigkeiten der Anpassung, über das Gedächtnis und die Vergangenheit und über die Art, in der wir unsere Fehler von unseren Vorfahren erben, verrieten Antonios Unterstreichungen einen Stolz auf mich, der mir unbehaglich war und bei dem ich mich schäbig fühlte, als stünde er mir nicht zu.
Nie erfuhr ich, wer die Frau gewesen war, die mir die Mappe überreicht hatte. Damals kamen mir natürlich mehrere Möglichkeiten in den Sinn, und auf der Rückfahrt nach Bogotá spielte ich mit meinen Ideen, stellte mir Antonio Wolfs unbekanntes Leben vor, während ich gedankenverloren auf der Autobahn dahinfuhr. Womöglich war es eine Frau aus dem Ort, vielleicht eine Bäuerin, und Wolf hatte sie als Haushaltshilfe eingestellt und nach und nach gemerkt, dass er niemand anderen mehr auf der Welt hatte. Auch die Frau war womöglich alleinstehend oder hatte eine Tochter, eine junge Tochter, die Wolf bei sich aufgenommen hatte. Ich stellte mir vor, wie sich die Beziehung zwischen zwei einsamen, verstörten Menschen veränderte, stellte mir schuldvolle Sexszenen vor, die bei Angehörigen und Freunden für Empörung sorgten, stellte mir Wolf vor, der beschloss, dass die Frau nach seinem Tod in dem Haus bleiben sollte. Aber vor allem stellte ich mir vor, wie er hingebungsvoll das Leben eines anderen sammelte und das Gefühl hatte, kraft der fremden Dokumente die Leere auszufüllen, die die Abwesenheit des Sohnes in seinem Leben hinterlassen hatte. Ich stellte ihn mir vor, wie er der Frau von dem jungen Mann erzählte, der Bücher schrieb und in der Fremde lebte. Ich stellte mir vor, wie er nachts davon träumte, dass dieser junge Mann sein Sohn und am Leben war, in der Fremde wohnte und sich dem Schreiben von Büchern widmete. Ich stellte mir vor, wie er in Gedanken mit der Möglichkeit spielte, zu lügen und der Frau zu sagen, der junge Mann sei in Wirklichkeit sein Sohn, und für den kurzen Augenblick der Lüge, stellte ich mir vor, empfand er eine Illusion von Glück.