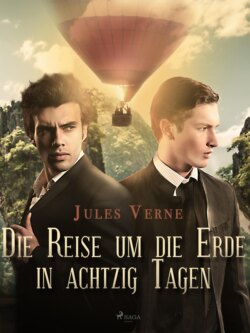Читать книгу Die Reise um die Erde in achtzig Tagen - Jules Verne, Jules Verne - Страница 13
Zehntes Kapitel,
Оглавлениеworin Passepartout sich mehr als glücklich schätzt, mit dem Verlust von Schuhen und Strümpfen aus einer Patsche zu kommen
Es ist wohl jedermann bekannt, daß Indien — dies große umgekehrte Dreieck, dessen Grundlinie im Norden und dessen Spitze im Süden liegt — eine Oberfläche von 1,400.000 Quadratmeilen umfaßt, über die in ungleichmäßiger Verteilung eine Bevölkerung von 180 Millionen Menschen verbreitet ist. Die großbritannische Regierung übt über einen gewissen Teil dieses unermeßlichen Landes eine Vorherrschaft aus. Sie unterhält in Kalkutta einen Generalgouverneur und in Agra einen Gouverneur-Stellvertreter.
Aber das eigentliche Britisch-Indien gebietet nur über eine Oberfläche von 700 Tausend Quadratmeilen und über eine Bevölkerung von 100 bis 110 Millionen Einwohnern. Ein beträchtlicher Teil des Gesamtgebietes entzieht sich noch heute der Herrschaft der Königin, und bei gewissen wilden und blutdürstigen Rajahs im Innern besteht die Hindu-Unabhängigkeit noch im unbeschränkten Maße.
Seit 1756 — dem Jahre, in welchem die erste englische Niederlassung auf dem heute von der Stadt Madras bedeckten Landgebiet gegründet wurde — bis zu jenem Jahre, in dem der große Aufstand der Sipois losbrach, war die berühmte Ostindische Handelsgesellschaft allmächtig. Sie annektierte allmählich die verschiedenen Provinzen, indem sie sie den Rajahs gegen Zusicherung einer Jahresrente abkaufte, die sie nur zum geringen Teil oder gar nicht bezahlte. Sie ernannte ihren Generalgouverneur und alle demselben unterstehenden Zivil- und Militärbehörden. Jetzt aber besteht sie nicht mehr, und die großbritannischen Besitzungen in Indien sind direkt abhängig von der Krone Englands.
Von Tag zu Tag gewinnen auch Sitten und Gebräuche sowie das ganze Aussehen und die ethnographischen Scheidungen der Halbinsel einen der europäischen Kultur entsprechenden Charakter. Ehedem reiste man mit allerhand altertümlichen Transportmitteln, zu Fuß, zu Pferde, im Karren, im Wagen, in der Sänfte, auf Menschenrücken. Heute befahren Dampfboote mit großer Fahrgeschwindigkeit den Indus und Ganges, und eine Eisenbahn, die mit zahlreichen Abzweigungen auf ihrer Strecke ganz Indien in seiner vollen Breite durchschneidet, führt den Reisenden in drei Tagen von Bombay nach Kalkutta.
Die Linie dieser Eisenbahn folgt nicht der geraden Linie durch Indien. Die Entfernung im Vogelflug beträgt bloß 1000 bis 1100 Meilen, und ein Bahnzug mit einer bloß mittleren Geschwindigkeit würde kaum drei Tage für die Strecke brauchen, aber die Entfernung wird um wenigstens ein Drittel vergrößert durch die Kurve, welche die Bahn im Norden der Halbinsel bis Allahabad beschreibt.
Um halb 5 Uhr nachmittags waren die Passagiere der „Mongolia“ in Bombay ans Land gegangen, und der Zug nach Kalkutta ging genau um 8 Uhr ab.
Herr Fogg verabschiedete sich deshalb von seinen Spielkameraden, verließ das Dampfschiff, gab seinem Lakaien Auftrag zu einigen Einkäufen, empfahl ihm ausdrücklich, vor 8 Uhr sich auf dem Bahnhof einzufinden, und begab sich mit seinem taktmäßigen Schritt, der gleich dem Pendel einer astronomischen Uhr die Sekunde anschlug, nach der Paßkanzlei.
Es fiel ihm nicht ein, sich die Wunderwerke von Bombay anzusehen: weder das Rathaus, noch die prachtvolle Bibliothek, noch die Forts, noch die Docks, noch den Baumwollmarkt, noch die Basare, noch die Moscheen, noch die Synagogen, noch die armenischen Kirchen, noch die prachtvolle, mit zwei viereckigen Türmen geschmückte Pagode auf dem Malabar-Hügel. Auch von allem andern mochte er nichts hören und sehen, weder von den Kolossalbauten von Elephanta, noch von seinen im südöstlichen Teile der Reede versteckt liegenden Hypogäen, noch von den Grotten Kanherie auf der Insel Salcette, jenen bewunderungswürdigen Überresten der buddhistischen Baukunst.
Phileas Fogg begab sich von der Paßkanzlei nach dem Bahnhof und ließ sich dort sein Essen vorsetzen. Unter andern Gerichten glaubte ihm der Hotelbesitzer ein Ragout von ostindischen Hasen empfehlen zu sollen, von dessen Wohlgeschmack er Wunderdinge zu erzählen wußte.
Phileas Fogg bestellte eine Portion von dem Ragout und kostete es gewissenhaft. Trotz der stark gewürzten Sauce fand er den Geschmack aber ganz abscheulich. Er klingelte dem Hotelwirt.
„Das soll also Hase sein, Herr Wirt?“ fragte er und maß ihn dabei mit scharfen Blicken.
„Jawohl, Mylord“, versetzte der Patron frech, „von Dschungelhasen!“
„Und miaut hat der Hase wirklich nicht, als er geschlachtet wurde?“
„Miaut? Aber Mylord, ein Hase! Ich gebe Ihnen die heilige Versicherung . . .“
„Herr Wirt“, versetzte Herr Fogg kühl, „sparen Sie sich Ihre heilige Versicherung und lassen Sie sich folgendes gesagt sein: ehemals wurden die Katzen in Indien als heilige Tiere angesehen — das war die gute alte Zeit —“
„Für die Katzen, Mylord?“
„Vielleicht auch für die Reisenden!“ Nach dieser Bemerkung widmete sich Herr Fogg wieder seinem Diner.
Wenige Augenblicke nach Herrn Fogg hatte auch Fix die „Mongolia“ verlassen und war aufs Polizeibüro von Bombay gelaufen. Er gab sich als Geheimpolizist zu erkennen, dem die Aufgabe zugefallen sei, den berüchtigten Urheber des letzten Riesen-Bankdiebstahls dingfest zu machen. Er schilderte die Lage, in der er sich dem mutmaßlichen Diebe gegenüber befand. War in Bombay schon ein Haftbefehl von London eingelaufen? . . . Es war noch nichts da! . . . Und da der Haftbefehl doch erst nach Fogg abgegangen war, so konnte er auch tatsächlich noch nicht zur Stelle sein!
Fix blieb in völliger Ratlosigkeit stehen. Er wollte vom Polizeidirektor einen Haftbefehl gegen Herrn Fogg haben. Der Polizeidirektor weigerte sich, diesem Ansinnen zu entsprechen. Die Sache ginge nur die Londoner Polizei an, und bloß diese könne einen gesetzlich gültigen Haftbefehl erlassen. Diese Prinzipienreiterei, diese strenge Observanz der Gesetzlichkeit erklärt sich sattsam aus den englischen Sitten, die hinsichtlich der persönlichen Freiheit keinen Einspruch leiden.
Fix beharrte nicht auf seinem Ansinnen und sah ein, daß er sich darein schicken mußte, auf das Eintreffen des Haftbefehls zu warten. Aber er nahm sich fest vor, seinen undurchdringlichen Gauner nicht aus den Augen zu lassen während der ganzen Zeit, die derselbe in Bombay verweilen würde. Daß Phileas Fogg in Bombay Aufenthalt nehmen werde, daran zweifelte er nicht — und wie der Leser weiß, war dies auch Passepartouts Überzeugung — mithin blieb ja noch Zeit, um den Haftbefehl rechtzeitig zu bekommen.
Aber Passepartout hatte seit den letzten Befehlen, die ihm sein Herr beim Verlassen der „Mongolia“ gegeben hatte, sattsam begreifen gelernt, daß es ihm in Bombay genau so ergehen würde wie in Suez und wie in Paris, daß die Reise ihr Ende noch nicht hier finden werde, daß sie zum wenigsten noch bis Kalkutta gehen werde, wenn nicht am Ende noch weiter. Er fing alsbald an, sich mit der Frage zu befassen, ob es mit dieser Wette des Herrn Fogg nicht doch ein grimmiger Ernst sei und ob ihn das Schicksal nicht doch am Ende dazu ausersehen hätte — ihn, der sich so mit allen Fasern nach einem ruhigen Leben sehnte, die Reise um die Erde in achtzig Tagen zurückzulegen!
Mittlerweile hatte er aber seine Einkäufe — einige Paar Hemden und Strümpfe — besorgt und flanierte in den Straßen von Bombay. Es herrschte eine wahre Völkerwanderung; mitten unter Europäern aller Nationen Perser mit spitzen Mützen, Bunhyas mit runden Turbanen, Sindhs mit viereckigen Mützen, Armenier in langen Gewändern, Parsen mit schwarzer Mitra. Es wurde gerade ein religiöses Fest dieser Parsen oder Ghebern gefeiert — diesen direkten Nachkommen der Anhänger Zoroasters, die die fleißigsten, kultiviertesten, gescheitesten und sittenstrengsten von allen Hindus sind und zu denen gegenwärtig auch die reichen eingeborenen Kaufleute Bombays gehören. Das Fest, das sie feierten, war eine Art religiösen Karnevals mit Bittgängen und weltlichen Zerstreuungen, bei welch letzteren Bajaderen, in rosa Gazegewänder gekleidet, die mit Gold- und Silberstikkereien überladen waren, nach einer aus Pfeifen und Trommeln bestehenden Musik wunderliebliche Tänze aufführten.
Wenn Passepartout sich diese wunderlichen Zeremonien ansah, wenn sich Augen und Ohren, um zu sehen und zu hören, bei ihm weit öffneten, wenn sein Wesen und sein Gesichtsausdruck durchaus dem eines Grünhorns entsprachen, wie man es sich neubackner nicht vorstellen kann, so braucht das hier nicht besonders festgestellt zu werden.
Zum Unglück aber für ihn und für seinen Herrn, dessen ganze Reise er auf diese Weise in Gefahr zu setzen, drohte, riß ihn seine Neugierde weiter als gut war.
Nachdem er sich diesen parsischen Karneval angesehen hatte, machte er sich auf den Weg nach dem Bahnhofe, bekam aber, als ihn sein Weg an der wunderbaren Pagode auf dem Malabar-Hügel vorbeiführte, den unglücklichen Einfall, sich das Innere derselben anzusehen.
Es war ihm zweierlei nicht bekannt: 1. daß Christen das Betreten gewisser indischer Pagoden ausdrücklich untersagt ist, und 2. daß selbst die Gläubigen in keine Pagode den Fuß setzen dürfen, ohne ihr Schuhzeug draußen vorm Tore zu lassen. Es muß hier bemerkt werden, daß die englische Regierung aus verständiger Politik die Landesreligion bis auf den kleinsten Punkt respektiert und strenge Strafen für jede Verletzung religiöser Bräuche festgesetzt hat.
Passepartout war also, ohne sich etwas Böses zu denken, als einfacher Tourist in das Innere des Malabar-Hügels eingetreten und stand in bewunderndem Sinnen vor all der blendenden Flitterpracht brahmanischen Kirchenschmuckes, als er sich plötzlich auf die geheiligten Fliesen hinstürzen fühlte.
Drei Priester fielen voll Wut über ihn her, rissen ihm Schuhe und Strümpfe von den Beinen und fingen an, ihn unter wildem Geschrei weidlich durchzudreschen.
Der Franzose, kräftig und behend wie er war, sprang flugs in die Höhe. Mit einem Faustschlag und einem Fußtritt steckte er zwei seiner Widersacher, die durch ihre langen Gewänder stark behindert waren, zu Boden, rannte so schnell ihn seine Beine trugen, barfuß zu der Pagode wieder hinaus und hatte im Nu den dritten Hindu überholt, der vor ihm her rannte in der Absicht, das Volk draußen ihm auf den Leib zu hetzen.
Fünf Minuten vor acht, wenige Sekunden nur vor Abgang des Zuges, kam Passepartout ohne Hut und barfuß und ohne seine Einkäufe, die er bei dem Handgemenge im Stich gelassen hatte, auf dem Bahnhofe an.
Fix war da. Er stand auf dem Bahnsteige. Er war Herrn Fogg bis hierher gefolgt, und als er nun eingesehen hatte, daß der Gauner Bombay doch zu verlassen gedächte, war sein Entschluß, ihn bis Kalkutta und, wenn es sein müßte noch weiter zu begleiten, im Nu gefaßt. Passepartout sah Fix nicht, denn Fix stand im Schatten; aber Fix hörte den Bericht des Abenteurers, den Passepartout mit kurzen Worten erstattete.
„Hoffentlich passiert dergleichen nicht zum zweitenmal“, begnügte sich Phileas Fogg zu bemerken, und nahm in einem Waggon des Zuges Platz.
Der arme Kerl folgte seinem Herrn barfuß und fassungslos, ohne ein Wort zu sagen.
Fix wollte eben in einen anderen Waggon steigen, als ihn ein plötzlicher Einfall zurückhielt. Im Nu ließ er seinen Plan, mit abzureisen, fallen.
„Nein! Ich bleibe“, sprach er bei sich — „ein Verbrechen, begangen auf indischem Grund und Boden — ich habe meinen Mann jetzt fest!“
In diesem Augenblick ließ die Lokomotive einen kräftigen Pfiff erschallen, und der Zug verschwand in dem nächtlichen Dunkel.