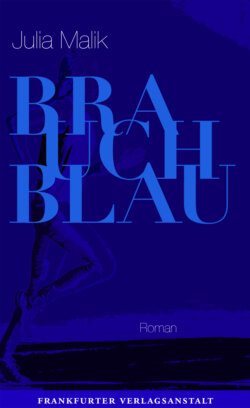Читать книгу Brauch Blau - Julia Malik - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеBRAUCH BLAU
Sie könnte nicht sagen, wo das wäre, sie weiß nicht den Straßennamen, aber die Richtung stimmt. Sie eilt die Touristenmeile entlang, schiebt sich an den äußeren Rand zur Straße, um vorwärtszukommen, ein Bus drückt sie in die Menschenmenge zurück, Taschen und Telefone hacken ihr in die Rippen, Sonnenbrillen bedrohen ihr Gesicht, Geschwätz, die Busabgase, gleich kippt sie um, denkt sie, boxt sich aus dem trägen Gewühl und drängt dicht an den Hauswänden voran.
Es muss hier gewesen sein. Sie steht vor einem schrabbeligen Altbau mit verheulter Fassade. Das frühere einheitliche Zitronengelb ist abgerutscht, jetzt hängen schwarze Augenringe unter den Fenstern. Der Verkehr hat seine Farbe hinterlassen, der Regen sie verwischt. Ein Schild trägt den Hotelnamen. Schräg gegenüber ist ihre Wohnung. Die Wohnung, wo Herbert und sie vor dreizehn Jahren eingezogen waren. Seit zwölf Monaten wohnt sie dort allein mit den Kindern.
Als sie die Wohnung damals gefunden hatte, freute er sich wie ein Rohrspatz. Herbert schüttelte sich manchmal beim Lachen. Immer wenn es überschwappte, wenn seine Freude größer war, als er es aushielt, entstand dieses Schütteln, das sie mit etwas erfüllte, das sie als Freude empfand. Sie wollte, dass er immer glücklich wäre, wollte bei Wartezeiten am Flughafen seinen schlummernden Kopf in ihrem Schoß bewachen, ihn zum Aufwachen küssen, ihm ständig erzählen, was sie dachte, mit ihm teilen, wie es ihr ging, wollte nur an seiner Schulter ins T-Shirt heulen, wenn es überhaupt sein musste. Mit ihm essen gehen, über sich lachen müssen, weil sie immer dasselbe bestellen und jede Eigenart mögen. Bei der Geburt des ersten Kindes mit ihm Lachkrämpfe kriegen. Ihn anschauen. Sie hat gedacht, genau das sei Liebe. Dass man sich immer freute, mit dem anderen zusammen zu sein. Sie hatte geglaubt, dass Liebe niemals enden könne, dass das physikalisch nicht möglich sei.
Jetzt ist sie aufgeregt, ihr linkes Augenlid zuckt, das Haus schwankt. Sie muss es festhalten! Warum ist sie hier? Sie kann sich nicht erinnern. Lücke. Ein gelbes Haus? Gegenüber von ihrem? Hat Larry, ihr bester Freund, der schöne Larry, sich etwas bestellt, das sie für ihn abholen sollte? Warum denn hier? Sie hat kein Geld. Nicht mal ein Telefon. Sie hat nichts dabei. Vielleicht wird sie einfach vor diesem Haus warten. Aber worauf?
Ein Mann mit rotblonden Locken und einer selbst gedrehten Zigarette im Mund öffnet die Tür, stößt gegen sie, aber er reagiert nicht, schaut nicht auf, klopft nur sein Feuerzeug gegen den Handballen und zündet seine Zigarette an. Er atmet laut aus und schließt die Augen. Ein Moped knattert vorbei. Herbert hatte genau diese Löckchen bekommen, denkt sie, als er anfing, seine Haare wachsen zu lassen. Nach fünf Jahren als Berufssoldat stieg er plötzlich bei der Bundeswehr aus. Um ganz bei ihr sein zu können, hatte er gesagt. Sein kurzgeschorenes Haar. Wie es sie erregte, mit den Fingern darüberzustreichen, als sie sich kennenlernten. Die kitzelnde Berührung auf der Handfläche. Und auf einmal wuchsen ihm diese rotblonden Locken. Sie explodierte vor Lachen, weil er so anders aussah und von einem Tag auf den anderen endlos auf dem Sofa in ihrer Küche hing, nur, sobald sie aus der Hochschule nach Hause kam, wie ein Hund um sie herum sprang und aufgeregt von Videospielen erzählte, die er entwickeln wollte, während er seine Erdnussflips in der ganzen Wohnung verteilte und sie mit dem Pflanzenaroma seiner Joints umhüllte.
Sie wühlt mit beiden Händen in ihren Manteltaschen. Der Mann zieht seine Augenbrauen hoch und lässt den Mund aufklappen, in seinem kurzen Bart glitzern graue Haare. »Was machst du denn hier«, bellt er, »wo warst du denn auf einmal, vorgestern?« Er starrt sie an, seine Mundwinkel sind aufgesprungen, weißliche Spucke zieht darin Fäden.
Sie weicht zurück und zieht ein zerknautschtes Päckchen Camel aus dem Mantel, sucht nach einer unversehrten Zigarette und steckt sich schnell die einzige nicht zerbrochene in den Mund. Als er ihr Feuer gibt, entblößen die hochgekrempelten Ärmel seiner Strickjacke rote Pusteln auf seinem Arm. Um sein Handgelenk silberne Kettchen. Seine Augen kommen ihr zu nah, schnelle Tierchen, die auf ihr herumkrabbeln, denkt sie, gelbe Zähne, sein Rauch kriecht ihr in den Kragen. Kennt sie diesen Typen?
»Die ham noch den gesamten space unter Wasser gesetzt, die ganze rote Mall geflutet. Du Arme, kriegst auch nichts mit, hast ziemlich was verpasst.« Er grinst, scheint sich zu freuen, dass es ihm besser geht, und nickt, weil ihm nur das Beste gebührt. »Wohnste etwa auch hier?« Sein Hinterkopf deutet auf ein gelbes Schild, das über der Tür hängt. HOTEL HEDWIG steht in schwarzer Schrift darauf.
Eine Dorfhoteltür. Dunkelbrauner Metallrahmen. Strukturiertes Glas.
Hier ist sie mit ihren Kindern gewesen. Beide haben sie ihre Hand nicht loslassen wollen, also hat sie die Tür mit der Stirn aufgedrückt, an ihrem Arm baumelnd eine Tüte mit Nasi Goreng. Die Plastiktüte schnitt ihr ins Handgelenk.
Die Kinder sind hier! In diesem Hotel!
Sie dreht sich um, schnippt die Zigarette auf die Straße. Der Mann schnauzt: »Und wieder ist sie weg!«
Sie geht durch die Tür.
Sie haben das Strukturglas der Tür berührt. Mit den Fingerspitzen die Landschaften auf der Oberfläche erkundet.
Der Flur ist jetzt leer. Die Theke unbesetzt.
Sie hat fünfzig Euro bezahlt. Ein Doppelzimmer mit Frühstück, Klo auf dem Flur. Da stand eine kurzhaarige, stark geschminkte Frau hinter dem Tresen. Vor der hatte sie Respekt. War das Hedwig? Eine bestimmte Sorte praktisch veranlagter Frauen jagt ihr Unbehagen ein.
Hinter der Theke führt eine Treppe mit rauchblauem Teppich nach oben. Sie sieht sich um und steigt dann die Stufen hoch, verharrt kurz, lauscht, aber sie hört nicht den kleinsten Mucks. Weil sogar der Mucks versteckt ist, denkt sie. Weil sie wahrscheinlich inzwischen das komplette Zimmer in eine Höhle verwandelt haben. Höhlen sind das Spezialgebiet ihrer Kinder, da macht ihnen keiner was vor. Sie erinnert sich an ihren letzten Geburtstag, als die Kinder ihr eine selbst gebaute Höhle geschenkt haben und sie fast den ganzen Tag darin verbrachten. Sie lächelt, sie haben sicher etwas für sie vorbereitet, das machen sie ja am liebsten.
Sie hat was genommen. Das war’s. Sie war das letzte Mal hier auf irgendwas. Das sie nie genommen hat, vorher. Und sie hat Angst davor gehabt, wollte das nicht nehmen, aber sie musste. Wegen – was denn? Was war denn davor? Herbert hat traurig ausgesehen. Sie bleibt stehen, hält sich am Geländer fest. Atmet tief ein. Reibt sich die Nase. Ihr Gesicht ist nass, der Schweiß schmeckt sauer.
Die letzten zwei Stufen nimmt sie mit einem Schritt. Der Boden knarrt, Teppich auf alter Diele. Vom Flur gehen fünf Türen ab, eine schmale Klotür steht weit offen. Es muss das Zimmer auf der anderen Seite sein, die Kinder waren ja mit ihr nach gegenüber aufs Klo getrampelt. Sie zögert. Sie wird die Tür öffnen und ihre Kinder in den Armen halten. Sie fängt an zu summen. Die Kinder sind sicher schon lange wach und vermissen sie. Ein Geburtstagslied, denkt sie, die beiden wollen immer Geburtstag spielen. Nein, nein, ihr fällt eine Arie aus dem Lohengrin ein, genau, die, wo Elsa zurückkehrt! Sie hört das Orchester und setzt ein, dabei reißt sie die Tür auf und stürzt aufs Bett zu.
Das sind aber nicht ihre Kinder. Im Bett liegt ein Paar, eng umschlungen, Wange an Stirn. Die Frau wacht auf, schaut sie verschlafen an. Die beiden hier sind in einer anderen, einer sehr heilen Welt. Genau so hat sie mit Herbert in allen Kaschemmen dieser Welt gelegen. Überall, wo sie ankamen, gingen sie erst einmal ins Bett. Um miteinander zu schlafen und dann nah aneinander wegzusacken.
Die Frau schließt ihre Augen wieder und schmiegt sich an den Mann, dessen Kinn zur Tür weist. Er murmelt nur: »Du bist falsch.«
Sie steht vor dem Bett, die Hand an den Mund gepresst. Sie dreht sich um. Es ist stickig. Die Fenster sind geschlossen, an der Wand ist das Waschbecken, darauf steht der Becher, den sie gefüllt hatte.
Ihre Stimme zittert. »Wo sind meine Kinder? Die waren hier. Wo sind sie jetzt?«
Hier hat sie mit ihnen gelegen. Das ist der Geruch der ausgekochten zitronengelben Bettwäsche. Sie haben noch geschlafen.
Sie schreit.
An der Theke steht sie vor der Frau mit den stoppeligen Haaren.
»Ihre Kinder sind direkt nach dem Frühstück gegangen. Ich hab denen natürlich gesagt, das geht auf gar keinen Fall. Ist ja gefährlich mit dem Verkehr, und die Straßenbahnen, was. Aber Ihr Töchterlein hat gesagt: Nee, das machen wir immer so, wir gehen allein zur Kita, der Kleine und ich, wenn die Mami nicht kann, wir sind auch schon drei und fünf, zu zweit also acht. Na, dann sind sie eben losgewackelt. Und das hier haben sie Ihnen gemalt, soll ich Ihnen geben.«
Sie schiebt ihr ein Blatt rüber, darauf sind drei unterschiedlich große Gestalten, die fast gleich aussehen, außer der kleinsten, die hat kürzere Haare als die anderen beiden. Sie halten sich an den Händen, alle Arme sind unterschiedlich lang, immer gerade so, wie es nötig ist. Die drei lächeln glücklich, die Blumen sprießen von ihren Füßen baumhoch um sie herum, über ihnen schweben Vögel in ewiger Sonne.
»Das sind ganz besondere Kinder, na, das wissen Sie ja, was. Die haben hier schon klar gesagt, was sie zum Frühstück wollen. ’ne Schrippe mit Butter und Marmelade drauf, hat die kleine Prinzessin gesagt. Aber nur, wenn Sie Himbeermarmelade haben, ansonsten die Schrippe auf jeden Fall nur mit Butter! Der Kleine hat gesagt: Keine Sorge, die ist eben süchtig. Ich hab das nicht verstanden, ging nicht rein in meine Birne. Frag ich ihn: Was sagst du da? Meint er: Na, meine Schwester ist eben süchtig. Die vergisst alles andere, wenn sie nur HIMBEERMARMELADE kriegen kann! Da hab ich echt geglotzt. Sitzt da so’n Dreikäsehoch und erzählt mir was von ’ner Sucht. Und dann sagt er, er will noch Servietten, also geh ich los und bring ihnen Servietten, so rote Servietten, und da sagt der kleine Mann ganz freundlich, aber eben auch sehr bestimmt: Nee, brauch Blau. Nicht Rot. Brauch Blau! Hat er gleich ’n paarmal hintereinander gesagt, nee, befohlen hat er das, ganz streng: Brauch Blau, du Haubitze. Und als ich dann, den Mund nicht mehr zugekriegt, was, ’ne blaue Serviette gefunden hab und ihm gebracht, da hat er gelächelt und gesagt: Das ist gut. Da haben wir alle gelacht hier. Na, die gehen ihren Weg. Mutti, das sag ich dir, das haste gut gemacht.«
Sie hält sich am Tresen fest. Wischt sich die Tränen mit beiden Händen aus dem Gesicht. Die dunkelblaue Serviette in ihrer Hand ist matschig. Himbeermarmelade? Brauch Blau, du Haubitze? Das sind ihre Kinder. Sie kann ihre Stimmen hören. Mama, ich brauch Blau, hat ihr Sohn gemurmelt, auf ihrem Arm, dicht an sie gekuschelt. Nachdem sie zu Larry gesagt hatte, sie müsse am Abend endlich mal wieder raus, sie brauche sofort Drinks, Erwachsene und Gehüpfe von Restaurant zu Bar, mit großen Schritten und leichtfertigen Diskussionen, wo man zwischen den anderen allein ist, kurz frei ist vom Aufpassen, dem Dienen für die Kinder, nein, frei auch von allen Einengungen, die einem die eigenen Gefühle machen, verstehst du, ich brauch Blau, hatte sie gesagt.
Ihre Kinder merken sich jedes Wort.
Sie ist aufgestanden, als sie schliefen. Die Kinder sind im Hotel Hedwig in Sicherheit, hat sie gedacht. Deshalb überhaupt waren sie im Hotel Hedwig, um sich in Sicherheit zu bringen. Und dann wollte sie nur ganz kurz in die Bar. Herbert hat noch an ihr geklebt, sie wollte ihn abschütteln. Er war am Mittag da gewesen. Ihn aus sich heraustrinken. Sie hatte nicht neben den Kindern im Bett liegen bleiben können. Einmal durch die Straße rennen und einen Wodka. Und dann zu den Kindern zurück.
Jetzt klammert sie sich am Tresen fest. An der Unterseite vom Glück. Die Unterseite vom Glück ist glitschig, denkt sie, und dann fällt ihr ein Moment aus einem Film ein, von dem Herbert damals beim Mittagessen auf Mallorca erzählt hatte. Weil er eigentlich mit ihr tauchen gehen wollte, das wäre normal im Urlaub, wenn nicht immer die Kinder wären. Da könnten sie sich erholen und zusammen sein. Endlich allein zusammen. In dem Film ging es um eine Gruppe Taucher mitten auf dem Meer, die weit rausfahren, wirklich fern der nächsten Küste, und paarweise ins Wasser springen, um zu tauchen. Als sie aufs Boot zurückkommen, verzählen sie sich aber und vergessen bei der Abfahrt das Paar, das wohl im Honeymoon war, immer mit sich beschäftigt und irgendwie noch unter der Oberfläche. Das Boot fährt ohne sie ab.
Sie hat sich vorgestellt, wie diese Taucherin während des Tauchgangs ihren Partner ab und zu durch die Maske anzwinkert, sich unbeholfen mit Handzeichen verständigt und dann mit der Sauerstoffflasche in einer Höhle hängen bleibt, wie ihre Luftversorgung unterbrochen wird. Natürlich hilft ihr Mann ihr sofort, sie sind erleichtert, weil sie sich eine Flasche teilen können, aber dann finden sie den Ausgang aus der Höhle nicht, sind zwischen dunklen Algen und wuchernden Korallen gefangen. Komische Wasserpflanzen schlingen sich um ihre Flossen. Hatten die auf dem Boot nicht davor gewarnt, in Höhlen zu tauchen? Es ist so dumm.
Es wird dunkel. Sie will die Augen schließen und schnell zurück in die Tage, an denen alles einfach war. Wo die Bar an der Ecke nicht die Falle war, die sie von allem trennt. Nach der Geburt ihrer Tochter war sie natürlich oft müde und überanstrengt, sie vergaß aber deswegen nach der Probe nicht, sie abzuholen, sie funktionierte. Damals funktionierte sie noch. Eine Maschine, die richtig eingestellt war. Aufwachen, stillen, Milch für später abpumpen, duschen, Kaffee und Brei machen, Kaffee trinken und Brei füttern gleichzeitig und dann sich selbst und die Kleine anziehen. Die Kleine zur Babysitterin bringen. Auf die Probe düsen, Szenenproben, Klavierproben, Orchesterproben, Kostümproben, Fotos. Künstlerische Umwege? Keine Zeit. Sie konnte ihr Kind nicht ewig bei der Babysitterin lassen, es war noch klein und weinte, wenn die Mama nicht da war, zum Rumstehen war sie nicht angetreten.
Sie zuckt zusammen. Ihre Nase läuft. Sie drückt die Serviette von unten dagegen, aber zwischen ihren Fingern sind nur noch nasse blaue Schnipsel.
»Wann sind sie denn heute früh gegangen?«, fragt sie.
Die Stoppelfrau schaut sie an. Braune Augen, blau geschminkt.
Die Nase hört nicht auf zu laufen, sie zieht sie hoch, dreht sich schnell weg und sieht an der Rückwand einen Stapel Servietten. Sie geht nach hinten und nimmt sich eine.
Die Frau antwortet nicht.
Sie putzt sich mit der Serviette die Nase.
Sie hatte ewig nichts genommen, natürlich nicht, sie musste sich doch um die Kinder kümmern, und wenn sie Substanzen zu sich nähme, verlöre sie den Überblick.
Früher, als sie fest an der Oper engagiert war, hatte sie mal viel genommen. So wie alle. Geraucht hatte sie nicht, das griff die Stimme an, Alkohol war deswegen auch tabu. Also nahm man Drogen und Tabletten, die einen auf die verwunschene Insel ohne Termine trugen. Komme, was wolle, der Vorhang musste hoch! Es ging ausschließlich um das, was auf der Bühne passierte. Das hatte sie alle immer wieder auf dieses Floß getrieben. Upper, um zu leuchten, danach Unmengen von Downern. Sie musste was nehmen, um zu schlafen. Und dann was anderes, um wieder in Schwung zu kommen und die Bühne zu betreten.
Aber auch nachdem die Kinder geboren waren und sie nach dem ununterbrochenen Hin- und Hergehopse zwischen krabbelndem Kleinkind und brüllendem Baby, wenn tatsächlich einmal beide gleichzeitig schliefen, am Abend große Sehnsucht danach gehabt hatte, mit einem eiskalten Bier zu Herkules auf das lauwarme Sofa zu sinken und sich ein paar Stunden vom Geballere seiner Games verwöhnen zu lassen, trank sie nicht.
Die Stimme war alles, was sie hatte.
Und der Drogenkonsum war mit der Kinderaufzucht nicht vereinbar.
Aber als Herbert ging, nahm er ihre ganze Kraft mit sich. Kurz bevor er verschwand, drehte er ihr Joints vor. Dreißig Sticks in einer Schatulle, die sie damals aus Mexiko mitgebracht hatten. Damit sie nicht durchdrehe, wenn er zur Vigräne ziehe. Damit sie schlafen könne. Und tags nicht dauernd heulend ihren Kopf gegen die Backsteinwand ramme. Er war ganz lieb. Er müsse nun leider zur Vigräne ziehen, das gehe nicht anders. Für ihn sei das ja auch schwer, aber wenn seine Schnullita ihn liebe, dann werde sie ihn lassen. Die Vigräne habe gesagt, sie sei sein Schicksal, sie gehörten zusammen. Und die Vigräne sei sich viel sicherer in ihrer Liebe als sie. Und dass er sie jetzt verlasse, das sei doch auch nur ein Teil ihrer Liebesgeschichte. Sie hätten doch immer gesagt, sie seien auf ewig zusammen, hier und auf der anderen Seite. Den Satz hatten sie in einem Theaterstück gehört. Die andere Seite sei aber nicht der Tod, wie sie immer gedacht hätten, also das Zusammensein über alle irdischen Grenzen hinweg, sondern, wenn sie sich trennten, das geheime Zusammenhalten unterhalb der Oberfläche des Sichtbaren. Sie müsse ihn gehen lassen. Aus Liebe. Wenn sie ihn liebe, müsse sie wollen, dass er zur Vigräne geht und glücklich wird. Er komme dann auch bald wieder und bringe neue Joints. Sie könne ja nicht bauen in ihrem Zustand.
Nach dem vierten Joint fingen ihre Panikattacken an. Sie rauchte weiter. Die Tränen rannen. Der Joint wurde nass. Sie legte ihn in einen Aschenbecher und zündete sich einen anderen an. Sie hatte gesehen, dass man einen Joint ein bisschen rauchen konnte, wieder ausmachen und am nächsten Tag zu Ende rauchen. Sie legte den Sticky, wie Herbert ihn nannte, seitlich an den Aschenbecher. Stellte den Aschenbecher auf den Balkon. Sie lag im Bett. Eines der Kinder rief nach ihr, sie ging ins Kinderzimmer, schwankte und legte sich dazu. Ihr war schwindelig. Das andere Kind war auch aufgewacht und musste pinkeln. Sie kam nicht mehr hoch. Die Große tapste allein zum Klo. War der Joint wirklich aus? Oder schmorte er weiter? Roch es nicht verbrannt? Steht ihr Kind gleich in Flammen? Sie sprang auf und stolperte gegen den Türrahmen. Hinter den Augen blitzte es grell. Das Kind weinte. Sie schrie: »Raus, sofort raus aus der Wohnung!«
Vom Balkon beginnend, würde gleich der vordere Teil der Wohnung brennen. Sie schnappte sich das schlafende Kind und zog das heulende, das noch auf dem Klo saß, mit ins Treppenhaus. Wo waren die Flammen? Sie musste die Nachbarn warnen. Sie klingelte an der Wohnung nebenan Sturm, niemand öffnete, das Kind an der Hand schrie, das andere auf ihrem Arm inzwischen auch, sie stolperten eine Treppe tiefer. Die Tür wurde geöffnet. Die Nachbarin schimpfte, was denn da los sei. Ob sie die Polizei rufen solle, das könne sie gern tun.
»Was ist denn, wo soll hier was brennen?«, fragte ein Mann in Unterhose, der neben der Nachbarin ins Treppenhaus trat.
»Auf meinem Balkon. Das geht so schnell. Gleich brennt hier alles. Die Kinder müssen erst mal in Sicherheit.« Sie stockte. Überlegte. Sagte schnell: »Ich glaube. Ich habe es nicht gesehen. Das heißt also, vielleicht brennt es. Es gibt diese Möglichkeit. Ich habe geraucht. Ich schaue jetzt nach. Setzt euch kurz hier hin.«
Der Kleine war gerade wieder eingeschlafen, ein warmer Sack auf ihrem Arm, jetzt schrie er, als sie ihn weckte, um ihn auf die Treppe zu setzen. Sie konnte ihn doch nicht in den Brand mitnehmen. Und zu der Nachbarin auf den Arm, das hatte sie schon mal probiert, wollte er auf keinen Fall, er wollte nie auf einen fremden Arm, da waren schon einige Leute beleidigt gewesen, die ihr helfen wollten.
»Ich komm mit. Mama! Ich komme mit!« Ihre Tochter krallte ihre Hand. Der Kleine brüllte: »Mit! Mit!« So viel Geschrei, überall. Sie schloss die Augen. Nur Rauch war nicht zu riechen. Langsam ging sie mit den beiden zurück in die Wohnung. Schritt für Schritt. Sie konnten jederzeit wieder umdrehen und wegrennen. Nein. Es brannte nicht. Der Joint im Aschenbecher auf dem Balkon war aus. Sie berührte ihn. Er war kalt.
Die Panikanfälle wurden schlimmer. Meistens hatte sie Angst vor Feuer. Sie konnte sich nicht mehr ins Bett legen, immer wieder stand sie auf und kontrollierte den Aschenbecher, hielt Ausschau nach Rauch, nach versteckten Brandherden.
Oder sie dachte, sie hätte die Tür offen gelassen und es käme jemand herein, der ihr die Kinder wegnähme. Sie legte sich auf den Boden, irgendwo zwischen Balkon und Wohnungstür. Sie musste aufpassen. Sie wäre bereit, sofort zu reagieren. Sie konnte aber nicht einschlafen, weil sie immer noch einmal aufs Klo musste. Direkt nach dem Pinkeln noch ein zweites Mal. Für die Eventualität. Denn wenn sie einschliefe, müsste sie später so stark, dass sie nicht mehr aufstehen könnte, derart kurz davor wäre, zu platzen, es nicht mehr kontrollieren könnte, nicht mehr in der Lage wäre, zu den Kindern zu gehen, wenn die nach ihr riefen. Und so fürchtete sie sich schon, bevor sie einschlief, so sehr vor dem Aufwachen, dass sie lieber jetzt noch ein letztes Mal aufstand und alles an Flüssigkeit aus sich herauspresste. Sie fühlte sich ein bisschen geschwächt von dem Joint. Und trotzdem schob sie ihren übermüdeten Körper vor dem Einschlafen an der Wand entlang in Richtung Badezimmer und wieder zurück, das Blaseninnere permanent abhorchend. Sie musste versuchen, sich auf etwas anderes zu konzentrieren. Bloß nicht ans Pinkeln denken. Aber auch nicht an Herbert. Viel blieb nicht übrig. Sie hielt sich an Naturbilder. Ein Wald, der steil ansteigt, Moos, sie erklimmt eine Wiese voll Seegras, das wogt und sie in sich saugt. Riesige Blumen umschlingen sie und tragen sie auf ihren Blüten.
Sie zieht die Nase kräftig hoch, wischt sie mit einer frischen Serviette ab und fragt noch einmal.
»Wann sind sie denn los, heute Morgen?«
»Das war nicht heut früh. Das war gestern.«