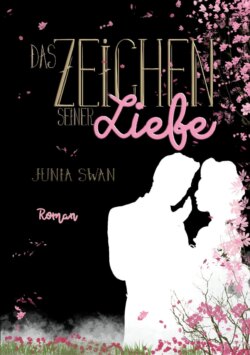Читать книгу Das Zeichen seiner Liebe - Junia Swan - Страница 9
Оглавление4. KAPITEL
Dorothy wusste, dass es überaus dumm war zu fliehen. Doch die Panik, die sich während des Tages in ihr aufgestaut hatte, siegte über die Vernunft und sie sprang aus dem Bett. In Windeseile schlüpfte sie in das Kleid, welches Beaufort ihr ausgezogen hatte, wobei sie sich nicht die Mühe machte, zuerst das Unterkleid anzuziehen. Dann stürzte sie zur Tür und riss diese auf. Der Flur lag dunkel vor ihr und sie zog die Tür hinter sich zu. Sie wusste nicht, dass dabei ein lauter Knall entstand, der von den Wänden widerhallte. In ihrer Welt war es so still, dass es für sie unvorstellbar war, dass Gegenstände, die kein Leben in sich hatten, Geräusche machen konnten. Mit pochendem Herzen rannte sie den, in fast vollkommener Dunkelheit liegenden Gang, entlang. Es war schwer für sie, sich des Nachts zurechtzufinden, da sie dringend auf ihren Sehsinn angewiesen war. Wenn auch dieser versagte, wuchs die Beklemmung in ihr. Sie hasste es, allein im Dunkeln zu sein. Trotzdem war die Furcht an Ort und Stelle zu bleiben größer, als die vor den Schatten der Nacht. Sie schrie schmerzerfüllt auf, als sie mit voller Wucht eine Kommode rammte. Wimmernd presste sie die Hände auf ihren Unterleib und versuchte, den Schmerz wegzuatmen. Als er sich etwas gelegt hatte, stürzte sie weiter, die Treppen hinunter und durch die große, unheimliche Halle. Der erloschene Kronleuchter, der von der Zimmerdecke herabhing, wirkte wie eine dicke, fette, überdimensional große Spinne, die sich an einem Faden auf den Boden herniederließ. Dorothy starrte ängstlich darauf, schluckte und rannte mit eingezogenem Kopf darunter hindurch und auf den Eingang zu. Mit zitternden Fingern schob sie den Riegel zurück und floh ins Freie. Schwer atmend sah sie sich um. Wohin sollte sie nun laufen? Egal, Hauptsache, weg von hier! Augenblicklich legte sich Kühle auf ihre Wangen und sie fröstelte. Der Sommer verlor eindeutig an Kraft, stellte sie nebenbei fest. Deswegen war es umso wichtiger, dass sie zu Susan zurückkehrte.
Es war bereits während des Sommers schon schwer für sie gewesen zu überleben, wie würde es erst im Winter sein, wenn nicht einmal mehr Beeren auf den Sträuchern wuchsen?
Dorothy wirbelte herum und prallte gegen eine warme Wand, die wie aus dem Nichts aufgetaucht war. Noch bevor sie begreifen konnte, was passiert war, wurde sie bereits angehoben und fand sich in den starken Armen Beauforts wieder, der sie fest an seine Brust presste und mit ihr ins Haus zurückkehrte.
„Wie dumm von dir“, stellte er fest, während er sie den ganzen Weg zurücktrug, den sie gerade gekommen war.
„Nei! Bättä niht!“, schluchzte sie und blickte ihn mit tränennassen Augen an.
Zum Glück war es dunkel und er konnte ihren Gesichtsausdruck nur schwer erkennen. Aber er ahnte, dass ihn ihr Anblick rühren würde. Sie hatte etwas an sich, das direkt in sein Herz fuhr. Als hätte sie eine besondere Verbindung dorthin entdeckt und nutzte diese schamlos aus.
Er kehrte mit ihr nicht in ihr Zimmer zurück und als er sie in seinem Schlafzimmer auf dem Bett absetzte, riss sie erschrocken die Augen auf, als ihr bewusst wurde, wo sie sich grade befand.
„Es tut mir leid“, meinte er, „doch ich habe dich gewarnt, dass eine Flucht nicht ohne Folgen bleiben würde.“
Ängstlich starrte sie ihn an, während sie unwillkürlich von ihm abrückte. Um nicht länger Zeuge ihrer Pein zu sein, wandte er sich um, trat zu einem Schrank, öffnete diesen und kehrte mit einem Seil zu ihr zurück. Verzweifelt wich sie vor ihm zurück, bis sie das Kopfteil des Bettes in ihrem Rücken fühlte und nicht weiter entkommen konnte. Beaufort setzte sich auf die Bettkante, griff nach ihrem Fuß und umfasste sie am Knöchel. Erbarmungslos zog er diesen auf seinen Schoß und sie fühlte das Seil, das er stramm darum band. Dorothy sank in sich zusammen, drehte den Kopf von ihm fort und versuchte ihr Gesicht mit einer Hand vor ihm zu verbergen. Als er fertig war, hielt er ihren Fuß noch kurz umschlossen und seine Wärme hätte etwas Beruhigendes an sich gehabt, wäre er nicht der Mann, der sie einem Folterknecht ausgeliefert hatte und dies am folgenden Tag wieder tun würde.
„Es tut mir wirklich leid“, sagte er, obwohl er wusste, dass sie ihn nicht hören konnte. „Ich hätte dir das alles gerne erspart. Wenn du doch nur ein wenig kooperieren würdest!“
Die junge Frau bewegte sich nicht, deswegen schob er ihren Fuß auf die Seite und näherte sich ihrem Oberkörper. Sanft umfasste er ihr Handgelenk und zog es von ihrem Gesicht weg. Ihre tränennassen Wangen schimmerten matt im schwachen Schein der Öllampe und obwohl sie die Augen geschlossen hatte, quollen dicke Tränen unter ihren Lidern hervor. Mit dem Daumen seiner rechten Hand strich er diese mitfühlend von ihrer Wange.
„Es tut mir wirklich leid“, wiederholte er leise.
Im nächsten Moment zog er sich zurück, richtete sich auf und wandte sich vom Bett ab. Während er sein Hemd öffnete, strebte er immer weiter von ihr fort und dem Ankleidezimmer entgegen. Dort erwartete ihn bereits sein Kammerdiener und half ihm dabei, sich zu entkleiden. Aus Rücksicht auf Dorothy schlüpfte er in eine weite Hose, bevor er zum Bett zurückkehrte. Dort stellte er fest, dass sie sich, bis auf das Heben ihrer Hand, welche sie wieder über ihr Gesicht gelegt hatte, nicht bewegt hatte. Er beugte sich zu ihr und stupste sie an, doch sie reagierte nicht. Deswegen begann er zum zweiten Mal an diesem Abend ihr Kleid zu öffnen. Diesmal widerstand er jedoch mit aller Willenskraft den Verlockungen ihres Leibes und befreite sie von dem Gewand. Dann griff er nach dem Hemd, das er mitgebracht hatte und zog es ihr über den Kopf. Dorothy drehte sich ein wenig und hob ihre Arme, damit sie in die Ärmel schlüpfen konnte. Noch immer würdigte sie ihn keines Blickes. Doch als ihre Augen auf die Fessel für ihre Hände fiel, die er zuvor aus ihrem Zimmer geholt hatte, zuckte sie zusammen. Sie biss sich auf die Lippen und suchte verzweifelt seinen Blick. Er konnte alle Gefühle darin lesen, die sie empfand: Verzweiflung, Angst, Resignation und ein Flehen, das an seinem Inneren zerrte.
„Ich werde sie dir nicht anlegen, wenn du mir versprichst, nicht davon zu laufen!“
Kurz überlegte sie, dann nickte sie.
„Versprichst du es mir, Dorothy?“
„Ja!“ Sie nickte nachdrücklich. „Ih spähe es!“
Sein Kehlkopf hüpfte, als er hart schluckte.
„Das ist deine letzte Chance! Wenn du noch einmal davonläufst, kann ich mit dir nicht mehr so nachsichtig sein!“
Ihre Augen hingen an seinem Mund und als er verstummte, versenkte sie diese wieder in seinem Blick.
„Ja“, hauchte sie.
Da hob er eine Decke hoch und sie kroch darunter. Er beugte sich über sie, um die Decke um ihren Körper festzustecken. Dabei kam sein Gesicht dem ihren nahe. Sofort drehte Dorothy den Kopf zur Seite und presste die Augenlider fest zusammen. Nur kurz musterte er sie, um sich schließlich zu erheben und auf die andere Bettseite zu gehen. Mit einem schweren Seufzer deckte er sich selbst zu, löschte das Licht und ließ sich auf sein Kissen zurückfallen. Er musste sich sehr beherrschen, um nicht nach ihr zu greifen oder eine Hand auf die sanfte Kurve oberhalb ihrer Hüfte zu legen. Stattdessen konzentrierte er sich auf ihre leisen Atemzüge.
Erst nach langer Zeit wurden diese langsamer und er meinte zu spüren, wie Dorothys Anspannung nachließ. Er richtete sich auf, stützte sich auf einen Ellbogen und musterte ihre schwachen Umrisse. Dorothy war ihm ein Rätsel. Sie war so anders, als er sich eine Taubstumme vorgestellt hatte. Er meinte, erkannt zu haben, dass sie über weit mehr Fähigkeiten als jene eines Tieres verfügte. So unglaublich es war, es schien, als wäre sie tatsächlich zu einer gewissen Denkleistung fähig. Obwohl ihre Flucht natürlich dagegen sprach. In diesem Zusammenhang war sie eindeutig ihren animalischen Instinkten gefolgt. Trotzdem konnte er das Gefühl nicht abschütteln, dass in ihr mehr steckte, als man weithin von taubstummen Menschen annahm. Beaufort hob langsam eine Hand und senkte diese über ihr Gesicht. Mit den Fingerspitzen folgte er den Linien ihrer Augenbrauen, strich über ihren Nasenrücken und glitt über ihren weichen, nun leicht geöffneten Mund. Leise seufzte sie und er zog seine Hand zurück. Wenn man sie so betrachtete, konnte man tatsächlich annehmen, sie wäre eine normale Frau.
„Mein Sohn, es tut mir außerordentlich leid, dass ich dir diesen Wahnsinn nicht ausgeredet, sondern dich dabei unterstützt habe!“
Der Earl of Somerset schritt mit hinter dem Rücken verschränkten Armen vor seinem Sohn auf und ab.
„Was genau meint Ihr, mit 'diesen Wahnsinn'?“, wollte Beaufort wissen und richtete sich in dem Armsessel ein wenig auf.
Vor wenigen Minuten hatte er sich darauf nieder-gelassen, kurz nachdem sein Vater ihn um eine Unterredung gebeten hatte.
„Ich hoffe, es ist nun nicht zu spät“, fuhr der Earl in Gedanken versunken und mit umwölkter Stirn fort.
„Was soll zu spät sein und wofür?“
Beaufort hob fragend die Augenbrauen, während er den Bewegungen seines Vaters mit den Augen folgte.
„Ich meine natürlich dieses Weib.“
„Dorothy?“
„Ja, Dorothy. Mir war ihr Name entfallen. Aber das tut nichts zur Sache. Es war ein Fehler, dass du sie geheiratet hast.“
Beaufort konnte nicht leugnen, ebenfalls zu diesem Schluss gekommen zu sein. Er kannte das Mädchen noch nicht lange, doch verhielt es sich zweifellos so, dass er sich eine Menge Arbeit mit ihr aufgebürdet hatte. Eigentlich verbrachte er seine Tage in Gesellschaft von Büchern, die sich um ihn stapelten, und nicht in der von Menschen. Wie sich ihre Anwesenheit mit ziemlicher Sicherheit auf seinen zukünftigen Tagesablauf auswirken würde, konnte er vom gestrigen Abend ableiten. Allerdings würde dies nicht von Dauer so sein, sondern nur so lange, bis er sie endlich auf das Landgut gebracht und aus seinem Leben verbannt hatte. Danach würde er seinen gewohnten Lebenswandel wieder aufnehmen.
Jetzt zuckte Beaufort allerdings gleichgültig mit den Achseln.
„Sie wird in unserem Leben keine Rolle mehr spielen, sobald sie den Erben geboren hat“, erinnerte er seinen Vater und überlegte, ob er die Rücksicht auf Dorothys Gefühle einfach hinten anstellen und diesen Vorgang beschleunigen sollte. Je früher er sie schwängerte, desto eher könnte er sie fortbringen.
„Und genau das ist das Problem“, erklärte der Earl und rang die Hände. „Der Erbe.“
Beaufort konnte sich keinen Reim darauf machen, was sein Vater sagen wollte.
„Warum soll das ein Problem sein?“, fragte er vorsichtig und hoffte, sich nicht als allzu schwer von Begriff darzustellen.
„Himmel“, brauste da der Earl mit gewohnt hitzigem Temperament auf. „Ich habe sie gesehen und gehört. Gestern. Bei der verfluchten Hochzeit.“
„Und?“
Beaufort verzog den Mund.
„Und?“, donnerte der ältere Mann und rammte sich eine Faust in die andere Hand. „Das fragst du noch? Es ist unmöglich, hörst du, unmöglich, dass sie diejenige ist, die dich zum Vater macht! Ihr Blut ist vergiftet und diese Krankheit würde sich auf das Kind übertragen! Es ist absolut undenkbar, dass du es zulässt, dass sie unseren lupenreinen Stammbaum ruiniert. Ihr Blut und dein Blut darf sich auf keinen Fall in einem Nachkommen vermischen!“
Beaufort riss die Augen auf und starrte seinen Vater entsetzt an. Er hatte recht! Warum hatte Beaufort nicht früher daran gedacht? Dorothy würde sein Blut vergiften! Mit einem Ruck sprang der jüngere Mann auf, um nun ebenfalls rastlos auf und ab zu gehen.
„Aber ich kann sie doch jetzt nicht auf die Straße setzen“, meinte Beaufort nachdenklich.
„Wir werden das anders regeln“, brummte der Earl. „Ich habe bereits einen Plan.“
„Und das Erbe der Carmichaels?“
„Wird deines bleiben.“
Dicht vor seinem Sohn hielt der Earl an und packte ihn an den Schultern. Dann sah er ihm streng in die Augen.
„Du musst nur tun, was ich dir sage und dann wird sich alles in Wohlgefallen auflösen.“
Beaufort nickte nicht gänzlich überzeugt. Allerdings hatte das Argument, Dorothy würde den Stammbaum seiner Familie beschmutzen, all seine Pläne durcheinandergebracht. Interessiert lauschte er den Ausführungen des Earls. Natürlich erkannte er die Genialität des Planes seines Vaters, doch gleichzeitig hatte Beaufort das Gefühl, als würde sich eine ätzende Flüssigkeit in ihm ausbreiten. War das sein schlechtes Gewissen? Aber heiligt nicht der Zweck die Mittel? So sagt man doch, oder etwa nicht? Und wenn der Zweck die Mittel heiligt, ist doch eigentlich alles erlaubt.
Über Nacht hatte sich Dorothys schmerzende Zunge etwas erholt und sie konnte beim Frühstück ordentlich zugreifen. Da sie noch immer ans Bett gebunden war, hatte man Tisch und Stuhl näher gerückt. Jedes Mal, wenn ein Diener ihre Fesseln musterte, wollte sie vor Scham am liebsten im Erdboden versinken.
Beaufort hatte ihr beim Ankleiden geholfen und sie dabei noch einmal an ihr Versprechen, nicht davon zu laufen, erinnert. Auch hatte er ihr erklärt, dass er ihr die Armfesseln nach dem Essen wieder anlegen würde, da er den Methoden des Lehrers vertraute. Dorothy hatte gegen die Tränen angekämpft – es hatte keinen Sinn, an sein Mitgefühl zu appellieren. Diese Erkenntnis hatte sie mittlerweile gewonnen.
Deshalb zögerte sie das Essen so lange wie möglich hinaus. Doch Beaufort kehrte erst lange, nachdem sie das Mahl beendet hatte, zu ihr zurück. Er wich ihrem Blick aus und deutete ihr, ihm den Rücken zuzuwenden. Schweren Herzens gehorchte sie und rührte sich nicht, als er die Fesseln anlegte. Nachdem er fertig war, sah sie über die Schulter zu ihm, doch er hatte sich bereits umgedreht und steuerte, ohne sie weiter zu beachten, die Tür an. Augenblicke später war sie allein. Einsam stand sie dort, wo er sie verlassen hatte und starrte auf die geschlossene Tür, während ihre Gedanken zu Susan zurückkehrten. Die Sehnsucht nach jener Frau, die ihr mehr als ihre leibliche Mutter bedeutete, überwältigte sie. Dorothy verharrte wie erstarrt. Erst als sich die Tür nach langer Zeit wieder öffnete, rührte sie sich um Beaufort entgegen zu sehen. Aber es war nicht Beaufort, der auf sie zukam und Grauen überwältigte sie. Es war der Lehrer und es gab keine Möglichkeit, ihm zu entkommen.
Die Marter dauerte den ganzen Tag, wurde nur kurz für das Mittagessen, welches sie aufgrund der Schmerzen nicht einnehmen konnte, unterbrochen. Aber sie wollte sich nicht beschweren, jede Minute, die sie nicht in Gegenwart ihres Folterknechtes verbringen musste, war für sie mehr wert als alles Gold der Welt.
„Ich sage dir, eines Tages werde ich dir die Zunge abschneiden, wenn du dich jetzt nicht anstrengst! Da du sie ohnehin nicht brauchst, kann ich sie dir ja abtrennen, was meinst du?“
Dorothy war wie gelähmt vor Angst und ihre innere Anspannung wuchs ins Unermessliche. Sie wünschte sich doch nichts sehnlicher, als sprechen zu können! Von ganzem Herzen begehrte sie zu sein, wie all die anderen!
Als der Lehrer am Abend endlich von ihr abließ und sie allein war, kroch sie unter das Bett. Sie wusste, dass sie vor ihm auch dort nicht in Sicherheit war, doch die Enge dieses Ortes wirkte auf sie beruhigend. Es war, als läge sie in einem verborgenen Unterschlupf, in welchem niemand sie jemals finden würde. Sie wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war, als sich das Seil plötzlich um ihren Knöchel spannte. Erschrocken darüber, dass der Lehrer zurückgekehrt war, begann sie verzweifelt zu weinen, machte jedoch keine Anstalten, unter dem Bett hervorzukriechen. Da fühlte sie eine Hand, die ihren Knöchel umfasste und sie daran unter dem Möbelstück hervorzog. Sie war zu müde, um sich zu wehren, befürchtete aber das Schlimmste. Ein riesiger Stein fiel ihr vom Herzen, als sie Beaufort erkannte, der auf sie herabsah. Eigentlich hätte sie ihn an der rücksichtsvollen Art erkennen müssen, mit der er sie unter dem Bett hervorgezogen hatte. Aber die Panik hatte dies offen-sichtlich verhindert.
„Was machst du da?“, fragte ihr Mann und musterte sie angewidert. „Du bist von Kopf bis Fuß staubig.“
Dorothy wandte verschämt den Blick ab und versuchte, auf die Beine zu kommen. Es war entwürdigend, auf diese Weise vor ihm auf dem Boden zu liegen. Helfend griff er ihr unter die Achseln und stellte sie wie ein kleines Kind auf die Füße.
„Dane!“, murmelte sie und zuckte wegen ihrer schmerzenden Zunge unmerklich zusammen.
„Ich kann nicht dulden, dass du dich wie ein Tier benimmst!“, herrschte er sie an. „Ich weiß, dass du nicht zu Denken vermagst, trotzdem bist du ein Mensch. Sogar ein Hund kann lernen, wie er sich zu benehmen hat, also wirst auch du es vollbringen. Hast du mich verstanden?“
Dorothy starrte ihn mit großen, erschrockenen Augen an. Während er sie streng musterte, entdeckte er eingetrocknetes Blut an ihren Mundwinkeln und dunkle Flecken an ihrer Wange.
Zusätzlich zu ihrem blauen Auge, sah sie aus, als würde man sie misshandeln. Sein Vater hatte recht. Niemals würde man diese Frau der Gesellschaft präsentieren können!
„Was ist das?“, fragte er und deutete auf die neuen blauen Flecken.
Dorothy blickte ihn an, als wüsste sie nicht, was er meinte. Er griff in seine Jackentasche und holte ein Taschentuch hervor, ging zur Waschschüssel, benetzte es mit etwas Wasser und kehrte zu ihr zurück. Entschlossen griff er nach ihrem Kinn und hob es an, während sie die Augen schloss, als wollte sie nicht sehen, was er vorhatte. Vorsichtig tupfte er das Blut von ihren Mundwinkeln, wobei das Verlangen, sie zu küssen, beinahe übermächtig wurde. Es war eine böse Stimme in ihm, die ihn daran erinnerte, dass sie nicht wie ein normaler Mensch empfand und er mit ihr deshalb machen konnte, was er wollte. Auch Tiere mussten ihren Herren untertan sein. Warum nicht auch Dorothy ihm? Ohne länger darüber nachzudenken, senkte er den Kopf und presste seinen Mund auf ihren. Er fühlte ihr Zurückweichen, weshalb er sie mit beiden Armen umschlang und fester an sich drückte. Als er mit seiner Zunge ihre Lippen teilte, keuchte sie und zuckte vor Schmerz zusammen, doch er gab nicht nach. Die Erziehung eines Hundes war immerhin auch keine für das Tier schmerzfreie Angelegenheit. Im Gegenteil, es musste die Rute erfahren, um sie zu fürchten. Allerdings fragte sich Beaufort, weshalb sie Schmerz dabei empfand, wenn er sie küsste. Wahrscheinlich war es Überraschung, die sie hatte zusammenfahren lassen. Immerhin war er der erste Mann, der sie auf diese Weise liebkoste.
Obwohl sie seine Zärtlichkeiten nicht erwiderte, steigerte sich seine Begierde. Ein spezieller Körperteil an ihm war so hart, wie schon lange nicht mehr und drängte nach Erleichterung. Ohne den Griff zu lockern, hob er sie hoch und trug sie zum Bett. Er machte sich nicht einmal die Mühe, sie ganz darauf zu legen, sondern gab sich zufrieden, damit dass ihr Rumpf auf der Matratze zu liegen kam. Nicht einen Augenblick lang hatte er den Mund von ihrem gelöst, nun presste er sie mit einer Hand aufs Bett, während er mit der anderen ihre Röcke nach oben schob. Die Warnung seines Vaters, keine Nachkommen zu zeugen, kam ihm in den Sinn, doch verdrängte er diese. Sollte Dorothy ein Kind zur Welt bringen, würde er es fortbringen, ohne dass jemals jemand davon erfahren würde. So einfach war die Sache und die Ehre der Familie würde nicht gefährdet werden. Plötzlich schmeckte er Blut. Irritiert richtete er sich etwas auf und unterbrach die Plünderung ihres Mundes. Erschrocken stellte er fest, dass ihre Mundwinkel bluteten. War er zu brutal mit ihr gewesen?
„Öffne den Mund!“, befahl er, doch sie reagierte nicht, da sie die Augen geschlossen hatte.
Da griff er unter ihr Kinn und zwang die Kiefer auseinander. Verwirrt stellte er fest, dass ihre Zunge blutete. Wie war das möglich? Er hatte sie doch nur geküsst?!
Seine Leidenschaft fiel wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Wie konnte das geschehen? Ja, er war nicht liebevoll mit ihr gewesen, doch hatte er sie weder so grob behandelt, dass sie bluten musste, noch absichtlich verletzt. Unangenehm berührt richtete er sich auf und zog ihre Röcke wieder tiefer. Noch immer bewegte sie sich nicht. Nur ihren Kopf drehte sie von ihm fort, als wollte sie ihr Antlitz vor ihm verstecken. Er stupste sie an, wollte, dass sie ihn ansah und ihm erklärte, was gerade geschehen war. Doch sie konnte ja nicht sprechen – wie sollte sie sich ihm begreiflich machen? Abgesehen davon reagierte sie auf seine Aufforderung nicht.
Noch kurz starrte Beaufort sie mit schlechtem Gewissen an, dann wandte er sich um und verließ den Raum.
In der Bibliothek schenkte er sich einen doppelten Whisky ein und leerte das Glas in einem Zug. Dann griff er nach einem Buch, welches er vor wenigen Stunden zu lesen begonnen hatte, setzte sich auf einen Armstuhl und vertiefte sich angestrengt in die Lektüre. Es wäre doch gelacht, wenn er dieses Waldmädchen nicht aus dem Kopf bekommen konnte!
Dorothy drehte sich auf die Seite, zog ihre Knie an und rollte sich, so gut es ging, zu einer Kugel zusammen. Sie fühlte sich so verlassen und allein, wie damals, bevor sie geflohen war. Allerdings hatten ihr zu jener Zeit die Ge-danken an eine Flucht ein Gefühl der Freiheit vermittelt. Doch nicht einmal das war ihr geblieben. Sie war Beaufort hilflos und vollständig ausgeliefert. Wie sollte sie diesem Martyrium jemals entkommen können?
Dorothys Anblick rührte Beaufort, als er weit nach Mitternacht sein Schlafzimmer betrat. Sie lag wie ein kleiner Hund zusammengerollt auf dem Bett, ihre gefesselten Arme an ihren Seiten, das Seil wie eine Leine um ihren Knöchel geschlungen. Unwillkürlich schauderte er. Er würde sich für ein Monster halten, wenn er dies einer normalen Frau angetan hätte. Doch Dorothy war nicht normal, oder etwa doch? Sie sah aus wie ein Mensch, aber fühlte wie ein Tier. Er musste das endlich in seinen Kopf bekommen und die Fragen unterdrücken, die ihn immer wieder quälten. Denn wie war es möglich, dass sie lesen und schreiben konnte? Tiere waren dazu nicht in der Lage. Wobei sich natürlich die Frage stellte, ob man diese Fertigkeiten nicht auch intelligenten Affen beibringen könnte. Und wie anmutig sie ihm mit ihren Händen erklärt hatte, dass sie Pralinen zu essen wünschte! Auch, wenn die Welt der Wissenschaft es vehement abstreitet, so ist doch dies ebenfalls eine Art der Kommunikation. Allerdings greifen auch Tiere auf eine rudimentäre Sprache zurück. Man muss sich nur das Schwanzwedeln eines Hundes vor Augen führen. Beaufort kam zu dem Schluss, dass er akzeptieren musste, nicht alles zu verstehen und es in seinem Fall dringend ratsam wäre, denjenigen zu vertrauen, die sich bereits jahrzehntelang mit der Thematik der Taubheit befasst hatten. Dazu gehörte auch Dorothys Lehrer.
Trotzdem widerstrebte es ihm, sie schlechter als seine Hunde zu behandeln, deswegen breitete er eine Decke über ihrem zarten Körper aus. Dann legte er sich auf seine Bettseite und schlief umgehend ein.
Am späten Vormittag öffnete Beaufort die Tür zu seinem Schlafzimmer, da er Dorothy unerwartet holen wollte, um sie dem Anwalt der Familie Carmichael zu präsentieren. Der Advokat hatte darauf bestanden, sich von Dorothys körperlichem Wohlbefinden zu überzeugen, bevor er das komplette Vermögen der Familie auf Beaufort überschreiben würde. Beaufort erstarrte auf dem Absatz, als er sah, was in dem Raum vor sich ging. Dorothy saß festgebunden auf einem Stuhl, ihr Mund wurde von irgendetwas auseinander gehalten, während der Lehrer mit zwei schweren Zangen ihre Zunge malträtierte. Mit einem Blick entdeckte er Dorothys zusammengeballte Hände und sah das Zucken ihres Körpers, der offensichtlich Schmerzen litt.
„Was machen Sie da?“, stieß Beaufort entsetzt hervor und der Lehrer warf ihm einen kurzen Seitenblick zu.
„Ihre Zunge zähmen“, erwiderte er, ohne in seiner Tätigkeit innezuhalten.
Ein Wimmern entrang sich Dorothys Kehle und das Entsetzen in Beaufort nahm zu.
„Hören Sie sofort damit auf!“, herrschte er und stürzte zu dem anderen Mann.
Noch bevor der ahnen konnte, was der Jüngere plante, hatte dieser ihn schon zurückgestoßen und die Zangen aus dem Mund der junge Frau entfernt.
„Machen Sie diese Vorrichtung weg!“, schrie Beaufort nun, seine Stimme überschlug sich vor Bestürzung, und deutete auf das Drahtgestell, welches verhinderte, dass Dorothy ihren Mund schließen konnte.
„Nein“, erwiderte der Lehrer mit unterdrückter Wut. „Wenn ich jetzt aufhöre, war alles umsonst!“
„Sie meinen wirklich, das soll helfen?“ Beaufort musste an sich halten, um nicht über den anderen Mann herzufallen. „Was Sie hier machen ist unmenschlich!“
„Die Wissenschaft …“
„Hören Sie mit der Wissenschaft auf!“, unterbrach ihn Beaufort zornig. „Die Wissenschaft ist für den Menschen da, nicht umgekehrt! Und nun entfernen Sie endlich dieses Ding!“
„Dann wird sie niemals sprechen ...“
„Entfernen. Sie. Dieses. Ding!“
Beaufort packte den Lehrer am Kragen und zerrte ihn vor Dorothy. Unwillig riss der Peiniger die Vorrichtung aus ihrem Mund, wobei er so grob vorging, dass die junge Frau vor Schmerz aufschrie und erneut zu bluten begann.
„Sie Unmensch!“, brüllte Beaufort, angesichts solch roher Gewalt, vollkommen außer sich. „Hinaus mit Ihnen! Ich will Sie niemals mehr auf meinem Land sehen!“
Die Augen des Lehrers funkelten vor unterdrückter Wut. Er packte die Zangen und das Drahtgestell in eine dunkle Ledertasche, wandte sich ab und steuerte auf die Tür zu.
„Wie Ihr meint“, sagte er nur und verschwand.
Doch Beaufort hatte seinem Abgang keine weitere Aufmerksamkeit geschenkt und sich sofort wieder der weinenden Dorothy zugewandt. Um Himmels willen, was hatte er getan? Wie hatte er sie nur der Willkür dieses Mannes überlassen können? Mit zitternden Fingern löste er die Fesseln an ihren Händen, dann hob er sie auf und barg sie tröstend an seiner Brust.
„Bist du stark verletzt?“, flüsterte er besorgt. „Hast du schlimme Schmerzen?“
Obwohl er wusste, dass sie ihn nicht hören konnte, redete er beruhigend auf sie ein, während sie ihren Kopf an seiner Schulter barg und eine Hand auf seinen Brustkorb legte. Er setzte sich aufs Bett, sie auf seinen Schoß, hob eine Hand an ihren Hinterkopf und streichelte sie sanft, während sie weinte, als könnte sie damit niemals mehr aufhören.
„Suan“, schluchzte sie und es klang wegen der geschwollenen Zunge noch undeutlicher als sonst. „Suan!“
Sein schlechtes Gewissen, Dorothy den Händen eines Folterknechts überantwortet zu haben, ließ den Entschluss in ihm reifen, tatsächlich nach der alten Frau zu schicken. Immerhin hatte er das diesem unglücklichen Mädchen versprochen.
„Ja“, er nickte. „Ja. Susan wird bald hier sein.“
Erst jetzt verstand Beaufort, weshalb Dorothy kaum gegessen hatte. Weil es sie so schmerzte. Meine Güte, er war so ein Dummkopf gewesen! Fast meinte Beaufort so etwas wie Abscheu vor sich selbst in sich aufsteigen zu fühlen. Als wäre das noch nicht genug, hatte er ihr auch noch seinen Kuss aufgezwungen, weil er in dem Wahn gefangen gewesen war, zu glauben, sie müsste wie ein Tier gezähmt werden. Auch, wenn es tatsächlich so wäre, war dies immerhin noch keine Entschuldigung dafür, grausam zu sein. Das erkannte er jetzt und ein erster Zweifel, ob die Wissenschaft nicht irren könnte, irrlichterte durch seine Gedanken.
„Entschuldige“, flüsterte er und seine Lippen streiften ihre Schläfe. „Das hätte nicht passieren dürfen! Es tut mir überaus leid.“
Noch immer barg sie ihren Kopf an seiner Brust, noch immer zitterte ihr Leib wie Espenlaub. Er legte seine Hand über ihre, die nach wie vor an seinem Herzen ruhte und war dabei so vorsichtig, als umfinge er einen kleinen Vogel. Plötzlich erinnerte er sich daran, weshalb er überhaupt gekommen war. Der Anwalt! Angesichts der jüngsten Ereignisse hatte er den Mann vollkommen vergessen.
Beaufort fasste unter Dorothys Kinn und hob es an, damit er ihr in die Augen schauen konnte. Sie waren vom vielen Weinen geschwollen und gerötet, doch sie erwiderte seinen Blick. Eindringlich musterte er sie und überlegte, den Termin mit dem Anwalt zu verschieben. Allerdings würde dies unliebsame Fragen nach sich ziehen und seinen Zeitplan erneut durcheinander bringen. Nein, wenn sie sich das Gesicht gewaschen hatte, würde sie wieder präsentabel sein.
„Du musst jetzt tapfer sein und mit mir kommen. Der Nachlassverwalter deines Vaters ist hier und möchte dich sehen.“
Verständnislos suchte sie in seinen Augen nach einer Erklärung.
„Der Anwalt deines Vaters ist hier“, versuchte es Beaufort noch einmal zu erläutern. „Er verwaltet das Erbe. Du weißt, dass das Vermögen auf mich übergeht.“
Dorothy blinzelte, als hätte sie sich darüber noch niemals Gedanken gemacht.
„Einerlei. Glaubst du, du kannst mit mir kommen? Nicht lange. Wie gesagt, er will nur einen Blick auf dich werfen und sich davon überzeugen, dass es dir gutgeht.“
Sie nickte schwach und als er sie von seinem Schoß schob und sie zitternd vor ihm stand, fürchtete er, dass man schon sehr blind sein musste, um nicht zu bemerken, wie schlecht es ihr ging. Trotzdem würde er es riskieren und darauf hoffen, dass der Anwalt über ihren desolaten Zustand hinwegsah. Mit einem Seufzen erhob er sich, zog ein frisches Taschentuch hervor und tränkte dieses mit Wasser. Dann tupfte er wie am vergangenen Tag, das Blut von ihren Mundwinkeln. Als er nach ihrer Hand griff, um sie mit sich zu ziehen, zuckte sie zusammen und er lenkte seine Aufmerksamkeit auf ihre Finger. Erst jetzt erkannte er, dass diese ein wenig geschwollen und leicht gerötet waren. Sofort wusste er, was das zu bedeuten hatte und er fluchte. Wie hatte er sie nur in die Obhut dieses Monsters geben können? Es fiel ihm schwer zu glauben, dass er ihr gegenüber so blind gewesen war.
Um ihr keine weiteren Schmerzen zu bereiten, umfasste er sie mit einer Hand vorsichtig am Oberarm und führte sie ins Arbeitszimmer.