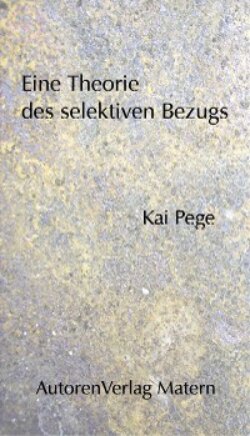Оглавление
Kai Pege. Eine Theorie des selektiven Bezugs
Eine Theorie des selektiven Bezugs
Einleitung
(1.1) Zeichen, Symbole und Worte
(1.2) Wie voneinander abgrenzen?
(1.3) Definite Beschreibungen und Bezüge
(1.4) Über-etwas-sprechen
(1.5) Wirklichkeit und sprachliche Angemessenheit
(2.1) Sprachlicher Bezug und Wahrheit
(2.2) Umgangssprache und Angemessenheit
(2.3) Bedeutungen von Worten. I
II
III
(2.4) Bedeutungen und Bezüge. I
II
III
(2.5) Bedeutungen gestalten. I
II
III
(2.6) Bezüge und Verhalten. I
II
III
(2.7) Und Synonomie?
(2.8) Selektiver Bezug
(2.9) Ausdruck und Bezüge *
Literatur
Inhalt
Отрывок из книги
Der Text dieses Buches beschäftigt sich mit nur einem Thema: mit sprachlichen Bezügen. Der Kontext ist ein sprachphilosophischer, der primär analytisch ausgerichtet ist, gleichwohl entfalte ich eine umfangreiche Kritik, sowohl an analytischen Erörterungen als auch an umgangssprachlichem Verhalten. Es sind nur zwei Kapitel zu finden: Zunächst wird eine Abgrenzung der Sprache von Zeichen, Symbolen und Namen vorgenommen, denen es an einer Bezugsrelevanz fehlt, um mir überhaupt einen Zugang auf Sprache zu ermöglichen. Im zweiten, umfangreicheren Kapitel, steht eine unüberbrückbare Differenz von Sprachlichem und Nicht-Sprachlichem im Zentrum, die fraglich werden lassen kann, was denn Bezüge seien.
Analytische Erörterungen führten häufig zu Stellvertreterfunktionen von Zeichen innerhalb naturwissenschaftlicher Modelle. Was dies mit Sprache zu tun hat, diese Frage wurde leider unterschlagen. Modelle lassen sich durchaus mit der Wirklichkeit vergleichen, doch liegt dabei kein Bezug vor, sondern möglicherweise eine eineindeutige Abbildung, deren Relevanz freilich davon abhängig ist, was berücksichtigt wurde. Und eine Stellvertreterfunktion von Zeichen würde eine Austauschbarkeit bzw. Ersetzbarkeit voraussetzen, die nicht möglich ist. Kein Zeichen könnte die relevante Wirklichkeit ersetzen. Es bliebe nicht mehr als eine unangemessene Metapher, naturwissenschaftliche Prosa, die staunen lassen könnte.
.....
Zu solchen Fällen könnten gesellschaftlich bedingte Namenswechsel gehören: Übernimmt ein Ehepartner bei der Heirat den Namen des anderen, wie dies bei Frauen lange Zeit üblich war, würde sich die Frage nach einem ‚regiden Designator‘ kaum stellen, der über Zeiten und Welten gleich bliebe, es sei denn in satirischer Weise. Vorkommnisse können sogar noch vielfältiger ausfallen, wenn nicht nur zu verschiedene Lebensabschnitten eines Menschen verschiedene Eigennamen treten, sondern auch verschiedene Funktionen einen solchen Eigennamen erhalten. Pseudonyme werden in der Regel in dieser Weise gebraucht, ob unter Schriftstellern, Musikern oder … Die umgangssprachliche Phrase ‚Pseudo-‘ deutet eine gesellschaftlich ideologische Abhängigkeit in Bezug auf Namen an, die primär eine praktisch orientierte ist, in der es um eine, umgangssprachlich formuliert, Identifizierbarkeit von Menschen geht, was immer auch amtlich oder auf der Straße darunter konkret verstanden wird.
Eine Konzentration auf bekannte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens hilft nicht weiter, wenn es darum geht, Namen und ihre Verwendung zu erläutern, weil der Bezugsrahmen viel zu klein wäre. Ohne die gesellschaftlichen Vorgänge zu berücksichtigen, die alltäglich sind, blieben die Ansätze eventuell hübsch und nett, doch vor allem unrelevant.
.....