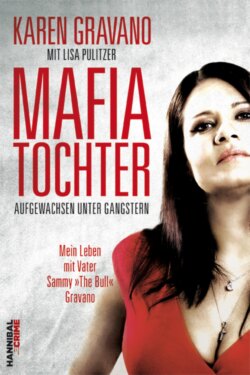Читать книгу Mafiatochter - Aufgewachsen unter Gangstern - Karen Gravano - Страница 7
ОглавлениеGerard und ich waren die anderen Errungenschaften, auf die Papa stolz war. Ich erinnere mich noch daran, wie Gerard geboren wurde. Ich war drei Jahre alt und völlig aus dem Häuschen darüber, dass er ein Junge war. Ich hatte mir eine Schwester gewünscht, eine kleine Puppe, die ich hübsch anziehen könnte. Von dem Augenblick an, als er aus dem Krankenhaus kam, war ich eifersüchtig auf ihn. Ich war das erste und einzige Kind gewesen, und nicht nur das: Ich war auch das erste Enkelkind mütterlicherseits. Nun widmete man Gerard die meiste Aufmerksamkeit. Vom Augenblick seiner Geburt an war er der Augapfel meiner Mutter. Gerard war ihr kleiner Mann. Das war eigentlich nur fair, denn vom Augenblick meiner Geburt an war ich der Augapfel meines Vaters gewesen. Rückblickend kann ich sagen, dass ich unserem Vater sehr ähnlich bin, während Gerard mehr nach unserer Mutter schlägt. Mama und Gerard sind beide stille, harmoniebedürftige und freundliche Menschen. Papa und ich wiederum sind hitzköpfig, stur, loyal und leidenschaftlich.
Das erste Mal, dass ich einen kleinen Einblick in Papas nicht ganz so normales Leben bekam, war zu der Zeit von Gerards Geburt. Ich war im Kindergarten, und die Kinder unserer Gruppe sollten an der Haustüre Süßigkeiten verkaufen, um das Geld für einen Ausflug zusammenzubringen. Den besten Verkäufern winkten attraktive Preise. Ich hatte mein Auge auf eine Popcornmaschine geworfen. Die Maschine war einer der größeren Preise, also wusste ich, was ich zu tun hatte. Sobald die Erzieherin die Pakete mit Süßigkeiten verteilt hatte, wollte ich mich an die Arbeit machen und den Nachbarn etwas verkaufen, bevor mir jemand anderes aus der Gruppe zuvorkam. Unglücklicherweise spielte das Wetter nicht mit. Nach dem Kindergarten regnete es zu stark, um nach draußen zu gehen.
Mein Vater sagte, ich solle mir keine Sorgen machen. Er werde so viel Süßigkeiten kaufen, dass ich meine Popcornmaschine bekäme. Ich fand jedoch, dass das Ganze etwas anders gedacht gewesen war. Soweit ich wusste, besagten die Regeln, dass ich mit dem Zeug hausieren gehen musste, und ich wollte nicht schummeln und Schwierigkeiten bekommen.
Da schlug mir Papa ein Geschäft vor. Er wollte die Süßigkeiten in den Nachtclub mitnehmen, den er besaß, und sie an die Jungs verkaufen, die dort arbeiteten. Somit würde ich meine Waren an viele verschiedene Leute verkaufen, selbst wenn ich, technisch gesehen, nicht die ganze Nachbarschaft an der Haustüre abklapperte. Der Plan gefiel mir, und wir besiegelten die Vereinbarung mit einem Handschlag.
Als ich am nächsten Morgen erwachte, platzte mein Sammelumschlag vor lauter Geld aus allen Nähten. Das Blatt, auf dem ich die Namen meiner Kunden festhalten sollte, war mit seltsamen Namen wie Sally Dogs und Big Louie ausgefüllt. Keiner dieser Namen hatte einen Adresszusatz wie auf den Blättern meiner Spielkameraden. Zweifellos hatte ich jedoch genug Süßigkeiten verkauft, um die Popcornmaschine zu bekommen. Ich blickte auf einen Stapel Geld, hunderte von Dollar.
Stolz brachte ich meiner Erzieherin das Bestellformular und das Geld. Sie war über meinen Erfolg gar nicht erfreut, sondern bestellte sofort meine Mutter in den Kindergarten, um die Sache zu besprechen. Sie war sich sicher, dass ich die Liste erfunden und das Geld von jemandem im Haus genommen hätte, um die Popcornmaschine zu ergattern. Immer wieder beteuerte ich, dass die Liste echt sei. Ich wusste, dass mich mein Vater niemals in Schwierigkeiten bringen würde.
Als meine Mutter im Kindergarten eintraf, versicherte sie meiner Erzieherin, dass alle meine Kunden echte Menschen seien und ich mich für die Sache sehr engagiert hätte. Ich bekam meine Popcornmaschine und hatte noch genügend Punkte für ein paar weitere Preise übrig, ich beließ es aber bei der Popcornmaschine, weil ich mir sonst gierig vorgekommen wäre. Es war ohnehin der einzige Preis, den ich haben wollte.
Ich lebte sehr gerne in Brooklyn. In der Nachbarschaft wohnten viele Verwandte, und Gerard und mir wurde es nie langweilig. Besonders gerne gingen wir zum Spielplatz im Gravesend Park, wo wir stundenlang schaukelten oder auf Plastiktieren wippten. An einem guten Tag bekamen wir ein Eis, wenn der Mann von Good Humor vorbeikam.
Besonders deutlich erinnere ich mich an einen Sonntagsausflug zum Ententeich. Mein Vater und meine Mutter gingen mit meinen älteren Kusinen und uns zum Entenfüttern. Wir hatten jeder zwei Scheiben altes Brot dabei, das wir nach eigenem Gutdünken zerbrechen und in den Teich werfen durften. Meine Kusine Mary hielt ihre Rinde zu lange fest, sodass eine Ente sie in den Finger biss. Mein Vater jagte sie den Weg entlang und schnappte sie, bevor sie ins Wasser entwischen konnte. Was dann geschah, traumatisierte uns: Die Ente quakte, die Kinder schrieen, und die Federn flogen, als mein Vater dem Vogel den Hals brach. Mein Vater schützte instinktiv die Menschen, die er liebte. Er hielt es für seine Pflicht, uns zu beschützen, selbst wenn er dabei die Grenzen des Notwendigen bisweilen überschritt.
Meine Mutter war sehr fürsorglich. Wenn ich ihr eine Frage stellte, hatte sie eine gewisse Art, mir zu antworten, ohne zu antworten. Nie gab sie eine befriedigende Antwort, sodass ich mir alles, was sie mir nicht sagte, selbst zusammenreimen musste. Wahrscheinlich hatte ich meistens Unrecht, aber ich konnte nicht anders, als sie weiterhin mit Fragen zu belästigen.
Sie war sehr bodenständig und einfach. Statt ein Restaurant zu besuchen, kochte sie lieber selbst zu Hause. Sie wusste, wie man mit sehr geringen Mitteln ein gutes Abendessen zauberte, und konnte improvisieren. Selbst, als wir pleite waren, hatte es stets den Anschein, als hätten wir reichlich zu essen. Sie konnte aus Makkaroni und Ricotta fünf verschiedene Gerichte zubereiten, indem sie beispielsweise Erbsen oder etwas geschnittenes Hühnchenfleisch hinzufügte. Ihr ofenfrisches Knoblauchbrot schmeckte mir am besten.
In unserem Haus gab es feste Regeln fürs Abendessen. Der Tisch wurde in einer Essecke gedeckt, und Papa saß immer am Kopfende. Ich saß zu seiner Rechten, Gerard auf der Bank gegenüber von mir und Mama am anderen Ende. Jeden Abend ließ uns Papa erzählen, was wir in den letzten vierundzwanzig Stunden Neues entdeckt hatten. Wenn wir fertig waren, sagte er: »Seht ihr? Man kann jeden Tag etwas Neues lernen.« Er war stolz, dass es immer etwas zu lernen gab.
Meine Mutter war keine Frau vieler Worte. Wenn etwas nicht in Ordnung war, insbesondere mit meinem Vater, achtete sie stets darauf, dass mein Bruder und ich nichts davon mitbekamen. Sie behütete uns mit demselben Beschützerinstinkt wie er, nur dass sich dieser bei ihr in einer etwas milderen Form äußerte. Sie war die Sorte Mutter, die unsere Schulnoten fälschte, damit wir keinen Ärger mit unserem Vater bekamen.
Sie war so still, dass ich annahm, sie sei schwach und unterwürfig – nicht im negativen Sinne, sondern vielmehr im Sinne häuslichen Pflichtgefühls. Keine Fragen zu stellen, war kein Zeichen von Schwäche; vielmehr hatte sie respektiert, dass Familienmitglieder nichts gewannen, wenn sie sie die ganze Zeit nachbohrten. Erst als ich viel älter war, erkannte ich, welche Kraft in ihrem Schweigen lag.
Mein Vater war der große Spaßmacher der Familie. Er neckte immer meine Mutter, was sie außerordentlich gern mochte. Man sah, dass sie ihn über alles auf der Welt liebte. Es schien sie nicht zu stören, dass er die ganze Nacht fort blieb. Wenn Papa spät nach Hause kam, schlief ich solange immer auf seiner Seite des Bettes. Dann trug er mich hinüber in mein eigenes Zimmer, egal, wie spät es war. Mama und er schienen nie darüber zu streiten, wo er so lange blieb, und sie schien für seine unkonventionellen Arbeitszeiten immer Verständnis zu haben. Ich würde nicht sagen, dass sie übertrieben zärtlich miteinander waren. Aber wenn Papa nach Hause kam und auf der Couch lag, legte er den Kopf in den Schoß meiner Mutter, und sie streichelte sein Haar.
Oft wollte ich meine Mutter fragen, womit Papa tatsächlich unseren Lebensunterhalt bestritt, aber ich wusste, dass sie solche Fragen nicht beantworten würde. Sie war der Vogel Strauß der Familie. Wenn Dinge angesprochen wurden, mit denen sie sich nicht befassen wollte, steckte sie einfach den Kopf in den Sand. Dann putzte sie wie besessen das ganze Haus von oben bis unten und fing anschließend noch einmal von vorn an. Wenn wir auf einem Teppich Fußspuren hinterließen, folgte sie uns mit dem Staubsauger in der Hand und vernichtete sämtliche Beweise, dass wir dort gewesen waren.
Manchmal waren sonntagmorgens ein paar Typen bei meinem Papa zu Besuch. Sie brachten Bagels mit und unterhielten sich. Ohne, dass sie dies als störend empfand, saugte Mama um sie herum und schob den Staubsauger sogar unter ihre Beine, während sie miteinander sprachen. Warum konnte sie mit dem Putzen nicht warten, bis sie das Haus verlassen hatten? Vielleicht war das ihre Art, mit seinen zwielichtigen Freunden und seinem schäbigen Leben zurechtzukommen – sie saugte alles weg.