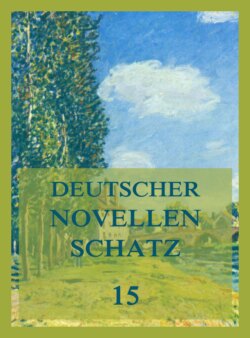Читать книгу Deutscher Novellenschatz 15 - Karl August Varnhagen von Ense - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеReiz und Liebe.
K. A. Varnhagen von Ense.
Vorwort
Karl August Ludwig Philipp Varnhagen, aus der alten Familie von Ense, den 21. Februar 1785 zu Düsseldorf geboren, begleitete seinen Vater, einen angesehenen Arzt, erst nach Straßburg, wo jedoch eine dauernde Niederlassung durch die Revolutionsstürme vereitelt wurde, dann nach Hamburg, wo der Vater bald starb; studierte in Berlin Medizin, Philosophie, Geschichte und Literatur; trat frühzeitig in Verbindung mit den bedeutenderen Geistern der Zeit, vor Allen mit Rahel, welche später seine Gattin wurde; vervollständigte seine Studien in Halle und hierauf in Tübingen, wo er mit den jungen schwäbischen Dichtern, vornehmlich mit Uland, Freundschaft schloss; nahm 1809, um gegen die französische Unterdrückung zu kämpfen, österreichische Dienste und zeichnete sich bei Aspern und Wagram aus, in welch letzterer Schlacht er schwer verwundet wurde; begleitete 1810 seinen Regimentschef, Reichsgrafen von Bentheim, nach Paris; 1813 trat er, der deutschen Erhebung zuvorkommend, in russische Dienste; 1814 folgte er dem Staatskanzler Fürsten Hardenberg zum Kongress nach Wien, 1815 nach Paris; 1816 wurde er preußischer Ministerresident in Karlsruhe, sollte aber 1819, wegen liberaler Färbung anrüchig, den gleichen Posten in Nordamerika beziehen, worauf er seine Entlassung nahm, sich in Berlin niederließ und bis zu seinem am 10. Oktober 1858 unerwartet rasch erfolgten Tode die lebhafteste literarische Tätigkeit entwickelte. Diese Tätigkeit gehört längst der Geschichte an, und sie auch nur nach den hauptsächlichsten Seiten hin zu besprechen, würde hier ebenso überflüssig, als im engen Raume unmöglich sein. Varnhagens Verdienst, die künstlerische Form von der Dichtung auf geschichtliche Aufgaben übertragen und für die Behandlung der Geschichtserzählung, der Biographie, des Memoirengenres ein in unserer Epigonenliteratur weithin nachwirkendes Beispiel gegeben zu haben, wird selbst von Widerwilligen anerkannt; und die Gesinnung, die warm unter den glatten Formen lebt, die vaterländische, freisinnige, humane Richtung, die ihm erst gegen sein Lebensende durch die kläglichen Zustände jener Zeit versäuert werden konnte, wird ihm trotz des über seinem Grabe ausgebrochenen Streites auf die Länge unbestritten bleiben. Bedeutsam auf die Summe seines Wirkens weisen die Worte Goethes hin: „Ich zähle ihn zu Denjenigen, die zunächst unsere Nation literarisch in sich selbst zu einigen das Talent und den Willen haben.“ — Obgleich seine novellistischen Arbeiten nicht im Vordergründe seiner Leistungen stehen, darf man doch wohl sagen, dass auch sie in ähnlicher Weise, wie seine geschichtlichen, dem jüngeren Geschlecht zu Gute gekommen sind: die Goethe'sche Sprache, die, nicht bloß Nachahmung, ihm häufig wie zur anderen Natur geworden ist, hat als ein Vorbild dessen fortgewirkt, was der Formbildner bei entschiedenem Willen sich zumuten darf, und hat Manchem, der ohne dieses Vorbild vor höheren Anforderungen zurückgewichen wäre, Mut und Kraft beflügelt. Besondern Erfolg hatten die „Sterner und Psitticher“, jene Erzählung, worin der Dichter die Ausgabe, ein Geschichtsbild aus dem Mittelalter zu zeichnen, mit nacheiferungswürdig frischem Entschlüsse in Angriff nahm. Die hier ausgewählte Erzählung (so, nicht Novelle, hat er selbst sie genannt) dürfte allerdings den Vorwurf auf sich laden, dass über den Charakter der Heldin anfangs nicht bloß der Held, sondern auch der Leser etwas zu sehr sich täuschen müsse: doch ist jedenfalls die Entwicklung, wie die Tünche einer scheinbaren Bildung allmählich abfällt, sehr gut zur Anschauung gebracht; und die Form, obwohl mitunter etwas gefährlich zugespitzt, zeigt im Ganzen eine Meisterschaft, welche nicht bloß vor sechzig Jahren (die Entstehungszeit ist 1812) für Wenige erreichbar war, sondern heute noch gegenüber der mehr und mehr einreißenden Verwilderung aller Anerkennung wert erscheint.
***