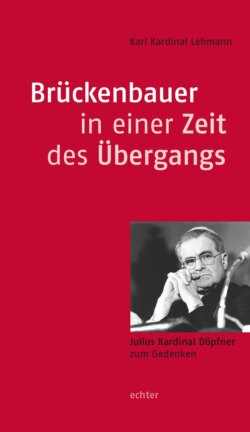Читать книгу Brückenbauer in einer Zeit des Übergangs - Karl Gotthelf Lehmann - Страница 6
I. Die Heimat
ОглавлениеJulius Kardinal Döpfner hing sehr an seiner unterfränkischen Heimat am Südrand der Rhön. Es fiel ihm immer schwer, von ihr getrennt zu sein. Er wollte nichts anderes als hier Pfarrer werden. Heute ist der Geburtsort Hausen ein Stadtteil von Bad Kissingen. Jetzt gedenkt seine Heimat des berühmten Sohnes und dankt ihm, dass er trotz seiner großen Anhänglichkeit an seine Heimat in die Fremde gegangen ist und so für unser Land sowie die Weltkirche viel erwirken konnte. Davon muss die Rede sein.1
Julius August Döpfner wurde am 26. August 1913 in dem kleinen Dorf Hausen als viertes von fünf Kindern geboren. Ein älterer Bruder mit dem Namen Julius ist bald nach der Geburt verstorben. So erhielt ein späterer Junge, wie es oft Brauch war, den Namen des Bruders. Es war eine harte Zeit. Krankheit, Krieg und Hungersnot bedrückten die Familie. Es war eine bitterböse Zeit für alle. Der Vater Matthäus Julius, Hausdiener in einem Hotel im Kurort Bad Kissingen, starb schon 1923 im Alter von 47 Jahren an den Folgen eines Kriegsleidens. Die von Julius stets verehrte Mutter Maria – sie war Putzfrau – starb im Jahr 1934. 1924 begann Julius Döpfner zuerst am Gymnasium der Augustiner in Männerstadt seine Gymnasialstudien, die er – nun im Bischöflichen Knabenseminar Kilianeum – ab 1925 am Neuen Gymnasium in Würzburg fortsetzte und dort 1933 mit dem besten Abitur seines Jahrgangs zum Abschluss brachte. Als das nationalsozialistische Regime aufgebaut wurde, begann Döpfner nach kurzem Anfang an der Würzburger Universität im Herbst 1933 das Studium der Philosophie und Theologie an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom, wobei er Alumne des Päpstlichen Kollegs GermanicumHungaricum wurde.
Der Gedanke, Priester zu werden, reifte schon sehr früh. Er wurde in den oberen Klassen des Gymnasiums gestärkt durch die Auseinandersetzung mit den Fragen des Lebens aus der Sicht des Glaubens und mit der Geschichte. Entscheidende Anziehung war jedoch die Pfarrseelsorge mit einem sehr tüchtigen Seelsorger. „Ich habe als Kind erlebt, was die Kirche für den Menschen bedeutet, und zumal in den Krankheitstagen (des Vaters) gesehen, was ein eifriger, aus seiner Sendung heraus wirkender Priester dem Menschen geben kann.“ Die starke Mutter hinterließ mit ihrer ganz unsentimentalen, aber tief vertrauenden Frömmigkeit einen sehr starken Eindruck. Noch wenige Wochen vor Döpfners Tod sah er in einem Rundfunkgespräch Zusammenhänge zwischen der zweiten Station eines Kreuzwegs, der an seinem Elternhaus vorbei auf den Dorffriedhof führte, und der späteren Entscheidung für sein bischöfliches Leitwort „Wir predigen den Gekreuzigten“ (1 Kor 1,22). Es war auch der Primizspruch des späteren Wiener Kardinals Franz König, der auf den jüngeren Döpfner Eindruck machte. Döpfner bekannte sich gerne zu seiner Herkunft aus bescheidenen Verhältnissen seiner fränkischen Heimat, die er immer mehr liebte. Er behielt einen sehr anspruchslosen, keine Belastung scheuenden Lebensstil bei. Er konnte mit einfachen Menschen ebenso umgehen wie mit hochgestellten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und bewegte sich in der kleinsten Gemeinde ebenso ungezwungen und frei wie auf dem internationalen Parkett.
1 Vgl. besonders K. Forster, Julius Kardinal Döpfner (1913–1976), in: Ders., Glaube und Kirche im Dialog mit der Welt von heute I, Würzburg 1982, 663–683, auch in: J. Aretz, R. Morey, A. Rauscher (Hg.), Zeitgeschichte in Lebensbilder, Band 3, Mainz 1979, 260–279. K. Forsters Beitrag verdanke ich viele Anregungen. Dies gilt auch für die zahlreichen Veröffentlichungen von K. Wittstadt, vor allem: Julius Kardinal Döpfner und das Zweite Vatikanische Konzil. Zum zehnten Jahrestag seines Todes am 24. Juli 1986, Würzburg o. J. (1986); Julius Kardinal Döpfner 1913–1976, Würzburg 1996; Julius Kardinal Döpfner. Anwalt Gottes und der Menschen, München 2001. Vgl. als kurzen Überblick S. Mockry, Döpfner, in: M. Quisinsky/P. Walter (Hg.), Personenlexikon zum Zweiten Vatikanischen Konzil, Freiburg i. Br. 2012, 94 f.; vgl. auch A. Landersdorfer, Döpfner, Julius, in: E. Gatz (Hg.), Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 1945–2001, Berlin 2002, 386–394 (Lit.). Zu den Veröffentlichungen J. Döpfners selbst vgl. die Literaturliste im Anhang dieses Textes.
Zahlreiche Beiträge finden sich in den „Würzburger Diözesangeschichtsblättern“ ab dem Jahr 1981; Julius Kardinal Döpfner und das Zweite Vatikanische Konzil, Würzburg 1986; wichtig auch Chr. Hartl, Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten. Spuren der Kreuzesspiritualität J. Kardinal Döpfners in seinem Leben und in seiner Verkündigung, Würzburg 2001. Hinweisen möchte ich noch auf die zahlreichen, aber ziemlich verstreuten Äußerungen des Münchener Regionalbischofs Dr. h. c. Ernst Tewes, die leider nicht in einer gemeinsamen Veröffentlichung zusammengefasst sind und mangels Angaben über Ort und Jahr des Erscheinens nur sehr unvollständig angegeben werden können: In Memoriam Kardinal Julius Döpfner, München o. J.; Zum Gedenken an Julius Kardinal Döpfner, gestorben am 24. Juli 1976, hrsg. von E. Tewes; Erinnerung und Notizen 1954–1994, München o. J. (1995); Sede vacante 82, München o. J. Hinweisen möchte ich auch auf das Heft „Er war ganz und gar Seelsorger. Begegnungen mit Julius Döpfner“ = KIM-Profile 2, Ingolstadt 1989; P.-W. Scheele, Julius Kardinal Döpfner – Gelebtes Konzil, in: Julius Kardinal Döpfner 1996, 127–134.
Generell verweise ich auf die Beiträge in der großen fünfbändigen Geschichte des Zweiten Vatikanischen Konzils, hrsg. von G. Alberigo, Mainz 1977 ff. und auf die zahlreichen Abhandlungen zu diesem Konzil, z. B. F. X. Bischof (Hg.), Das Zweite Vatikanische Konzil 1962–1965. Stand und Perspektiven der kirchenhistorischen Forschung im deutschsprachigem Raum, Stuttgart 2012. Im folgenden Text, der ein Redemanuskript ist und bleiben will, habe ich die zahlreichen Zeugnisse von Julius Kardinal Döpfner selbst in vielen Fällen nicht eigens nachgewiesen. Die Fundorte für diese Texte sind sehr zerstreut. Es wäre wünschenswert, dass die verschiedenen Aussagen Döpfners, die den Charakter von Erinnerungen, kurzen Sentenzen usw. haben, eigens gesammelt und veröffentlicht werden.
Erwähnen möchte ich noch eine nicht gedruckte große Hilfe, die ich seit Jahren besitzen darf. Es gibt eine fast 300–seitige Zusammenstellung der Lebensdaten und Termine Döpfners: Prof. Dr. Helmut Witetschek, Der tabellarische Weg Kardinal Döpfners durch das Bischofsamt und seine Zeit (1948–1976), Typoskript, 292 Seiten.