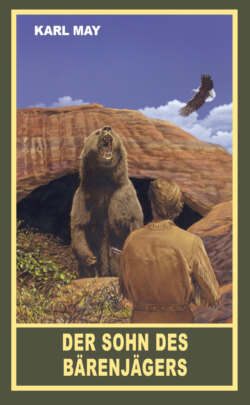Читать книгу Der Sohn des Bärenjägers - Karl May - Страница 5
2. Der Hobble-Frank
ОглавлениеDie beiden Jäger nahmen ihre Gewehre und schlichen sich auf einem Umweg an den Bach. Dort gingen sie das diesseitige Ufer hinab, sprangen über das schmale Wasser und stiegen jenseits wieder hinauf. Nun schlugen sie einen kurzen Bogen und erreichten den Bach gerade an der Stelle, wo sich am anderen Ufer die neun Männer mit dem Gefangenen befanden. Dort taten sie, als ob sie über die Anwesenheit von Menschen mächtig erstaunt seien.
„Hallo“, rief der Dicke Jemmy. „Was ist denn das? Ich habe gemeint, wir wären ganz allein hier auf dieser gesegneten Prärie, und da treffen wir ein ganzes Meeting[5] beisammen. Hoffentlich ist es erlaubt, teilzunehmen?“
Diejenigen, die im Gras hockten, sprangen auf und alle richteten ihre Augen auf die beiden Ankömmlinge. Sie mochten im ersten Augenblick durch deren Erscheinen nicht sehr angenehm überrascht sein. Aber als sie die Gestalten und Anzüge der beiden bemerkten, erhoben sie ein schallendes Gelächter.
„Bounce!“, rief einer, der ein ganzes Lager von Waffen an seinem Leib trug. „Was geht hier los? Haltet ihr zu dieser Jahreszeit Fastnacht und Maskenspiel?“
„Ay!“, nickte der Lange. „Es fehlen uns noch einige Narren dazu, darum kommen wir zu euch.“
„Da kommt ihr freilich an die unrechte Adresse.“
„Das glaube ich nicht.“
Bei diesen Worten machte Davy mit seinen ewig langen Beinen einen einzigen Schritt über das Wasser hinüber, einen zweiten das Ufer hinauf und stand nun vor dem Sprecher. Der Dicke tat zwei Sprünge, nach denen er neben Davy stand und meinte:
„So, da sind wir. Good day, Mesch’schurs. Habt ihr nicht irgendeinen guten Schluck zu trinken?“
„Dort ist Wasser!“, lautete die Antwort des Sprechers, der dabei auf den Bach deutete.
„Fie! Meint Ihr, ich habe Lust, mich inwendig mit Wasser nass zu machen? Das fällt meines Großvaters Enkel nicht ein. Wenn ihr nichts Besseres bei euch habt, so mögt ihr ruhig nach Hause gehen, denn da ist diese hübsche Wiese kein passender Ort für euch!“
„Ihr scheint die Prärie für eine Frühstücksstube zu halten?“
„Freilich! Die Braten laufen einem ja vor der Nase herum. Man braucht sie nur ans Feuer zu bringen.“
„Und Euch scheint das recht gut zu bekommen!“
„Will’s meinen!“, lachte Jemmy, indem er sich behaglich über den Bauch strich.
„Und was ihr zu viel habt, das fehlt Eurem Kameraden da.“
„Weil er nur halbe Beköstigung erhält. Ich darf nicht zugeben, dass seine Schönheit verdorben wird, denn ich habe ihn als Scheuche mitgenommen, damit mir kein Bär oder Indsman zu nahe kommt. Aber, mit Eurer Erlaubnis, Sir – was führt Euch denn eigentlich an dieses hübsche Wasser hier?“
„Niemand hat uns hergeführt. Haben den Weg selbst gefunden.“
Seine Gefährten lachten über diese Antwort, die sie für eine geistreiche Abfertigung hielten. Der Dicke Jemmy aber meinte ernsthaft:
„So? Wirklich? Das hätte ich Euch nicht zugetraut, denn Euer Gesicht lässt nicht vermuten, dass Ihr im Stande seid, irgendeinen Weg ohne Hilfe zu finden.“
„Und das Eurige lässt erwarten, dass ihr den Weg nicht sehen würdet, selbst wenn man Euch mit der Nase darauf drückte. Seit wann seid Ihr denn eigentlich aus der Schule?“
„Ich bin noch gar nicht hineingekommen, weil ich das richtige Maß noch nicht habe, doch hoffe ich, von Euch so viel zu lernen, dass ich wenigstens das Einmaleins des Westen leidlich aufsagen kann. Wollt Ihr mein Schulmeister sein?“
„Habe keine Zeit dazu. Habe überhaupt Notwendigeres zu tun, als anderen die Dummheit auszuklopfen.“
„So! Was sind denn das für notwendige Dinge?“
Jemmy sah sich um, tat, als ob er erst jetzt den Indianer erblickte, und fuhr dann fort: „Behold! Ein Gefangener und noch dazu ein roter!“
Dabei fuhr er zurück, als sei er über den Anblick des Roten erschrocken. Die Männer lachten und derjenige, der bisher gesprochen hatte und ihr Anführer zu sein schien, sagte:
„Fallt nicht in Ohnmacht, Sir! Wer noch keinen solchen Kerl gesehen hat, kann leicht einen gefährlichen Schreck davontragen. Ich wette, dass Euch noch nie ein Indsman begegnet ist.“
„Einige zahme habe ich wohl gesehen. Aber der hier scheint wild zu sein.“
„Gewiss, kommt ihm ja nicht zu nahe!“
„Ist’s so schlimm? Er ist ja gefesselt!“
Der Dicke wollte sich dem Gefangenen nähern, aber der Anführer stellte sich ihm entgegen:
„Bleibt weg von dem Indsman! Er geht Euch gar nichts an. Übrigens muss ich Euch nun endlich fragen, wer Ihr seid und was Ihr hier bei uns wollt.“
„Das könnt Ihr sofort erfahren. Mein Kamerad heißt Kroners und mein Name ist Pfefferkorn. Wir...“
„Pfefferkorn?“, wurde er unterbrochen. „Ist das nicht ein deutscher Name?“
„Mit Eurer Erlaubnis, ja.“
„So hole Euch der Teufel! Ich kann Leute Eures Gelichters nicht riechen.“
„Das liegt jedenfalls nur an Eurer Nase, die an Feineres nicht gewöhnt ist. Und wenn Ihr von Gelichter sprecht, so messt Ihr mich wohl mit Eurer eigenen Elle.“
Jemmy hatte das nicht mehr in dem bisherigen leichten Ton gesprochen. Der andere zog die Brauen zornig hoch und fragte drohend: „ Was wollt Ihr damit sagen?“
„Die Wahrheit, weiter nichts.“
„Wofür haltet Ihr uns? Heraus damit!“
Der Mann griff zum Messer, das er im Gürtel stecken hatte. Jemmy machte eine verächtliche Handbewegung. „Lasst Euer Messer stecken, Sir! Damit schreckt Ihr uns nicht. Ihr seid grob gegen mich gewesen und durftet nicht erwarten, dass ich Euch mit Kölnisch Wasser anspritze. Ich kann nichts dafür, dass ich Euch nicht gefalle, und es kommt mir auch gar nicht in den Sinn, Euch zuliebe im fernen Westen einen Frack und Handschuhe anzuziehen. Hier gilt nicht der Rock, sondern der Mann! Ich habe Eure Frage beantwortet und will nun auch erfahren, wer ihr seid.“
Die Leute machten große Augen, als der Dicke in einem solchen Ton zu ihnen sprach. Zwar griffen noch einige Hände in die Gürtel, aber das mannhafte Auftreten des dicken Männchens hatte doch zur Folge, dass der Anführer Bescheid gab: „Ich heiße Brake, das genügt. Die acht anderen Namen könntet Ihr Euch doch nicht merken.“
„Merken gar wohl. Aber wenn Ihr meint, dass ich sie nicht zu wissen brauche, so habt Ihr Recht. Der Eurige genügt vollauf, denn wer Euch ansieht, der weiß auch schon, wes Geistes Kind die anderen sind.“
„Mann! Ist das eine Beleidigung?“, fuhr Brake auf. „Wollt Ihr, dass wir zu den Waffen greifen?“
„Das rate ich euch nicht. Wir haben vierundzwanzig Revolverschüsse und wenigstens die Hälfte würdet ihr bekommen, ehe es euch gelänge, eure Schießhölzer auf uns zu richten. Ihr haltet uns für Neulinge, aber die sind wir nicht. Wollt ihr es auf eine Probe ankommen lassen, so haben wir nichts dagegen.“
Jemmy hatte blitzschnell seine beiden Revolver gezogen. Auch der Lange Davy hielt die seinigen bereits in den Händen, und als Brake sein Gewehr vom Boden aufheben wollte, warnte Jemmy: „Lasst das Gewehr liegen! Sobald Ihr es berührt, habt Ihr meine Kugel. Das ist das Gesetz der Prärie. Wer zuerst losdrückt, hat das Recht und ist der Sieger!“
Die Leute waren beim Erscheinen der beiden so unvorsichtig gewesen, ihre Gewehre im Gras liegen zu lassen. Jetzt durften sie es nicht wagen, danach zu greifen.
„’s death!“, fluchte Brake. „Ihr tut ja ganz so, als wolltet ihr uns alle verschlingen!“
„Das fällt uns nicht ein, dazu seid ihr uns nicht appetitlich genug. Wir wollen von euch weiter nichts wissen, als was euch dieser Indianer getan hat.“
„Geht das euch etwas an?“
„Ja. Wenn ihr euch ohne Grund an ihm vergreift, so befindet sich dann jeder andere Weiße ohne Schuld in der Gefahr, von der Rache der Seinigen getroffen zu werden. Also, warum habt ihr ihn gefangen genommen?“
„Weil es uns so gefiel. Er ist ein roter Schurke, das ist Grund genug.“
„Diese Antwort genügt. Wir wissen nun, dass euch der Mann keinen Anlass zu Feindseligkeit gegeben hat. Aber ich werde ihn auch selbst noch fragen.“
„Den fragen?“, lachte Brake höhnisch und seine Gefährten stimmten in das Gelächter ein. „Der versteht kein Wort Englisch. Er hat uns trotz aller Prügel mit keiner Silbe geantwortet.“
„Geprügelt habt ihr ihn?“, rief Jemmy. „Seid ihr von Sinnen? Einen Indianer prügeln! Wisst ihr nicht, dass dies eine Beleidigung ist, die nur mit Blut gesühnt werden kann?“
„Er mag sich unser Blut holen. Bin nur neugierig, wie er das anfangen wird.“
„Sobald er frei ist, wird er es euch zeigen.“
„Frei wird er niemals wieder sein.“
„Wollt ihr ihn töten?“
„Was wir mit ihm tun werden, das geht euch nichts an, verstanden? Die Rothäute muss man zertreten, wo man sie nur immer findet. Jetzt habt ihr unseren Bescheid. Wollt ihr, bevor ihr euch von dannen macht, mit dem Kerl einmal sprechen, so habe ich nichts dagegen. Er versteht euch nicht und ihr seht beide nicht so aus, als ob man euch für Professoren der Indianersprache halten müsse. Ich bin neugierig, der Unterhaltung beizuwohnen.“
Jemmy zuckte verächtlich die Schultern und wendete sich an den Indianer.
Der Rote hatte mit halb geschlossenen Augen dagelegen und mit keinem Blick, keiner Miene verraten, ob er dem Gespräch zu folgen vermochte. Er war noch jung, ganz so, wie der Dicke gesagt hatte, vielleicht achtzehn Jahre alt.
Sein dunkles, schlichtes Haar war lang. Nichts zeigte an, zu welchem Stamm er gehörte. Das Gesicht war unbemalt und sogar die Scheitellinie seines Kopfes war nicht mit Ocker oder Zinnober gefärbt. Er trug ein weichledernes Jagdhemd und hirschlederne Leggins, beide an den Nähten ausgefranst. Zwischen diesen Fransen war kein einziges Menschenhaar zu sehen, ein Zeichen, dass der junge Mann noch keinen Feind getötet hatte. Die zierlichen Mokassins waren mit Stachelschweinsborsten geschmückt, wie es Jemmy vorher vermutet hatte. Drüben am jenseitigen Ufer, wo sich das Pferd jetzt wieder aufgerichtet hatte und mit Wohlbehagen das Wasser des Baches zu schlürfen begann, lag ein langes Jagdmesser. Am Sattel des Tieres hing ein aus den Hörnern des Bergschafes verfertigter Bogen, der vielleicht den Wert von zwei oder drei Mustangs besaß. Diese einfache Bewaffnung war ein sicherer Beweis, dass der Indianer nicht in feindlicher Absicht in diese Gegend gekommen war.
Sein Gesicht war in diesem Augenblick gänzlich regungslos. Der Indsman ist zu stolz, vor Fremden oder gar Feinden seine Gefühle merken zu lassen. Seine Züge waren noch jugendlich weich. Die Backenknochen traten zwar ein klein wenig hervor, doch tat dies der Ebenmäßigkeit nicht den mindesten Eintrag. Als Jemmy jetzt zu ihm trat, öffnete er zum ersten Mal die Augen ganz. Sie waren schwarz wie glänzende Kohle und ein freundlicher Blick traf den Jäger.
„Mein junger, roter Bruder versteht die Sprache der Bleichgesichter?“, fragte Jemmy in englischer Sprache.
„Ja“, erwiderte der Gefragte. „Woher weiß dies mein älterer weißer Bruder?“
„Ich sehe an dem Blick deines Auges, dass du uns verstanden hast.“
„Ich habe gehört, dass du ein Freund der roten Männer bist. Ich bin dein Bruder.“
„Will mir mein Bruder sagen, ob er einen Namen hat?“
Eine solche Frage ist für einen älteren Indianer eine schwere Beleidigung, denn wer noch keinen Namen hat, der hat noch nicht durch irgendeine Tat seinen Mut bewiesen und wird nicht zu den Kriegern gerechnet. Bei der Jugend dieses Gefangenen aber konnte sich Jemmy die Frage erlauben. Dennoch entgegnete der Jüngling: „Meint mein guter Bruder, dass ich feige bin?“
„Nein, aber noch sehr jung.“
„Die Bleichgesichter haben die roten Männer gelehrt, bereits jung zu sterben. Mein Bruder mag mir das Jagdhemd auf der Brust öffnen, um zu erfahren, dass ich einen Namen besitze.“
Jemmy bückte sich und nestelte das Jagdhemd auf. Er zog drei rot gefärbte Federn des Kriegsadlers hervor. „Ist’s möglich?“, rief er aus. „Ein Häuptling kannst du doch noch nicht sein!“
„Nein“, lächelte der Jüngling. „Ich darf die Federn des Mah-sisch tragen, weil ich Wohkadeh heiße.“
Diese beiden Worte gehören der Mandan-Sprache an. Das erste heißt Kriegsadler und das zweite ist der Name für die Haut eines weißen Büffels. Da die weißen Büffel höchst selten sind, so gilt das Erlegen eines solchen Tieres bei manchen Stämmen mehr als der Sieg über mehrere Feinde und berechtigt sogar zum Tragen der Federn des Kriegsadlers. Der junge Indianer hatte einen solchen Büffel erlegt und infolgedessen den Namen Wohkadeh erhalten.
Das war an und für sich nichts Seltsames, nur staunten Davy und Jemmy darüber, dass der Name der Mandan-Sprache entnommen war. Die Mandans gelten für ausgestorben. Darum fragte der Kleine: „Welchem Stamm gehört mein roter Bruder an?“
„Ich bin ein Numangkake und zugleich ein Dakota.“
Numangkake nannten sich die Mandans selbst und Dakota ist der Sammelname aller Siouxstämme.
„So bist du von den Dakota angenommen worden?“
„Wie mein weißer Bruder sagt, so ist es. Der Bruder meiner Mutter war der große Häuptling Mah-to-toh-pah[6]. Er trug diesen Namen, weil er vier Bären auf einmal getötet hatte. Die weißen Männer kamen und brachten uns die Blattern. Mein ganzer Stamm siechte dahin, bis auf wenige, die den Vorangegangenen nach den ewigen Jagdgründen folgten, als sie die Sioux reizten und von ihnen erschlagen wurden. Mein Vater, der tapfere Wah-kih[7], wurde nur verwundet und später gezwungen, ein Sohn der Sioux zu werden. So bin ich ein Dakota, doch mein Herz gedenkt der Ahnen, die der Große Geist zu sich gerufen hat.“
„Die Sioux befinden sich jetzt jenseits der Berge. Weshalb kommst du herüber?“
„Wohkadeh kommt nicht von den Bergen, die mein Bruder meint, sondern vom hohen Gebirge im Westen herab und hat einem kleinen weißen Bruder eine wichtige Botschaft zu bringen.“
„Dieser weiße Bruder wohnt hier in der Nähe?“
„Ja. Woher weiß das mein älterer weißer Bruder?“
„Ich folgte deiner Spur und habe gesehen, dass du dein Pferd antriebst wie einer, der sich nahe am Ziel befindet.“
„Du hast richtig gedacht. Wohkadeh wäre jetzt am Ziel, aber diese Bleichgesichter verfolgten ihn. Sein Pferd war zu ermattet und konnte den Sprung über dieses Wasser nicht tun, es stürzte. Wohkadeh kam darunter zu liegen und verlor die Besinnung. Als er erwachte, war er mit Riemen gebunden.“ Und in der Siouxsprache fügte er knirschend hinzu: „Sie sind Feiglinge! Neun Männer fesseln einen Knaben, dessen Seele von ihm gewichen war! Hätte ich mit ihnen kämpfen können, so gehörten jetzt ihre Skalpe mir.“
„Sie haben dich sogar geschlagen?“
„Sprich nicht davon, denn dieses Wort riecht nach Blut! Mein weißer Bruder wird mir die Fesseln abnehmen und dann wird Wohkadeh als Mann an ihnen handeln.“
Er sagte das mit solcher Zuversicht, dass der Dicke Jemmy lächelnd fragte. „Hast du nicht gehört, dass ich ihnen nichts zu befehlen habe?“
„Oh, mein weißer Bruder fürchtet sich vor hundert solchen Männern nicht. Ein jeder von ihnen ist Wingkan[8].“
„Meinst du? Woher willst du wissen, dass ich mich vor ihnen nicht fürchte?“
„Wohkadeh hat offene Augen und Ohren. Er hörte oft von den beiden berühmten weißen Kriegern sprechen, die Davy-honskeh und Jemmy-petahtscheh[9] genannt werden, und hat sie an ihren Gestalten und Worten erkannt.“
Der kleine Jäger wollte antworten, wurde aber von Brake unterbrochen. „Halt, Mann! So haben wir nicht gewettet! Ich habe Euch zwar erlaubt, mit dem Kerl zu reden; aber das muss in englischer Sprache geschehen. Euer Kauderwelsch kann ich nicht dulden, denn ich muss da gewärtig sein, dass ihr miteinander gegen uns Pläne schmiedet. Übrigens genügt es uns, erfahren zu haben, dass der Indsman des Englischen mächtig ist. Wir brauchen euch nicht mehr und ihr könnt dahin gehen, woher ihr gekommen seid. Und wenn das nicht schnell geschieht, so werde ich euch Beine machen.“
Jemmys Blick flog zu Davy hinüber und der gab ihm mit einer Wimper einen verstohlenen Wink, den niemand bemerkte. Für den Dicken aber war dieses blitzschnelle Zucken des Augenlides verständlich. Der Lange hatte ihn auf die Büsche aufmerksam gemacht, die seitwärts von ihm standen. Jemmy richtete einen kurzen, aber scharf forschenden Blick hinüber und bemerkte, dass nahe am Boden die Läufe zweier Doppelgewehre ein wenig zwischen den Zweigen hervorragten. Dort lagen also zwei Männer im Anschlag. Wer waren sie? Freunde oder Feinde? Die Sorglosigkeit, die Davy zeigte, beruhigte ihn. Er antwortete Brake:
„Die Beine, die Ihr mir machen wollt, möchte ich wohl sehen! Ich habe keine solche Veranlassung zum schnellen Davonlaufen wie ihr.“
„Wie wir? Wem sollten wir davonlaufen?“
„Demjenigen, dem gestern noch diese beiden Pferde gehört haben. Verstanden?“ Jemmy deutete bei diesen Worten auf zwei braune Wallache, die eng nebeneinander standen, als ob sie wüssten, dass sie zusammengehörten.
„Was?“, rief Brake. „Wofür haltet Ihr uns? Wir sind ehrliche Prospectors[10], die hinüber nach Idaho wollen, wo jetzt neue Goldlager entdeckt worden sind.“
„Und weil es euch zu dieser Reise an den nötigen Pferden mangelt, seid ihr nebenbei auch ebenso ehrliche Horse-pilfers[11]. Uns täuscht ihr nicht.“
„Mann, sag noch ein solches Wort, so schieße ich dich nieder! Wir haben alle diese Pferde gekauft und bezahlt.“
„Wo denn, mein ehrlicher Mister Brake?“
„Bereits unten in Omaha.“
„So! Und da habt ihr euch dort wohl auch einen Vorrat von Hufschwärze mitgenommen? Warum sind denn die beiden Braunen so frisch wie aus der Fenz heraus? Warum haben sie geschwärzte Hufe, während eure anderen Gäule abgetrieben sind und in verwahrlosten Pantoffeln laufen? Ich sage euch, dass die Braunen noch gestern einen anderen Herrn gehabt haben und dass der Diebstahl von Pferden hier im Westen mit dem schönen Tod durch den Strang bestraft wird.“
„Lügner! Verleumder!“, brüllte Brake, sich nach seinem Gewehr bückend.
„Nein, er hat Recht!“, ertönte da eine Stimme zwischen den Büschen hervor. „Ihr seid elende Pferdediebe und sollt euren Lohn haben. Schießen wir sie nieder, Martin!“
„Nicht schießen!“, rief der Lange Davy. „Nehmt die Kolben! Eine Kugel sind sie nicht wert.“
Er holte mit dem umgekehrten Gewehr aus und versetzte Brake einen Hieb, dass er besinnungslos zu Boden stürzte. Aus den Büschen sprangen zwei Gestalten hervor, ein kräftiger Knabe und ein Mann. Mit hoch erhobenen Büchsen warfen sie sich auf die angeblichen Prospektoren.
Jemmy hatte sich gebückt und mit zwei schnellen Schnitten die Fesseln Wohkadehs gelöst. Der Indianer schnellte empor, sprang auf einen der Feinde zu, ergriff ihn beim Genick, riss ihn nieder und schleuderte ihn über das Wasser hinüber, wo sein Jagdmesser lag. Kein Mensch hätte ihm eine solche Körperstärke zugetraut. Dem Weißen nachspringen, mit der Rechten das Messer ergreifen, auf den Feind knien und dessen Haarschopf mit der Linken erfassen, das war das Werk eines Augenblicks. „Help – help – for God’s sake – help!“, kreischte der Mann in höchster Todesangst auf.
Wohkadeh hatte das Messer zum tödlichen Stoß erhoben. Sein blitzendes Auge fiel auf das vor Entsetzen verzerrte Gesicht des Feindes – und die Hand mit dem Messer sank nieder. „Hast du Angst?“, fragte er.
„Ja! Gnade, Gnade!“
„Sag, dass du ein Hund bist!“
„Gern, sehr gern! Ich bin ein Hund!“
„So bleib zu deiner Schande leben. Ein Indianer stirbt mutig und ohne Klage, du aber wimmerst um Barmherzigkeit. Wohkadeh kann den Skalp eines Hundes nicht tragen. Du hast mich geschlagen, dafür gehörte deine Kopfhaut mir. Aber ein räudiger Hund kann keinen roten Mann beleidigen. Lauf fort; es ekelt Wohkadeh vor dir!“
Er gab ihm einen Tritt mit dem Fuß. Im nächsten Augenblick war der Mann verschwunden.
Das war alles viel schneller geschehen, als man es zu erzählen vermag. Brake lag am Boden, drei andere neben ihm. Die Übrigen hatten sich schleunigst ohne ihre Waffen aus dem Staub gemacht. Ihre Pferde waren ihnen nachgelaufen. Nur die beiden Braunen standen noch da und rieben ihre Köpfe an den Schultern der beiden Helfer, die sich so unerwartet eingestellt hatten.
Der Knabe mochte ungefähr das sechzehnte Jahr vollendet haben, doch war sein Körper über dieses Alter hinaus entwickelt. Helle Gesichtsfarbe, blondes Haar und blaugraue Augen wiesen auf germanische Abstammung hin. In seinem Gürtel steckte ein Messer, dessen Griff von seltener indianischer Arbeit war, und das Doppelgewehr, das er in der Hand hielt, schien für ihn fast zu schwer zu sein. Seine Wangen hatten sich im Kampf gerötet, aber er stand doch so ruhig da, als hätte es etwas für ihn ganz Alltägliches gegeben. Wer ihn jetzt betrachtete, war jedenfalls geneigt anzunehmen, dass solche Auftritte für ihn nichts Seltenes seien.
Einen eigentümlichen Anblick bot sein Begleiter, ein kleiner, schmächtiger Mann mit bartlosem Gesicht. Er trug indianische Schuhe und Lederhosen und dazu einen dunkelblauen Frack, der mit hohen Achselpuffen, Patten und blank geputzten Messingknöpfen versehen war. Dieses Kleidungsstück stammte wohl aus Urgroßvaters Zeiten. Damals wurde ja ein Tuch gefertigt, das für eine Ewigkeit gemacht zu sein schien. Freilich war der Frack verschossen und an den Nähten fleißig mit Tinte aufgefärbt, aber es war noch kein einziges Löchlein darin zu bemerken. Solch alten Kleidungsstücken begegnet man im ‚Far West‘ sehr oft.
Auf dem Kopf trug der kleine Mann einen riesigen schwarzen Amazonenhut, den eine große, gelb gefärbte, unechte Straußenfeder schmückte. Dieses Prachtstück hatte jedenfalls vor Jahren irgendeiner Lady des Ostens gehört und war dann durch ein launenhaftes Schicksal nach dem fernen Westen verschlagen worden. Da die breite Krempe gut gegen Sonne und Regen schützte, hatte der jetzige Besitzer wohl keine Bedenken gehabt, ihm die gegenwärtige Bestimmung zu geben. Bewaffnet war das Männchen nur mit Büchse und Messer. Selbst der Gürtel fehlte, ein sicheres Zeichen, dass sich der Mann nicht auf einem weiten Jagdzug befand.
Er schritt auf der kleinen Walstatt hin und her und betrachtete einige Gegenstände, die von den Besiegten in der Eile der Flucht zurückgelassen worden waren. Dabei konnte man bemerken, dass er mit dem linken Fuß hinkte. Wohkadeh war der Erste, dem dieser Umstand auffiel. Er trat zu ihm, legte ihm die Hand an den Arm und fragte:
„Ist mein weißer Bruder vielleicht der Jäger, den die Bleichgesichter den Hobble-Frank nennen?“
Der Kleine nickte ein wenig überrascht und entgegnete bejahend in englischer Sprache. Da deutete der Indianer auf den jungen Weißen und erkundigte sich weiter: „Und dieser hier ist Martin Baumann, der Sohn des berühmten Mato-poka?“
Mato-poka ist ein aus der Sioux- und Utahsprache zusammengetragenes Wort und bedeutet Bärentöter.
„Ja“, bestätigte der Gefragte.
„So seid ihr es, die ich suche.“
„Zu uns willst du? Willst du vielleicht etwas kaufen? Wir haben einen Store und handeln mit allem, was ein Jäger braucht.“
„Nein. Wohkadeh hat eine Botschaft an euch auszurichten.“
„Von wem?“
Der Indianer warf einen forschenden Blick rundum und erklärte dann: „Hier ist nicht der Ort dazu. Euer Wigwam liegt nicht weit von hier an diesem Wasser?“
„In einer Stunde können wir dort sein.“
„So lasst uns dahin gehen. Wenn wir an eurem Feuer sitzen, werde ich euch mitteilen, was ich zu sagen habe. Kommt!“
Er sprang über das Wasser, holte sein Pferd herüber, das ihn nun wohl die kurze Strecke noch zu tragen vermochte, stieg auf und ritt davon, ohne sich umzusehen, ob die anderen ihm auch folgten.
„Der macht kurzen Prozess!“, meinte der Hobble-Frank.
„Soll er euch etwa eine Rede halten, die noch dünner und länger ist, als ich es bin?“, lachte der Lange Davy. „So ein Roter weiß genau, was er tut, und ich rate euch, ihm augenblicklich zu folgen.“
„Und ihr? Was werdet ihr tun?“
„Wir reiten mit. Wenn euer Palast so nahe ist, wäre es ja die niederträchtigste Unhöflichkeit von euch, uns nicht auf einen Schluck und zwei Bissen einzuladen. Und da ihr einen Kramladen habt, können wir euch vielleicht auch einige Dollars verdienen lassen.“
„So? Habt ihr denn einige Dollars bei euch?“, fragte der Kleine in einem Ton, der hören ließ, dass er die beiden Jäger nicht gerade für Millionäre hielt.
„Das geht euch erst dann etwas an, wenn wir kaufen wollen. Verstanden?“
„Hm, ja freilich! Aber wenn wir jetzt fortgehen, was soll dann mit den Kerlen werden, die uns die zwei Pferde gestohlen haben? Wollen wir nicht wenigstens ihrem Anführer, diesem Brake, ein Andenken hinterlassen, das ihn an uns erinnert?“
„Nein. Lasst sie laufen, Mann! Sie sind feige Diebe, die vor einem Bowiemesser davonrennen. Es macht euch keine Ehre, wenn ihr euch noch länger mit ihnen beschäftigt. Die Pferde habt ihr ja wieder. Damit basta!“
„Hättet ihr nur besser ausgeholt, als ihr ihn niederschlugt. Der Kerl hat nur das Bewusstsein verloren.“
„Ich habe das mit Absicht getan. Es ist kein sehr angenehmes Gefühl, einen Menschen erschlagen zu haben, den man auf andere Weise unschädlich machen kann.“
„Na, mögt Recht haben. Kommt also zu euren Pferden!“
„Wie? Ihr wisst, wo unsere Pferde sind?“
„Freilich. Wir müssten schlechte Westmänner sein, wenn wir nicht umhergespäht hätten, bevor wir euch unsere Anwesenheit merken ließen.“
Der Schmächtige stieg auf das eine der wiedererlangten Tiere. Sein junger Begleiter sprang auf das andere. Beide ritten genau auf die Stelle zu, wo Jemmy und Davy ihre Pferde in den Sträuchern versteckt hatten.
Unweit davon waren ihre eigenen angepflockt, auf denen sie die Spur der Diebe aufgenommen hatten und die sie jetzt am Zügel mitführten. Nun folgten die vier der Fährte des Indianers, den sie bald vor sich erblickten. Doch ließ er sie nicht ganz an sich herankommen, sondern ritt immer vor ihnen her, so als wüsste er genau die Richtung, die er einzuschlagen hatte, um das Ziel zu erreichen.
Der Hobble-Frank hielt sich an der Seite des Dicken Jemmy, an dem er Wohlgefallen zu finden schien. „Wollt Ihr mir wohl sagen, Sir, was ihr eigentlich in dieser Gegend sucht?“, meinte er.
„Wir wollten ein wenig hinauf nach Montana, wo es eine viel bessere Jagd gibt als diesseits der Big Horn Mountains. Dort findet man doch verständige Waldläufer und Savannenmänner, die die Jagd eben um der Jagd willen betreiben. Hier aber schlachtet man Tiere förmlich ab. Die Sonntagsbüchse wütet unter den Büffeln, die zu Tausenden getötet werden, nur weil ihre Häute sich besser zu Treibriemen eignen als gewöhnliches Rindsleder. Es ist ein Sünde und eine Schande! Nicht wahr?“
„Recht habt Ihr, Sir. Das war früher ganz anders. Da stellte sich der Jäger dem Wild ehrlich gegenüber, um sich das Fleisch, das er brauchte, mit Gefahr seines Lebens zu erkämpfen. Jetzt aber ist die Jagd meist nur ein feiges Morden aus dem Hinterhalt und die Jäger von altem Schrot und Korn sterben nachgerade aus. Leute wie ihr beide sind jetzt selten. Geld traue ich euch freilich nicht viel zu, aber einen guten Klang haben eure Namen. Das muss man gern gestehen.“
„Kennt ihr denn unsere Namen?“
„Will’s meinen.“
„Woher?“
„Dieser Wohkadeh hat sie ja genannt, als ich mit Martin im Busch lag und euch belauschte. Eigentlich habt Ihr gar nicht so die richtige Gestalt für einen Westmann. Eure Hüfte ist mehr geeignet für einen Müller oder Bäckermeister im alten Germany. Aber...“
„Was?“, fiel der Dicke schnell ein. „Ihr redet da von Deutschland. Kennt Ihr es vielleicht?“
„Na, und ob! Ich bin ein Deutscher mit Haut und Haar!“
„Und ich mit Leib und Seele!“
„Ist’s wahr?“, fragte Frank, indem er sein Pferd anhielt. „Eigentlich konnte ich es mir gleich denken. Einen Yankee von Eurem Körperumfang kann es ja kaum geben. Ich aber freue mich königlich, einen Landsmann getroffen zu haben. Her mit Eurer Hand, Mann! Ihr seid mir herzlich willkommen!“
Sie schlugen ein, dass beiden die Hände schmerzten. Der Dicke aber meinte: „Treibt nur Euer Pferd wieder an! Wir brauchen ja deshalb nicht hier halten zu bleiben. Wie lange seid Ihr denn bereits in den Staaten?“
„Mehr als zehn Jahre.“
„So habt Ihr wohl indessen Euer Deutsch verlernt?“
Beide hatten bisher Englisch gesprochen. Bei der letzten Frage richtete Frank seine kleine Gestalt möglichst hoch im Sattel auf und entgegnete beleidigt. „Ich? Meine Sprache verlernt? Da kommen Sie bei mir verkehrt an! Ich bin ein Deutscher und bleibe ein Deutscher. Wissen Sie ungefähr, wo dazumal meine Wiege gestanden hat?“
„Nein. Ich war ja nicht dabei.“
„Na, allemal nur in Sachsen! Verstehen Sie? Ich habe schon mit manchem Deutschen gesprochen, aber ich habe niemals jemand so gut verstanden, als wenn er eben in Sachsen geboren war. Sachsen ist das Herz von Deutschland. Dresden is klassisch, die Elbe is klassisch, Leipzig is klassisch und die Sächsische Schweiz ooch. Die schönste Gegend is die Strecke zwischen Pirna und Meißen, und so ziemlich zwischen diesen beiden Städten habe ich das Licht der Welt erblickt. Und später habe ich ganz in derselben Gegend meine Laufbahn angefangen. Ich war nämlich Forschtgehilfe in Moritzburg, was ein berühmtes königliches Jagdschloss is mit einer famosen Bildergalerie und großen Karpfenteichen. Mein bester Freund war der dortige Schulmeister, mit dem ich alle Abende Sechsundsechzig gespielt und nachher von den Künsten und Wissenschaften gesprochen habe. Dort habe ich mir ne ganz besondere allgemeine Bildung angeeignet. Oder zweifeln Sie etwa daran? Sie machen mir so ein verbohrtes Gesicht?“
„Ich mag nicht darüber streiten, obgleich ich früher Gymnasiast gewesen bin und mensa dekliniert habe.“
Der Kleine warf Jemmy von der Seite einen pfiffigen Blick zu und frage: „Mensa dekliniert? Da haben Sie sich wohl versprochen?“
„Wüsste nicht, wieso?“
„Na, dann ist’s mit Ihrem Gymnasium ooch nich sehr weit her. Es heißt nicht dekliniert, sondern deklamiert und auch nicht Mensa, sondern Pensa. Sie haben Ihre Pensa deklamiert, vielleicht des Sängers Fluch von Hufeland oder den Freischütz von Frau Maria Leineweber. Aber deshalb keine Feindschaft nich? Es hat eben jeder so viel gelernt, wie er kann, mehr nich, und wenn ich einen Deutschen sehe, so freue ich mich darüber, ooch wenn er nich gerade ein gescheiter Kerl is oder gar ein Sachse. Also, wie steht’s? Wollen wir gute Freunde sein?“
„Gewiss!“, lachte der Dicke. „Ich habe immer gehört, dass die Sachsen die gemütlichsten Leute sind. Warum aber haben Sie Ihre schöne Heimat verlassen?“
„Eben wegen der Kunst und der Wissenschaft.“
„Wieso?“
„Das kam ganz plötzlich und folgendermaßen: Wir sprachen von der Politik und der Weltgeschichte, abends in der Wirtschaft. Wir waren unser drei am Tisch, nämlich der Hausknecht, der Nachtwächter und ich. Der Schulmeister saß am anderen Tisch bei den Vornehmen. Weil ich aber stets ein sehr leutseliger Mensch gewesen bin, hatte ich mich zu den zweien gesetzt, die ooch ganz glücklich waren über diese Art von Herablassung. Bei der Weltgeschichte nun kamen wir ooch off den alten Papa Wrangel zu sprechen und dass der sich das Zeitwort mehrschtenteels[12] so angewöhnt gehabt hatte, dass er es bei jeder Gelegenheit zum Vorschein brachte. Da fingen nun die beiden Kerle an, sich mit mir über die richtige Aussprache dieses Wortes zu streiten. Jeder hatte eine andere Ansicht. Ich sagte, es müsse gesprochen werden: mehrschtenteels; der Hausknecht aber meinte: mehrschtenteils, und der Nachtwächter sagte gar meistenteels. Bei diesem Streit kam ich nach und nach in die Wolle, aber als gebildeter Beamter und Staatsbürger bewahrte ich mir die Kraft, meine Selbstüberwindung zu beherrschen, und wendete mich an meinen Freund, den Schulmeister. Doch er mochte schlechte Laune haben oder so ein bisschen Anflug von gelehrtem Übermut, kurz und gut, er gab mir nicht Recht und sagte, wir hätten alle dreie Unrecht. Er behauptete, in dem Wort mehrschtenteels müssten zwei ‚ei‘ stehen. Weil ich nun aber ganz gewiss weiß, dass es nur een einziges Wort mit zwei ‚ei‘ gibt, nämlich Reisbrei, wurde ich unangenehm. Und als dann noch der Nachtwächter sagte, ich könne ooch nich richtig sprechen, da tat ich denn, was jeder Ehrenmann getan haben würde: Ich warf ihm mein beleidigtes Ehrgefühl an den Kopp und das Bierglas dazu. Jetzt freilich gab es verschiedene Szenen ohne Kulissen und das Ende war, dass ich wegen Störung der öffentlichen Unruhe und wegen Verletzung eines beabsichtigten Körpers in Anklagezustand versetzt wurde. Ich sollte bestraft und abgesetzt werden. Die Bestrafung und Absetzung hätte ich mir wohl gefallen gelassen, aber dass ich ooch meine Anstellung verlieren sollte, das war mir zu viel. Das konnte ich nich verwinden. Als ich die Strafe und die Absetzung überstanden hatte, ging ich auf und davon. Und weil ich alles, was ich einmal mache, ooch gleich ordentlich mache, ging ich sofort nach Amerika. Also is eigentlich nur der alte Wrangel daran schuld, dass Sie mich heute hier getroffen haben.“
„Ich bin ihm sehr dankbar dafür, denn Sie gefallen mir“, versicherte der Dicke, indem er dem Landsmann freundlich zunickte.
„So? Is das wahr? Nun, ich habe ooch gleich so ne Art von heimlicher Zuneigung für Sie empfunden und das hat natürlich seinen guten Grund. Erstens sind Sie kein übler Kerl, zweitens bin ich ooch nich ganz ohne und so können wir drittens recht gute Freunde werden. Beigestanden haben wir einander ooch schon und so is eigentlich das Band fertig, das uns lieblich umschlingen soll. Sie werden gütigst bemerken, dass ich mich stets in gewählten Ausdrücken bewege und daraus können Sie schließen, dass ich mich Ihrer Freundschaftsempfindungen nicht unwürdig erweisen werde. Der Sachse ist immer nobel, und wenn mich heute ein Indianer skalpieren wollte, so würde ich höflich zu ihm sagen: „Bitte, bemühen Sie sich freundlichst! Hier haben Sie meine Skalplocke!“
Da meinte Jemmy lachend: „Wollte er dann ebenso höflich sein, so müsste er Ihnen Ihre Kopfhaut lassen. Aber, um nun auch von einem anderen zu sprechen: Ist Ihr Begleiter wirklich der Sohn des bekannten Bärenjägers Baumann?“
„Ja. Baumann is mein Geschäftsteilhaber und sein Sohn, der Martin, nennt mich Onkel, obgleich ich das einzige Kind meiner Eltern bin und ooch nie verheiratet war. Wir trafen uns drunten in St. Louis, damals, als das Goldfieber die Diggers nach den Schwarzen Hügeln zog. Wir hatten uns beide ein Sümmchen gespart und beschlossen, hier oben nen Laden anzulegen. Das war jedenfalls vorteilhafter, als mit nach Gold zu graben. Die Sache gelang recht gut. Ich übernahm den Laden und Baumann ging off die Jagd, um für den Schnabel zu sorgen. Später aber stellte sich’s heraus, dass hier am Ort kein Gold zu finden war. Die Diggers zogen fort und nun wohnten wir allein da mit unseren Vorräten. Nur nach und nach wurden wir sie an Jäger los, die zufällig hier vorüberkamen. Das letzte Geschäft machten wir vor zwei Wochen. Da suchte uns ne kleine Gesellschaft off, die Baumann anstellen wollte, sie nach dem Yellowstone River zu begleiten. Dort sollten nämlich Halbedelsteine in Massen zu finden sein und diese Leute waren Steinschleifer. Baumann ließ sich bereit finden, machte sich eine ansehnliche Bezahlung aus, verkaufte ihnen eine bedeutende Menge Pulver und Blei und anderes Brauchbare und ging dann mit ihnen fort. Jetzt bin ich nun mit seinem Sohn und einem Neger, den wir von St. Louis mitgenommen haben, ganz allein im Blockhaus.“
„Das Gebiet des Yellowstone River ist aber eine äußerst gefährliche Gegend. Zwischen hier und dort jagen jetzt die Schlangenindianer.“
„Sie haben das Kriegsbeil vergraben.“
„Und ich hörte, dass sie es in neuester Zeit wieder ausgegraben haben sollen. Ihr Freund befindet sich ganz gewiss in Gefahr. Dazu der Bote, der heute zu Ihnen kommt. Ich ahne nichts Gutes.“
„Dieser Indianer ist ein Sioux.“
„Aber er zögerte, seine Botschaft auszurichten. Das ist kein gutes Zeichen. Mit einer frohen Nachricht braucht man nicht zurückhalten, und er sagte mir auch, dass er vom hohen Gebirge im Westen komme.“
„So will ich schnell zu ihm.“ Der kleine Sachse spornte sein Pferd an, um Wohkadeh zu erreichen. Sobald dieser es merkte, stieß er dem seinigen die Fersen in die Weichen und eilte voran. Wenn Hobble-Frank nicht ein Wettrennen unternehmen wollte, musste er darauf verzichten, bereits jetzt mit dem Indianer zu sprechen.
Indessen hatte sich der Sohn des Bärenjägers zu dem Langen Davy gehalten. Dem lag natürlich auch daran, etwas über die Verhältnisse der neuen Bekannten zu erfahren. Er erhielt zwar die Auskunft, aber nicht so ausführlich, wie es sein Wunsch war. Der Knabe war sehr zurückhaltend und einsilbig.
Endlich wand sich der Bach in einer Krümmung um eine Anhöhe, auf der die Nahenden eine Blockhütte erblickten, deren Lage sie zu einem kleinen Fort machte, das sicheren Schutz gegen einen Indianerangriff bot.
Die Höhe fiel an drei Seiten so steil ab, dass man sie kaum erklimmen konnte. Die vierte Seite war mit einer doppelten Fenz versehen. Unten gab es ein Maisfeld und ein kleines, mit Tabak bebautes Stück Land. In dessen Nähe weideten zwei Pferde. Martin deutete auf die Tiere und erklärte: „Von dort haben uns die Männer unsere Pferde gestohlen, als wir nicht daheim waren. Wo mag Bob, unser Neger, sein?“
Er steckte zwei Finger in den Mund und stieß einen schrillen Pfiff aus. Da lugte ein schwarzer Kopf hinter den hohen Maispflanzen hervor. Zwischen den breitgezogenen, wulstigen Lippen wurden zwei Reihen von Zähnen sichtbar, auf die ein Jaguar hätte stolz sein können. Dann kam die herkulische Gestalt des Negers zum Vorschein. Er hatte einen schweren, dicken Pfahl in der Hand und sagte unter Grinsen:
„Bob sich verstecken und aufpassen. Wenn Spitzbuben wiederkommen und auch noch zwei andere Pferde stehlen wollen, dann ihnen mit diesem Stock die Köpfe einschlagen.“
Er schwang den Pfahl mit einer Leichtigkeit, als sei er eine Weidenrute.
Der Indianer kümmerte sich gar nicht um ihn. Er ritt an ihm vorüber, die vierte, zugängliche Seite der Höhe bis zur Doppelfenz empor, sprang vom Rücken seines Pferdes darüber hinweg und verschwand hinter der Einzäunung.
„Was sein Redman für ein grob Kerl!“, zürnte der Neger. „Reiten an Masser Bob vorüber, ohne sagen: Good day! Springen über Fenz und gar nicht warten, bis Massa Martin ihm erlauben, einzutreten. Masser Bob ihn werden höflich machen!“ Der gute Schwarze gab sich selbst den Titel Masser Bob, also Mister oder Herr Robert. Er war ein freier Neger und fühlte sich gekränkt, weil er von dem Indianer nicht begrüßt worden war.
„Du wirst ihn nicht beleidigen“, warnte Martin. „Er ist unser Freund.“
„Das sein ein ander Sache. Wenn Redman sein Freund von Massa, so sein auch Freund von Masser Bob. Massa Pferde wiederhaben? Spitzbuben tot gemacht?“
„Nein. Sie sind entflohen. Öffne die Fenz!“
Bob stieg mit langen Schritten voran und schob oben die beiden Teile des schweren Tores auseinander, als seien sie aus Papier geschnitten. Dann ritten die anderen in den Raum, der von der Fenz umschlossen wurde.