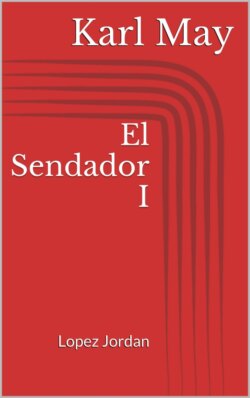Читать книгу El Sendador I. Lopez Jordan - Karl May - Страница 3
ОглавлениеErstes Kapitel. Der Yerbatero.
Ein kalter Pampero strich über die meerbusenartige Mündung des La Plata herüber und bestrich die Straßen von Montevideo mit einem Gemisch von Sand, Staub und großen Regentropfen. Man konnte nicht auf der Straße verweilen, und darum saß ich in meinem Zimmer des Hotel Oriental und vertrieb mir die Zeit mit einem Buche, dessen Inhalt sich auf das Land bezog, welches ich kennenlernen wollte. Es war in spanischer Sprache geschrieben, und die Stelle, bei welcher ich mich jetzt befand, würde in deutscher Übersetzung ungefähr lauten:
»Die Bevölkerung von Uruguay und der argentinischen Länder besteht aus Nachkommen der Spanier, aus einigen nicht sehr zahlreichen Indianerstämmen und aus den Gauchos, welche zwar Mestizen sind, sich aber trotzdem als Weiße betrachten und sich stolz auf diesen Titel fühlen. Sie vermählen sich meist mit indianischen Frauen und tragen dadurch das Ihrige bei, die Bevölkerung des Landes wieder den Ureinwohnern zu nähern.
Der Gaucho hat in seinem Charakter die wilde Entschlossenheit und den unabhängigen Sinn der Ureinwohner und zeigt dabei den Anstand, den Stolz, die edle Freimütigkeit und das vornehme, gewandte Betragen des spanischen Kavallero. Seine Neigungen ziehen ihn zum Nomadenleben und zu abenteuerlichen Fahrten. Ein Feind jeden Zwanges, ein Verächter des Eigentumes, welches er als eine unnütze Last betrachtet, ist er ein Freund glänzender Kleinigkeiten, welche er sich mit großem Eifer verschafft, aber auch ohne Bedauern wieder verliert.
Er ist ferner ein kühner, todesmutiger Beschützer seiner Familie, welche er aber ebenso hart behandelt wie sich selbst; mißtrauisch, weil er unzählige Male betrogen worden ist, schlau aus Instinkt und Vorsicht, achtet er den Fremden, ohne ihn zu lieben, dient er dem Städter, ohne ihn zu achten, und hat niemals begreifen gelernt, wie man in seine Heimat kommen konnte, um die Herden auszubeuten, welche die seinigen geworden waren und von denen er nichts verlangte als den täglichen Lebensunterhalt, ohne sich um den vorhergehenden und den folgenden zu Tag kümmern.
Seit sich im Lande eine besitzende Klasse gebildet hat, ruht der Gaucho, welcher sich tapfer für die Befreiung von dem spanischen Joche schlug, vom Siege aus, hat niemals Belohnung verlangt und begnügt sich mit der bescheidenen Rolle, das Eigentum anderer zu schützen, wofür er nichts fordert, als daß man nie vergesse, daß er ein freier Mann sei und seine Dienst freiwillig leiste.
Die Bewaffnung des Gaucho bildet der Lasso, ein langer, lederner Riemen mit einer Schlinge, die Bolas und außerdem im Falle des Krieges eine Lanze.
Der Ruhm des Gaucho besteht in der Geschicklichkeit, mit welcher er den Lasso wirft. Ein mehr als dreißig Fuß langer Riemen ist mit dem einen Ende an dem Schenkel des Reiters befestigt; das andere läuft in eine bewegliche Schlinge aus. Diese Schlinge wird um den Kopf geschlungen und nach dem fliehenden Tiere geworfen. Trifft sie den Hals oder die Füße, so wird sie durch den Widerstand des Tieres zugezogen. Die Aufgabe des Pferdes ist es nun, die Erschütterung des Riemens auszuhalten, bald nachzugeben, bald Widerstand zu leisten. Der Reiter versucht indes, das Tier nach einem Orte zu ziehen, wo er es niederwerfen kann. Diese Art des Schlingenwerfens, welche man laceara muerte nennt, ist sehr gefährlich und erfordert große Übung. Man hat viele Beispiele, daß durch die Verwickelung des Riemens dem Reiter die Beine zerbrochen worden sind. Der Lasso hängt beständig am Sattel des Gaucho. Widerspenstige Pferde, Ochsen, Hammel, alles wird mit der Schlinge gebändigt oder gefangen.
Die Bolas sind drei an Riemen zusammenhängende Bleikugeln. Zwei werden um den Kopf geschlungen, die dritte aber festgehalten, bis man sicher ist, das Tier mit dem Wurfe zu erreichen. Die Kugeln schlingen sich dann um die Beine desselben und bringen es zu Fall.
Die Hauptleidenschaft des Gauchos ist das Spiel; die Karten gehen ihm über alles. Auf den Fersen hockend, das Messer neben sich in die Erde gesteckt, um einen unehrlichen Gegner sofort mit einem Stich ins Herz bestrafen zu können, wirft er das Kostbarste, was er besitzt, in das Gras und wagt es kaltblütig.
In der Estanzia arbeitet der Gaucho nur, wenn es ihm gefällig ist, gibt seinem Dienstverhältnisse ein Gepräge von Unabhängigkeit und würde es niemals dulden, daß sein Herr so unhöflich wäre, in ihm nicht die Eigenschaft eines Kavallero anzuerkennen, deren er sich durch seine Bescheidenheit, sein anständiges, ja nobles Betragen und seine ruhige, Achtung einflößende Haltung würdig macht.
Wenn es ihm einmal nicht gefällig ist, die vom Herrn verlangte Arbeit zu verrichten, so sagt er, daß er nur zu der oder der Stunde unter den oder den Umständen an das Werk gehen könne. Wenn dann der Herr einige Unzufriedenheit zeigt, so verlangt der Gaucho, ohne aber grob zu werden, seinen Lohn, setzt sich auf sein Pferd und sucht sich eine andere Estanzia, deren Besitzer minder gebieterisch ist. Obgleich er die Bequemlichkeit liebt, findet er stets Arbeit, weil er verständig ist und die Pflege des Viehes, welches den Hauptreichtum jener Gegenden bildet, ganz vorzüglich versteht.
So ist der Gaucho, welchen man nicht mit den zwar kühnen, aber gewissenlosen Abenteurern verwechseln darf, welche Frauen, Mädchen, Pferde, kurz, alles entführen und stehlen, was ihnen gefällt, und unbesorgt in die Zukunft hinein leben.« – – –
So stand geschrieben, was ich las. Ich war am Vormittag in Montevideo angekommen und kannte also das Land und seine Bewohner nicht im mindesten. Dennoch wagte ich, einigen Zweifel gegen die Wahrheit des Gelesenen zu hegen.
Zunächst besteht die Bevölkerung, von welcher die Rede war, nicht nur aus Gauchos, Indianern und Nachkommen der Spanier. Es sind auch Engländer, Deutsche, Franzosen und Italiener zu Tausenden, ja Zehntausenden vorhanden, die Schweizer, Illyrier und viele andere gar nicht gerechnet.
Mit der Art und Weise, in welcher der Gaucho den Lasso gebrauchen sollte, war ich gar nicht einverstanden. Welcher Reiter, der zum Beispiel einen halb wilden Stier einfangen will, wird den Lasso sich am Schenkel befestigen! Der Stier würde ihn unbedingt vom Sattel reißen und zu Tode schleppen.
Ich war bei erster Gelegenheit so frei, mich nach dem Verfasser dieser Auslassung zu erkundigen. Er hieß Adolphe Delacour und war Redakteur des Patriote Francais zu Montevideo gewesen. Nun, dieser Herr mußte die Verhältnisse besser kennen als ich. Ich mußte mich begnügen, abzuwarten, ob ich seine Ansichten bestätigt finden werde, was aber glücklicher Weise nicht der Fall war.
Übrigens war es nicht nötig, mich länger mit der Lektüre zu beschäftigen. Der Pampaswind hatte nachgelassen, und auf den Straßen entwickelte sich das rege Leben einer bedeutenden Hafenstadt von neuem. Ich wollte mir dasselbe betrachten und zu diesem Zwecke einen Ausgang machen.
Eben setzte ich den Hut auf, als es an meine Türe klopfte. Ich rief herein, und zu meinem großen Erstaunen trat ein fein nach französischer Mode gekleideter Herr ein. Er trug eine schwarze Hose, eben solchen Frack, weiße Weste, weißes Halstuch, Lackstiefel und hielt einen schwarzen Zylinderhut in der Hand. um welchen ein weißseidenes Band geschlungen war. Dieses Band, von welchem zwei breite Schleifen herabhingen, brachte mich unerfahrenen Menschen auf die famose Idee, einen Kindtaufs- oder Hochzeitsbitter vor mir zu haben. Er machte mir eine tiefe, ja ehrbietige Verneigung und grüßte:
»Ich mache Ihnen meine Verbeugung, Herr Oberst!«
Er wiederholte seinen tiefen Bückling noch zweimal in demonstrativ hochachtungsvoller Weise. Wozu dieser militärische Titel? Hatte man hier in Uruguay vielleicht dieselbe Gepflogenheit wie im lieben Österreich, wo die Kellner jeden dicken Gast »Herr Baron«, jeden Brillentragenden »Herr Professor« und jeden Inhaber eines kräftigen Schnurrbartes »Herr Major« nennen? Der Mann hatte so ein eigenartiges Gesicht. Er gefiel mir nicht. Darum antwortete ich kurz:
»Danke! Was wollen Sie?«
Er schwenkte den Hut zweimal hin und her und erklärte:
»Ich komme, mich Ihnen mit allem, was ich bin und habe zur geneigten Verfügung zu stellen.«
Dabei richtete sich sein Auge von seitwärts mit einem scharf forschenden Blick auf mich. Er hatte keine ehrlichen Augen. Darum fragte ich:
»Mit allem, was Sie sind und haben? So sagen Sie mir zunächst gefälligst, wer und was Sie sind.«
»Ich bin Sennor Esquilo Anibal Andaro, Besitzer einer bedeutenden Estanzia bei San Fructuoso. Euer Gnaden werden von mir gehört haben.«
Es kommt zuweilen vor, daß der Name eines Menschen bezeichnend für den Charakter desselben ist. Ins Deutsche übersetzt, lautete derjenige meines Besuchers Äschylus Hannibal Schleicher. Das war gar nicht empfehlend.
»Ich muß gestehen, daß ich noch nie von Ihnen gehört habe,« bemerkte ich. »Da Sie mir gesagt haben, wer und was Sie sind, darf ich wohl auch erfahren, was Sie haben, das heißt natürlich, was Sie besitzen?«
»Ich besitze erstens Geld und zweitens Einfluß.«
Er machte vor den beiden Worten, um sie besser ins Gehör zu bringen, eine Pause und sprach sie mit scharfer Betonung aus. Dann sah er mich mit einem pfiffigen, erwartungsvollen Augenblinzeln von der Seite an. Seine Gesicht war jetzt ganz dasjenige eines dummlistigen, dreisten Menschen.
»Das sind allerdings zwei recht schöne, brauchbare Sachen, Geld und Einfluß. Sind Sie zu dem Zwecke gekommen, mir beides zur Verfügung zu stellen?«
»Ich würde mich glücklich fühlen, wenn Sie die Gewogenheit haben wollten, diese meine Absicht nicht zurückzuweisen!«
Das war überraschend. Dieser Mann stellte mir seine gesellschaftlichen Verbindungen und auch seinen Geldbeutel zur Verfügung! Aus welchem Grunde? Um das zu erfahren, sagte ich:
»Gut, Sennor, ich nehme beides an, vor allen Dingen das letztere.«
»Also zunächst Kapital! Wollen Euer Hochwohlgeboren mir sagen, wie stark die Summe ist, deren Sie bedürfen?«
»Ich brauche augenblicklich fünftausend Pesos Fuertos.«
Er zog sein Gesicht befriedigt in die Breite und sagte:
»Eine Kleinigkeit! Euer Gnaden können das Geld binnen einer halben Stunde haben, wenn wir die kleinen Bedingungen einig werden, welche zu machen mir wohl erlaubt sein wird.«
»Nennen Sie dieselben!«
Er trat nahe an mich heran, nickte mir sehr vertraulich zu und sagte:
»Darf ich vorher fragen, ob dieses Geld privaten oder offiziellen Zwecken dienen soll?«
»Nur privaten natürlich.«
»So bin ich bereit, die Summe nicht etwa herzuleihen, sondern sie Euer Hochwohlgeboren, falls Sie es mir gestatten, dies tun zu dürfen, als einen Beweis meiner Achtung schenkweise auszuzahlen.«
»Dagegen habe ich nicht das mindeste.«
»Freut mich außerordentlich. Nur möchte ich Sie in diesem Fall ersuchen, Ihren Namen unter zwei oder drei Zeilen zu setzen, welche ich augenblicklich entwerfen werde.«
»Welchen Inhaltes sollen diese Zeilen sein?«
»O, es wird sich nur um eine Kleinigkeit, um eine wirkliche Geringfügigkeit handeln. Euer Hochwohlgeboren werden mir durch diese Namensunterschrift bestätigen, daß ich, Esquilo Anibal Andaro, Ihr Korps bis zu einer angegebenen Zeit und zu einem ganz bestimmten Preise mit Gewehren versehen habe. Ich bin in der glücklichen Lage, mich in einigen Tagen im Besitze einer hinreichenden Anzahl von Spencer-Gewehren zu befinden.«
Jetzt war es mir klar, daß dieser Sennor Schleicher mich mit einem Offizier verwechselte, dem ich vielleicht ein wenig ähnlich sah. Wahrscheinlich hatte er die löbliche Absicht, den Betreffenden durch das Geschenk von fünftausend Pesos zu bestechen, auf den Gewehrhandel einzugehen. Beim Schlusse des nordamerikanischen Bürgerkrieges waren circa zwanzig Tausend Spencer-Gewehre in Gebrauch gewesen. Man konnte den Yankees recht gut zutrauen, daß sie einen Teil dieser Waffen nach den La Platastaaten, wo dergleichen damals gebraucht wurden, verkauft hatten. Bei diesem Handel konnte der Sennor das Zehnfache des Geschenkes, welches er mir anbot, herausschlagen.
Er hatte mich Oberst genannt. Wie kam ein Oberst dazu, über den Kriegsminister hinweg den Ankauf von Gewehren zu bestimmen? Wollte der Betreffende etwa als Libertador auftreten? Mit diesem Worte, zu deutsch Befreier, bezeichnet man am La Plata die Bandenführer, welche sich gegen das herrschende Regiment auflehnen. Dergleichen Leute hat die Geschichte jener südamerikanischen Gegenden sehr viele zu verzeichnen.
Die Sache war mir sehr interessant. Kaum hatte ich den Fuß auf das Land gesetzt, so bekam ich auch schon Gelegenheit, einen Blick in die intimsten Verhältnisse desselben zu tun. Ich hatte große Lust, die Rolle meines Doppelgängers noch ein wenig weiter zu spielen, doch besann ich mich eines bessern. Natürlich hatte ich, bevor ich nach hier kam, mich über die hiesigen Verhältnisse möglichst unterrichtet, und so wußte ich, daß es für mich sehr gefährlich werden könne, meinen Besuch in seinem Irrtume zu belassen, nur um mich über Verhältnisse zu unterrichten, welche mir unbekannt bleiben mußten. Darum sagte ich zu ihm:
»Eine solche Schrift kann ich leider nicht unterzeichnen. Ich wüßte nicht, was ich mit diesen Gewehren machen sollte, da ich nicht die geringste Verwendung für dieselben habe.«
»Nicht?« fragte er erstaunt. »Euer Hochwohlgeboren können in Zeit von einer Woche über tausend Mann beisammen haben!«
»Zu welchem Zwecke?«
Er trat um zwei Schritte zurück, kniff das eine Auge zu, lächelte listig, als ob er sagen wolle: Na, spiele doch mit mir nicht Komödie; ich weiß ja genau, woran ich mit dir bin! und fragte:
»Soll ich das Euer Gnaden wirklich erst sagen? Ich habe gehört, daß Sie nach Montevideo kommen würden, und nun, da Sie sich hier befinden, kenne ich ganz genau den Zweck Ihrer Anwesenheit. Es gibt ja nur diesen einen Zweck.«
»Sie irren sich, Sennor. Mir scheint, Sie halten mich für einen ganz andern Mann, als ich bin.«
»Unmöglich! Sie hüllen sich in diesen Schleier, weil meine Forderung bezüglich der Gewehre Ihnen vielleicht nicht genehm ist. So bin ich gern bereit, Ihnen andere Vorschläge zu machen.«
»Auch diese würden nicht zu ihrem Ziele führen, denn sie verwechseln mich wirklich mit einer Person, mit welcher ich einige Ähnlichkeit zu besitzen scheine.«
Das machte ihn aber nicht irre. Er behielt seine zuversichtliche Miene, zu welcher sich noch ein beinahe überlegenes Lächeln gesellte, bei und sagte:
»Wie ich aus Ihren Worten schließe, befinden Sie sich jetzt überhaupt nicht in der Stimmung, über diese oder eine ähnliche Angelegenheit zu sprechen. Warten wir also eine geeignete Stunde ab, Sennor. Ich werde mir erlauben, wieder vorzusprechen.«
»Ihr Besuch würde das gegenwärtige Resultat haben. Ich bin nicht derjenige, für den Sie mich halten.«
Er wurde ernster.
»So wünschen Sie also nicht, daß ich meinen Besuch wiederhole?«
»Es wird mir jederzeit angenehm sein, vorausgesetzt, daß Sie nicht länger in dem erwähnten Irrtum verharren. Können Sie mir sagen, wer der Herr ist, mit welchem Sie mich verwechseln?«
Jetzt musterte er mich scharf vom Kopfe bis zu den Füßen herab. Dann meinte er kopfschüttelnd:
»Ich kenne Euer Gnaden bisher als einen tapfern, hochverdienten Offizier und hoffnungsvollen Staatsmann. Die Eigenschaften, welche ich jetzt an Ihnen entdecke, geben mir die Überzeugung, daß Sie in letzterer Beziehung schnell Karriere machen werden.«
»Sie meinen, ich verstelle mich? Hier, nehmen Sie Einsicht in meinen Paß.«
Ich gab ihm den Paß aus der Brieftasche, welche ich auf dem Tische liegen hatte. Er las ihn durch und verglich das Signalement Wort für Wort mit meinem Äußern. Sein Gesicht wurde dabei länger und immer länger. Er befand sich in einer Verlegenheit, welche von Augenblick zu Augenblick wuchs.
»Teufel!« rief er, indem er den Paß auf den Tisch warf. »Jetzt weiß ich nicht, woran ich bin! Ich sowohl, als auch zwei meiner Freunde haben Sie ganz genau als denjenigen erkannt, den ich in Ihnen zu finden gedachte!«
»Wann sahen Sie mich?«
»Als Sie unter der Türe des Hotels standen. Und nun ist dieser Paß allerdings geeignet, mich vollständig irre zu machen. Sie kommen wirklich aus New York?«
»Allerdings. Mit der »Sea-gall«, welche noch jetzt vor Anker liegt. Sie können sich bei dem Kapitän erkundigen.«
Da rief er zornig:
»So hole Sie der Teufel! Warum sagten Sie das nicht sogleich?«
»Weil Sie nicht fragten. Ihr Auftreten ließ mit Sicherheit schließen, daß Sie mich kennen. Erst als Sie von den Gewehren sprachen, erkannte ich, wie die Sache stand. Dann habe ich Sie sofort auf Ihren Irrtum aufmerksam gemacht, was Sie mir hoffentlich bestätigen werden.«
»Nichts bestätige ich, gar nichts! Sie hatten mir nach meinem Eintritte bei Ihnen sofort und augenblicklich zu sagen, wer Sie sind!«
Er wurde grob. Darum antwortete ich in sehr gemessenen Ton:
»Ich ersuche Sie um diejenige Höflichkeit, welche jedermann von jedermann verlangen kann! Ich bin nicht gewöhnt, mir in das Gesicht sagen zu lassen, daß mich der Teufel holen solle. Auch bin ich nicht allwissend genug, um sofort beim Eintritt eines Menschen mir sagen zu können, was er von mir will. Übrigens müssen Sie doch bei dem Wirte oder den Bediensteten des Hotels gefragt haben, bevor Sie zu mir kamen, und da muß man Sie unbedingt berichtet haben, daß ich ein Fremder bin.«
»Das hat man mir allerdings gesagt; aber ich glaubte es nicht, da ich den Verhältnissen nach mir sagen mußte, daß der Sennor, für welchen ich Sie hielt, sich incognito hier aufhalten werde. Dazu kam dann Ihre Aussprache des Spanischen, welcher man es nicht anhört, daß Sie ein Fremder, ein Alemano sind.«
Dieses letztere war sehr schmeichelhaft für mich. Als ich vor mehreren Jahren nach Mexiko kam, hatte ich mich in Beziehung auf diese Sprache der grausamsten Radebrecherei schuldig machen müssen. Aber das Leben ist der beste Lehrmeister. Während der langen Wanderung durch die Sonora und den Süden von Kalifornien hatte ich mich nach und nach in die Lenguage espa¤ola finden müssen, ahnte aber bis heute nicht, daß ich gar ein solcher Sancho Pansa geworden sei.
»Und endlich«, fuhr er fort, »warum tragen Sie den Bart genau in der Weise, wie er von den Bewohnern unserer Banda Oriental getragen wird?«
»Weil ich, wenn ich reise, mich den Gewohnheiten der betreffenden Bevölkerung anzubequemen pflege und nicht überall und immer als Fremder erkannt werden will.«
»Nun, so tragen Sie eben die Schuld daran, daß ich Sie für einen andern hielt. Kein Ausländer hat das Recht, uns nachzuahmen. Man kennt eine gewisse Art von Tieren, welche diesen Nachahmungstrieb in hohem Grade besitzen, und jeder verständige Mann wird sich hüten, mit denselben verglichen zu werden.«
»Für diesen Wink bin ich Ihnen unendlich dankbar, Sennor; doch bitte ich Sie dringend, die Lektion nicht etwa noch weiter auszudehnen. Bis jetzt habe ich dieselbe gratis entgegen genommen; geben Sie sich aber noch weitere Mühe, so würde ich mich gezwungen sehen, Ihnen ein Honorar auszuzahlen, welches Ihren Verdiensten angemessen ist.«
»Sennor, Sie drohen mir!«
»Nein. Ich mache Sie nur aufmerksam.«
»Vergessen Sie nicht, wo Sie sich befinden!«
»Und ziehen Sie selbst in Betracht, daß Sie nicht in einem Zimmer Ihrer Hazienda stehen, sondern in einem Raume, welcher gegenwärtig mir gehört! Und nun mag es genug sein. Bitte, machen Sie mir das Vergnügen, Ihnen Lebewohl sagen zu dürfen!«
Ich ging zur Türe, öffnete dieselbe und lud ihn durch eine Verbeugung ein, von dieser Öffnung Gebrauch zu machen. Er blieb noch einige Augenblicke stehen und starrte mich groß an. Es erschien ihm jedenfalls als etwas ganz Ungeheuerliches, von mir hinauskomplimentiert zu werden. Dann schoß er schnell an mir vorüber und hinaus, rief mir aber dabei zu:
»Auf Wiedersehen! Man wird mit Ihnen abzurechnen wissen!«
Er schüttelte die Faust drohend gegen mich und eilte dann die Treppe hinab. Das war meine erste Unterredung mit einem Eingeborenen, ein Anfang, von welchem ich keineswegs erbaut sein konnte. Freilich, irgend eine Befürchtung zu hegen, das fiel mir nicht ein. Der Mann hatte mich beleidigt und war deshalb von mir hinausgewiesen worden, etwas so Einfaches und Selbstverständliches, daß gar keine Veranlassung vorhanden war, weiter daran zu denken. Auch hatte dieser Haziendero auf mich gar nicht den Eindruck gemacht, als ob ich ihn weiter zu beachten oder gar zu fürchten habe.
Bevor ich ging, mir die Stadt anzusehen, nahm ich die paar Empfehlungsschreiben her, welche ich mitgebracht hatte. Ich bin prinzipiell gegen diese Art und Weise, fremden Leuten Pflichten aufzuerlegen oder ihnen gar zur Last zu fallen. Man wird selbst in seinen Handlungen und Bewegungen sehr gehindert. Aus diesem Grunde mache ich, wenn ich reise, meine Bekanntschaften lieber aus freier Hand, bewege mich und wähle ganz nach meinem persönlichen Geschmack und gebe etwaige Briefe erst kurz vor der Abreise ab. Hundertmal habe ich da beobachtet, wie befriedigt die Betreffenden davon waren, daß es nun keine Zeit mehr zu gesellschaftlichen Ansprüchen und Forderungen gab.
Heute hatte ich vier solche Schreiben in der Hand. Eins derselben war von dem Chef eines New Yorker Exporthauses an seinen Kompagnon, welcher die Filiale dieses Geschäftes in Montevideo leitete. Ich hatte Gelegenheit gehabt, dem Yankee einen nicht ganz unwichtigen Dienst zu leisten, und von ihm das Versprechen erhalten, daß er mich seinem Teilhaber auf das allerbeste empfehlen werde. Dieses eine Schreiben mußte ich sofort abgeben, da der Wechsel, dessen Betrag mein Reisegeld bildete, von dem Kompagnon honoriert werden sollte.
Die drei andern Schreiben steckte ich wieder in die Brieftasche; dieses eine aber legte ich auf den Tisch oder vielmehr, ich wollte es auf den Tisch werfen. Es traf mit der Kante auf und fiel auf die Diele herab. Als ich es aufhob, sah ich, daß das dünne Siegel zersprungen war und die Klappe des Couverts offen stand. In dieser Weise konnte ich den Brief unmöglich übergeben. Ich mußte ihn wieder schließen, und zwar so, daß man nicht sehen konnte, daß er offen gewesen war; ich wäre sonst in den Verdacht gekommen, ihn mit Absicht geöffnet und dann gelesen zu haben.
Gelesen? Hm! Konnte ich das nicht dennoch tun? Ein Unrecht, eine Verletzung des Briefgeheimnisses, eine große Diskretion war es, aber ich hatte doch vielleicht eine Art von Recht dazu, da ich es ja war, auf den der Inhalt sich bezog. Ich nahm also den Bogen aus dem Couverte und öffnete ihn.
Der Inhalt lautete, abgesehen von der Anrede, folgendermaßen:
»Habe Ihr Letztes empfangen und bin mit Ihren Vorschlägen vollständig einverstanden. Das Geschäft ist ein gewagtes, bringt aber im Falle des Gelingens so hohen Gewinn, daß wir den Verlust riskieren können. Das Pulver kommt mit der Sea-gall. Wir haben dreißig Prozent Holzkohle darunter gemischt, und da ich hoffe, daß es Ihnen gelingen werde, es heimlich an das Land zu bringen und also den Zoll zu sparen, so machen wir ein vorzügliches Geschäft. Ich ermächtige Sie hiermit, die Kontrakte zu entwerfen und an Lopez Jordan zur Unterschrift zu senden. Letzteres ist eine höchst gefährliche Angelegenheit, denn wenn die Nationalen den Boten erwischen und die Kontrakte bei ihm finden, so ist es um ihn geschehen. Glücklicherweise kann ich Ihnen ganz zufällig einen Mann bezeichnen, welcher sich zu dieser Sendung ganz vortrefflich eignet.
Der Überbringer dieses Briefes hat sich mehrere Jahre lang unter den Indianern umhergetrieben, ein verwegener Kerl, dabei aber stockdumm und vertrauensselig, wie es von einem Dutchman auch gar nicht anders zu erwarten ist. Er will, glaube ich, nach Santiago und Tucuman und wird also durch die Provinz Entre-Rios kommen. Tun Sie, als ob Sie ihm ein Empfehlungsschreiben an Jordan geben, welches aber die beiden Kontrakte enthalten wird. Findet man sie bei ihm und er wird erschossen, so verliert die Welt einen Dummkopf, um welchen es nicht schade ist. Natürlich dürfen die Dokumente Ihre Unterschrift nicht enthalten; Sie unterzeichnen vielmehr erst dann, wenn Sie dieselben durch einen Boten Jordans zurückerhalten.
Im übrigen wird der Dutchman Ihnen nicht viele Beschwerden machen; er ist von einer geradezu albernen Anspruchslosigkeit. Ein Glas sauren Weins und einige süße Redensarten genügen, ihn glücklich zu machen.«
Dies war, so weit er sich auf mich bezog, der Inhalt dieses merkwürdigen ›Empfehlungsschreibens‹. Hätte ich den Brief nicht gelesen, so wäre ich sehr wahrscheinlich in die Falle gegangen. Es war ein echter Yankeestreich, um den es sich hier handelte. Der deutsche ›Dummkopf‹ sollte, ohne es zu ahnen, eine der Hauptrollen beim Zustandekommen eines Aufruhres spielen. Denn daß es sich um nichts anderes handelte, sagte mir die Erwähnung des Schießpulvers und der Name des berüchtigten Bandenführers Lopez Jordan, welcher seine Gewissenlosigkeit sogar so weit getrieben hatte, seinen eigenen Stiefvater, den früheren General und Präsidenten Urquiza ermorden zu lassen. Ihm sollte jedenfalls Pulver und auch Geld geliefert werden, und der Überbringer der auf dieses Geschäft bezüglichen Kontrakte sollte ich sein!
Ich steckte den famosen Brief in das Couvert zurück und stellte mit Hilfe eines Streichholzes das zersprungene Siegel wieder her. Dann machte ich mich auf den Weg zu dem lieben Kompagnon, welcher spanischer Abkunft war, Tupido hieß und an der Plaza de la Independencia wohnte.
Als ich auf die Straße trat, war von dem Pampero und dem Regen keine Spur mehr zu sehen. Montevideo liegt auf einer Landzunge, welche sattelartig auf der einen Seite zur Bai und auf der andern zum Meere abfällt. In Folge dessen läuft das Wasser so schnell ab, daß das Abtrocknen des Bodens selbst nach dem stärksten Regen nur weniger Minuten bedarf.
Montevideo ist eine sehr schöne, ja glänzende Stadt mitteleuropäischen Stiles. Sie besitzt gute Straßen mit vortrefflichen Trottoirs, reiche Häuser mit lieblichen Gärten, Paläste, in denen sich Klubs und Theater befinden. Die Bauart der Privathäuser ist sehr eigenartig. Es herrscht da fast eine Verschwendung von Marmor, welchen man aus Italien holt, obgleich im Lande selbst ein sehr guter zu finden ist.
Wer bei seiner Ankunft in der Hauptstadt Montevideo etwa glaubt, da die Bewohnertypen des Landesinnern zu sehen, der hat sich sehr geirrt. Kein Gaucho reitet durch die Straßen; indianische Gesichtszüge sind nur selten zu sehen, und Neger trifft man nicht häufiger als zum Beispiel in London oder Hamburg.
Die Tracht ist genau unsere französische, bei den Männern sowohl als auch bei den Frauen. Es können Tage vergehen, ehe man einmal eine Dame erblickt, welche die spanische Mantilla trägt. Über die Hälfte der Einwohnerschaft ist europäischen Ursprunges.
Die Durcheinanderwürfelung der Nationalitäten ruft ein auffallendes Polyglottentum hervor. Leute, welche drei, vier und fünf Sprachen geläufig beherrschen, sind hier weit zahlreicher, als selbst in den europäischen Millionenstädten. Kurz und gut, so lange man sich innerhalb der Bannmeile der Stadt befindet, ist aus nichts zu ersehen, daß man sich auf südamerikanischem Boden bewegt. Man könnte sich ebenso gut in Bordeaux oder Triest befinden.
Auch ich fühlte mich ziemlich enttäuscht, als ich jetzt, neugierig um mich blickend, langsam dahin schlenderte. Ich sah nur europäische Tracht und Gesichter, wie man sie überall findet, wenn man die dunkle Färbung derselben nicht als etwas Eigenartiges betrachten will.
Auffällig waren mir nur die weißen oder roten Bänder, welche viele Herren an ihren Hüten trugen. Später erfuhr ich die Bedeutung derselben: Die Träger weißer Bänder gehörten zur politischen Partei der ›Blancos‹, während die ›Colorados‹ rote Abzeichnungen trugen. Sennor Esquilo Anibal Andaro war demnach nicht etwa Hochzeitsbitter, sondern ein Blanco gewesen. Höchst wahrscheinlich gehörte also der Oberst, mit welchem er mich verwechselt hatte, derselben Partei an. Vielleicht gelang es mir, den Namen desselben zu erfahren.
An der Plaza de la Independencia angekommen, erkannte ich an einem riesigen Firmenschilde das Haus, in welchem sich der Sitz der Filiale meines pfiffigen Yankees befand. Die Fronte desselben machte einen nichts weniger als imponierenden Eindruck. Sie zeigte nur das Parterre und den ersten Stock. In dem ersteren befand sich eine Türe von kostbarer, durchbrochener Eisenarbeit. Hinter derselben lag ein breiter, mit Marmorplatten belegter Hausgang, welcher in einen Hof führte, der mit demselben Materiale gepflastert war. Dort standen in großen Kübeln blühende Pflanzen, deren Duft bis zu mir drang.
Die Türe war verschlossen, obgleich sich vielbesuchte Geschäftsräume hinter derselben befinden mußten. Ich bewegte den Klopfer. Durch eine mechanische Vorrichtung wurde sie geöffnet, ohne daß jemand erschien.
Im Flur sah ich je rechts und links eine Türe. Ein Messingschild sagte mir, daß diejenige der ersteren Seite die für mich richtige sei. Als ich da eintrat, befand ich mich in einem ziemlich großen Parterreraume, welcher sein Licht durch mehrere Türen empfing, die nach dem Hofe offen standen. Schreiber waren an mehreren Tischen oder Pulten beschäftigt. An einem langen Tische stand ein hagerer Mann im Hintergrunde des Zimmers und sprach in sehr rauher Weise mit einem ärmlich gekleideten Menschen.
Ich wendete mich an den mir zunächst Sitzenden, um nach Sennor Tupido zu fragen. Die Antwort bestand in einem stummen, kurzen Winke nach dem Langen. Da dieser mit dem erwähnten Manne beschäftigt war, blieb ich wartend stehen und wurde Zeuge der zwischen ihnen geführten Unterhaltung.
Dem Sennor war die spanische Abkunft von weitem anzusehen, denn er hatte scharfe Züge und einen stolz-verschlagenen Gesichtsausdruck. Den dunklen Bart trug er nach hiesiger Sitte so, daß Schnurr- und Knebelbart zu einem spitzen Zipfel nach abwärts vereinigt waren.
Der Mann, mit welchem er sprach, schien zu der ärmsten Volksklasse zu gehören. Er war barfuß. Die vielfach zerrissene und notdürftig geflickte Hose reichte ihm kaum bis über die halbe Wade. Die ebenso lädierte Jacke mochte einst blau gewesen sein, war aber jetzt ganz und gar verschossen. Um die Hüfte trug er einen zerfetzten Poncho, aus welchem der Griff eines Messers hervorblickte. In der Hand hielt er einen Strohhut, welcher alle und jede Form hatte, aber nur die ursprüngliche nicht. Sein Gesicht war tief gebräunt, die Haut desselben lederartig, und die etwas vorstehenden Backenknochen ließen vermuten, daß zum Teile indianisches Blut in seinen Adern fließe, eine Ansicht, welche durch das dunkle, schlichte, ihm lang und straff bis auf die Schulter reichende Haar bestätigt wurde.
Tupido schien meinen Eintritt gar nicht bemerkt zu haben. Er stand halb von mir abgewendet und fuhr den andern hart an:
»Schulden und immer wieder Schulden! Wann soll das einmal ausgeglichen werden! Es scheint in alle Ewigkeit nicht. Arbeitet fleißiger! Die Yerba wächst allenthalben. Sie ist überall zu finden; man braucht nur zuzugreifen. Ein Faultier wird es freilich zu nichts bringen!«
Der andere zog seine Brauen leicht zusammen, sagte aber doch in höflichem Tone:
»Ein Faultier bin ich nie gewesen. Wir haben fleißig gearbeitet, Monate lang. Wir mußten im Urwalde leben mit den wilden Tieren und wie dieselben; wir haben mit ihnen um unser Leben kämpfen müssen und sind bei Tag und Nacht an der Arbeit gewesen. Wir freuten uns auf den Ertrag unseres Fleißes und der Entbehrungen, welche wir uns auferlegten, nun aber machen Sie uns unsere Freude zu nichte, da Sie Ihr Versprechen nicht halten.«
»Das brauche ich nicht, denn die Lieferung traf um zwei Tage zu spät hier ein.«
»Zwei Tage! Sennor ist das eine so bedeutende Zeit? Haben Sie irgend einen Schaden davon?«
»Natürlich, denn wir liefern in Folge dessen auch zu spät und müssen uns also einen Abzug bis zu zwanzig Prozent gefallen lassen.«
»Soll ich das wirklich glauben?«
»Natürlich!« brauste Tupido auf. »Ihr müßt es mir Dank wissen, daß ich Euch nicht mehr als ganz dasselbe abziehe. Ich versprach Euch zweihundertvierzig Papiertaler für den Pack Tee. Zwanzig Prozent gehen ab, macht hundertzweiundneunzig, zwei Taler Schreibgebühr, bleiben hundertneunzig Papiertaler. Multipliziert damit die Zahl der Ballen, welche Ihr geliefert habt, so werdet Ihr finden, daß Ihr uns grad noch zweihundert Papiertaler schuldet. Ihr habt uns nicht den Wert des Vorschusses und Proviantes geliefert, welchen Ihr erhieltet.«
»Wenn Sie uns solche Abzüge machen, Sennor, so ist Ihre Rechnung allerdings richtig. Aber ich bitte, zu bedenken, daß ich einen Ochsen jetzt für hundert Papiertaler bekomme, wahrend Sie uns das Stück mit hundertfünfzig berechnet haben. Einen ähnlichen Aufschlag haben Sie uns bei allen übrigen Artikeln auch gemacht; da können wir nicht auf die Rechnung kommen. Anstatt Geld ausgezahlt zu erhalten, bleiben wir in Ihrer Schuld. Ich habe keinen einzigen, armseligen Peso in der Tasche. Ich soll hier für meine Gefährten einkassieren und ihnen das Geld bringen. Sie warten mit Schmerzen auf dasselbe; anstatt desselben aber bringe ich ihnen neue Schulden. Was soll daraus werden!«
»Fragt doch nicht so albern! Abarbeiten müßt Ihr es!«
»Dazu haben wir nicht länger Lust. Wir haben beschlossen, uns einen andern Unternehmer zu suchen.«
»Mir auch recht. Ich finde genugsam Teesammler, welche gern für mich arbeiten. In diesem Falle müßt Ihr aber die zweihundert Papiertaler zahlen, und zwar sofort!«
»Das kann ich nicht. Ich habe Ihnen gesagt, daß ich ohne alle Mittel bin. Und ich bitte Sie, zu bedenken, daß wir auf die bisherige Weise nie so weit kommen können, unsere Schuld abzutragen. Was Sie uns liefern, wird uns zu den höchsten Preisen angerechnet, und wenn wir die Früchte unserer schweren Arbeit, bei welcher wir fortgesetzt das Leben wagen, bringen, so gibt es regelmäßig so bedeutende Abzüge, wie der heutige ist. Wir treten aus Eurem Dienste.«
»Dagegen habe ich ja gar nichts; nur müssen die zweihundert Taler sofort bezahlt werden. Dort sitzt der Kassierer! Wer so auftreten will wie Ihr, der muß auch Geld haben!«
Der arme Teufel sah verlegen vor sich nieder. Ich fühlte Mitleid mit ihm. Er war ein Yerbatero, ein Teesammler. Ich hatte gelesen, welch ein beschwerliches und gefährliches Leben diese Leute führen. Er und seine Genossen sollten um den Lohn ihrer Arbeit gebracht und mit ihren Familien der Not überantwortet werden, nur um sie in größere Abhängigkeit von dem reichen Unternehmer zu bringen. Dieser Sennor Tupido war jedenfalls ein sehr würdiger Kompagnon meines hinterlistigen Yankees.
Der Yerbatero legte sich auf das Bitten. Er gab die besten Worte, ihm den kleinen Betrag doch nachzulassen. Vergebens.
»Das Einzige, wozu ich mich verstehen kann, ist die Gewährung einer Frist«, erklärte schließlich der harte Geschäftsmann. »Zahlt Ihr die zweihundert Pesos bis heute abend, dann gut; wenn aber nicht, so habt Ihr bis auf weiteres in meinem Dienst zu bleiben, um die Schuld abzuarbeiten. Das ist mein letztes Wort. Jetzt geht!«
Der Teesammler schlich betrübt davon. Als er an mir vorüberging, raunte ich ihm zu:
»Draußen warten!«
Er warf einen schnellen, froh überraschten Blick auf mich und ging; ich aber schritt auf den Herrn des Geschäftes zu. Er warf mir einen scharf forschenden Blick zu, kam mir dann einige Schritte entgegen, verbeugte sich sehr tief und fragte:
»Sennor, was verschafft mir die unerwartete Ehre eines mich so überraschenden Besuches?«
Es war klar, daß auch er mich für einen andern hielt. Ich antwortete in einem nicht übermäßig höflichen Tone:
»Mein Besuch ist für Sie nicht ehrenvoller, als jeder andere auch. Ich bin ein einfacher Mann, ein Fremder, der diesen Brief abzugeben hat.«
Er nahm den Brief, las die Adresse, betrachtete mich abermals und sagte mit einem diplomatisch sein sollenden Lächeln:
»Aus New York, von meinem Kompagnon! Stehen Sennor bereits mit diesem in geschäftlicher Beziehung? Es hätte mich unendlich gefreut, vorher von Ihnen durch einen Avis unterrichtet zu werden.«
»Als ich Ihren Kompagnon zu ersten Male sah, wußte ich von Ihnen gar nichts.«
Das machte ihn doch in seiner Überzeugung irre. Er schüttelte den Kopf, brach den Brief auf, ohne zu bemerken, daß das Siegel vorher verletzt worden war, und las ihn. Sein Gesicht wurde länger und immer länger; sein Blick flog zwischen mir und den Zeilen herüber und hinüber. Endlich faltete er ihn wieder zusammen, steckte ihn in die Tasche und sagte:
»Höchst sonderbar! Sie sind also wirklich ein Deutscher? Derjenige, von welchem dieses Empfehlungsschreiben handelt?«
»Ich darf allerdings vermuten, daß in diesem Brief von mir die Rede ist.«
»Sie werden mir in demselben auf das allerwärmste empfohlen, und ich stelle mich Ihnen in jeder Beziehung zu Verfügung.«
»Danke sehr, Sennor! Doch ist es nicht meine Absicht, Ihnen Mühe zu bereiten.«
»O bitte, von Mühe kann gar keine Rede sein! Sie sahen mich gewissermaßen erstaunt. Das war infolge einer ganz bedeutenden Ähnlichkeit, welche Sie mit einem in den bessern Kreisen sehr bekannten Herrn besitzen.«
»Darf ich erfahren, wer dieser Herr ist?«
»Gewiß. Ich meine nämlich Oberst Latorre, von welchem Sie vielleicht gehört oder gelesen haben.«
»Ich kenne allerdings den Namen dieses Offiziers, an welchen sich gewisse Zukunftshoffnungen zu knüpfen scheinen. Seien Sie versichert, daß meine Ähnlichkeit mit ihm nur eine äußerliche ist. Ich bin ein einfacher Tourist und besitze weder für Politik noch für Kriegskunst die geringste Lust oder gar Begabung.«
»Das sagt Ihre Bescheidenheit. Mein Kompagnon teilt mir mit, daß Sie sich Jahre lang bei den Indianern befunden haben: eine Art kriegerischen Sinn müssen Sie also doch besitzen. Hoffentlich habe ich das Vergnügen, von den Abenteuern zu hören, welche Sie erlebt haben. Würden Sie mir die Ehre erweisen, heute abend bei mir das Essen einzunehmen?«
»Ich stehe ganz zu Ihrer Verfügung.«
»So bitte ich Sie, sich um acht Uhr in meiner Privatwohnung einzustellen, welche Sie auf dieser Karte verzeichnet finden. Kann ich Ihnen für jetzt noch in etwas dienen?«
»Ja, wenn ich bitten darf. Ich möchte Ihnen dieses Papier zustellen.«
Ich nahm seine Visitenkarte und gab ihm den Sichtwechsel. Er prüfte denselben, schrieb einige Ziffern auf den Zettel und stellte mir denselben mit den Worten zu:
»Dort ist die Kasse, Sennor. Für jetzt empfehle ich mich Ihnen; aber auf Wiedersehen heute abend!«
Er wendete sich ab, um durch eine Türe zu verschwinden, der durchtriebene Kerl. Ein Blick auf den Zettel genügte, mich zu überzeugen, daß ich geprellt werden sollte.
»Sennor!« rief ich ihm nach. »Bitte, nur noch für einen Augenblick!«
»Was noch?« fragte er, sich wieder herumdrehend. Sein Gesicht hatte alle Freundlichkeit verloren, und seine Stimme klang scharf und befehlend.
»Es ist da wohl ein kleiner Irrtum unterlaufen. Der Wechsel lautet auf eine höhere Summe.«
»Sie vergessen höchst wahrscheinlich die Diskontogebühr?«
»Sie kann nicht vergessen werden, da von einem Diskontieren überhaupt keine Rede ist. Sie ziehen mir fünf Prozent ab, während der Wechsel auf Sicht, nicht aber auf ein späteres Datum lautet.«
»Dieser Abzug ist hier Usus.«
»Ein Teesammler mag sich nach Ihren persönlichen Gepflogenheiten richten müssen, weil er sich in Ihrer Gewalt befindet; ich aber habe das nicht nötig. Ihr Kompagnon hat diesen Wechsel nicht mir zu Gefallen akzeptiert, sondern ich habe die Summe voll bei ihm einbezahlt und verlange sie also ebenso voll zurück, wobei ich übrigens ohnedies einen Zinsenverlust zu tragen habe.«
»Ich zahle nicht mehr.«
»So behalten Sie Ihr Geld und geben Sie mir meinen Wechsel zurück!«
»Der befindet sich in meiner Verwahrung, und Sie haben dafür die Anweisung an die Kasse erhalten. Folglich ist der Wechsel mein Eigentum.«
»Ich lege Ihnen die Anweisung hier auf den Tisch zurück, da ich keinen Gebrauch von ihr machen werde.«
»Tun Sie das, wie Ihnen beliebt. Der Wechsel aber ist honoriert und bleibt in meiner Hand!«
»Lange Zeit jedenfalls nicht, denn ich werde zwar jetzt gehen, aber binnen fünf Minuten mit dem Polizeimeister zurückkehren. Bis dahin empfehle ich mich Ihnen!«
Ich machte ihm eine kurze Verbeugung und wendete mich zum Gehen. Seine Untergebenen hatten ihre Federn weggelegt und der Szene mit Spannung zugesehen. Schon hatte ich die Türe in der Hand, da rief er mir nach:
»Halt, Sennor! Bitte, eine Sekunde!«
Der Mann hatte Angst vor der Polizei bekommen. Sein geschäftlicher Ruf konnte Schaden erleiden, und überdies war, wenn er mich gehen ließ, von der Ausführung des beabsichtigten Planes keine Rede. Er zog den Empfehlungsbrief nochmals hervor und tat, als ob er ihn jetzt genauer durchlese. Dann sagte er in der früheren höflichen Weise:
»Ich habe allerdings um Verzeihung zu bitten. Mein Kompagnon schreibt mir am Schlusse, den ich vorhin leider übersah, daß Sie die Summe voll ausgezahlt erhalten und wir aus Rücksicht auf Sie in diesem Falle von unserm Usus absehen sollen. Ich werde Ihnen also den ganzen Betrag notieren. Sind Sie dann zufrieden gestellt?«
Ich nickte nachlässig.
»Vergessen wir die kleine, unangenehme Differenz, Sennor«, sagte er. »Ich darf doch für heute abend bestimmt auf Sie rechnen?«
»Gewiß! Vorausgesetzt allerdings, daß es in Ihrer Häuslichkeit nicht auch einen Usus gibt, gegen den ich protestieren müßte.«
»O, nein, nein, nein!« stieß er mit freundlichem Gesicht, aber mit vor Wut heiserer Stimme hervor und verschwand durch seine Türe.
Ich erhielt mein Geld, steckte es ein, dankte, grüßte und ging. Draußen sah ich den armen Yerbatero gegenüber an der Ecke stehen. Ich ging auf ihn zu und forderte ihn auf, für kurze Zeit mit mir zu kommen.
In Montevideo gibt es keine Restaurationen in unserm Sinne. Die Kaffeehäuser taugen nicht viel, ganz abgesehen davon, daß man da nicht Kaffee, sondern Matte, das ist Paraguaytee zu trinken bekommt. Besser sind die sogenannten Confiterias, in denen man feines Gebäck, Eis und dergleichen genießt.
In den Gasthäusern zahlt man für Wohnung und Beköstigung ohne den Wein fünfzig Papiertaler täglich. Das klingt sehr viel, beträgt aber nur acht Mark, da so ein papierener Peso ungefähr sechzehn deutsche Pfennig gilt. Die Flasche Bier kostet sechs Taler, also fast eine Mark. Dem Haarschneider zahlt man ›zehn Taler‹; für ein fingerhutgroßes Gläschen Rum habe ich ›drei Taler‹; bezahlt. So entwertet war damals das Papiergeld. Man mußte in den La Plata-Staaten damals sehr vorsichtig sein, wenn man mit den verschiedenen Arten minderwertigen Papiergeldes nicht, selbst im täglichen Leben. bedeutend verlieren wollte. Die Eingeborenen beuteten die Unkenntnis des Fremden in geradezu abscheulicher Weise aus.
In eine der Confiterias führte ich den Teesammler.
Das Lokal war voller Gäste, welche ihrer Kleidung nach zu den besten Ständen gehörten. Der Yerbatero zog aller Augen auf sich; aber was machte ich mir daraus! Man schob sich so weit von uns zurück, daß wir Platz für fünf oder sechs Personen gehabt hätten. Das war sehr bequem für uns, und es fiel uns also gar nicht ein, ihnen darüber zu zürnen.
Keineswegs aber kann ich sagen, daß der Teesammler sich etwa unanständig benommen hätte. Sein Anzug paßte nicht zu denen der anderen; aber in Beziehung auf sein Betragen, seine Bewegungen uswù war er ganz der Caballero, welcher jeder, der ein wenig spanisches Blut in seinen Adern hat, wenigstens äußerlich zu sein pflegt. In dieser Beziehung gleicht der Südamerikaner ganz und gar nicht dem Angehörigen der sogenannten Volksklasse europäischer Länder. Der erstere ist, selbst in Lumpen gehüllt, stets von einem ritterlichen Benehmen. Der letztere aber hat so viele Ecken und Schroffheiten in allen seinen Bewegungen, daß man in ihm, selbst wenn er Generalsuniform trüge, doch den gewöhnlichen Arbeiter unfehlbar erkennen würde.
Sein bärtiges Gesicht war interessant zu nennen. Die Wimpern waren meist bescheiden gesenkt, aber wenn sie sich erhoben, so entschleierten sie ein klares, scharfes, durchdringendes Auge, dessen Blick auf Selbstbewußtsein und Charakterstärke schließen ließ. Der Mann schien zwei ganz verschiedene Naturen in sich zu vereinigen, den unterdrückten, demütigen Arbeiter und den mutigen, besonnenen Pampas- und Urwaldläufer, welcher, wenn es nötig war, auch einen hohen Grad von Schlauheit entwickeln konnte.
Er wählte sich unter den vorhandenen Süßigkeiten das ihm Beliebende mit einer Miene aus, als ob er seit frühester Jugend in so angenehmen Lokalen verkehrt habe. Er genoß es mit der Eleganz einer Dame, der so etwas geläufig ist, und verriet durch keine Miene, daß ich derjenige sei, welcher schließlich bezahlen werde. Dabei sagte er in der ihm eigen scheinenden Weise, in wohlgesetzten Worten zu sprechen:
»Sennor haben mir einen Wink gegeben, auf Sie zu warten. Ich habe gehorcht und bin nun bereit, Ihre Befehle zu vernehmen.«
»Ich beabsichtige nicht, Ihnen Befehle zu erteilen«, antwortete ich. »Es ist vielmehr eine Bitte, welche ich Ihnen vorlegen möchte. Ich war Zeuge des Schlusses Ihrer Unterredung mit Sennor Tupido. Ich entnehme aus dem Gehörten, daß Sie sich in einer abhängigen Lage von diesem Herrn befinden?«
»Hm! Vielleicht!« antwortete er mit der lächelnden Miene eines Mannes, welcher, ohne sich zu schaden, tausend Taler verschenken kann.
»Zugleich hörte ich, daß Sie durch den Besitz von zweihundert Papiertalern im Stande sein würden, sich aus dieser Knechtschaft zu befreien. Würden Sie mir nun gestatten, Ihnen diese Summe zur Verfügung zu stellen?«
Er blickte mich groß an. Der Betrag war zwar nicht bedeutend, nur zweiunddreißig Mark nach deutschem Gelde, aber für einen armen Teesammler doch wohl nicht gering. Die Lage des Mannes hatte meine Teilnahme erregt, und einem glücklichen Instinkte folgend, wollte ich ihm das Geld schenken, obgleich ich selbst keineswegs ein wohlhabender Mann war.
»Ist das Ihr Ernst, Sennor?« fragte er. »Welchen Zweck verfolgen Sie dabei?«
»Keinen andern als nur den, Sie in den Besitz Ihrer geschäftlichen Selbstständigkeit zu bringen.«
»Also Mitleid?«
»Nein, sondern Teilnahme. Das Wort Mitleid hat eine Nebenbedeutung, welche nicht geeignet sein würde für den caballeresken Eindruck, welchen Sie auf mich machen.«
Sein Gesicht, welches sich verfinstert hatte, erhellte sich.
»Sie halten mich also trotz meiner Armut für einen Caballero?« fragte er. »Aber wie stimmt ein Almosen mit dem Worte Caballero überein?«
»Von einem Almosen ist keine Rede.«
»Also ein Darlehen?«
»Wenn Sie es so nennen wollen, ja. Werden Sie dasselbe annehmen?«
»Vielleicht, vielleicht auch nicht. Welche Bedingung stellen Sie?«
»Sie verzinsen mir die Summe zu drei Prozent. Kündigung ist auf ein Jahr. Jeder von uns beiden hat bei unsrer nächsten Begegnung das Recht, zu kündigen, worauf Sie das Geld nach Ablauf eines Jahres an mich zu entrichten haben.«
»Und wenn wir uns nicht wieder treffen?«
»So behalten Sie es oder schenken es nach fünf Jahren einem Manne, welcher ärmer ist als Sie.«
Da streckte er mir die Hand entgegen, drückte die meine in herzlichster Weise und sagte:
»Sennor, Sie sind ein braver Mann. Ich nehme Ihr Darlehen mit Vergnügen an und weiß, daß Sie keinen Peso verlieren werden. Darf ich fragen, wer und was der fremde Sennor ist, welcher sich so freundlich meiner annimmt?«
Ich gab ihm meine Karte.
»Ein Alemano!« sagte er im Tone der Freude, als er den Namen gelesen hatte. »Nehmen Sie auch die meinige, Sennor!«
Er langte in seine zerfetzte Jacke, zog aus derselben ein sehr feines, kunstvoll gesticktes Visitenkartentäschchen hervor und gab mir aus demselben eine Karte. Auf derselben stand:
»Sennor Mauricio Monteso, Guia y Yerbatero.«
Also Fremdenführer und Teesammler war er. Das schien ein guter Fund für mich zu sein.
»In welchen Gegenden seid Ihr bewandert, Sennor?« fragte ich ihn. »Ich will nach Santiago und Tucuman und stand im Begriff, mich nach einem zuverlässigen Führer zu erkundigen.«
»Wirklich? Dann werde ich Ihnen einen meiner besten Freunde empfehlen. Er ist ein Mann, auf welchen Sie sich vollständig verlassen können, kein Arriero, dessen Sinn einzig nur dahin steht, den Fremden nach Kräften auszunützen.«
»Sie selbst haben wohl nicht Lust oder Zeit, den Auftrag anzunehmen?«
Er sah mich freundlich prüfend an und fragte dann:
»Hm! Sind Sie reich, Sennor?«
»Nein.«
»Und dennoch borgen Sie mir Geld! Darf ich fragen, was Sie da drüben wollen? Sie gehen doch nicht etwa als Goldsucher oder aus andern spekulativen Gründen nach Argentinien?«
»Nein.«
»So, so! Will es mir überlegen. Wann aber wollen Sie hinüber?«
»So bald wie möglich.«
»Da werde ich wohl nicht können, denn ich habe noch einiges abzumachen, was nicht aufgeschoben werden darf. Übrigens befindet sich der Freund, den ich Ihnen empfehlen will, auch nicht hier. Ich müßte Sie zu ihm führen, und das ist ein weiter Weg ins Paraguay hinein. Dieser Umweg würde sich aber gewiß lohnen, denn er ist ein Mann, an den kein zweiter kommt, der berühmteste und gewandteste Sendador, den es nur geben kann. Wollen Sie sich die Sache nicht wenigstens überlegen? Sie kommen trotz des Umweges mit ihm weit eher und wohlbehaltener ans Ziel, als mit einem Führer, mit welchem Sie sofort aufbrechen können, dessen Unkenntnis Ihnen aber bedeutende Zeit- und auch andre Verluste bereiten würde.«
»Wann und wo kann ich Sie treffen, um Ihnen meinen Entschluß mitzuteilen?«
»Eigentlich wollte ich nur bis morgen hier bleiben; aber ich will noch einen Tag zulegen. In meine Herberge mag ich Sie nicht bemühen; lieber komme ich zu Ihnen.«
»Schön! Kommen Sie morgen am Mittag nach dem Hotel Oriental, wo Sie mich in meinem Zimmer treffen werden. Ich glaube, bis dahin eine Entscheidung getroffen zu haben.«
»Ich werde mich pünktlich einstellen, Sennor. Darf ich fragen, ob Sie mit Sennor Tupido in geschäftlicher Verbindung stehen?«
»Das ist nicht der Fall. Ich gab ein Empfehlungsschreiben ab.«
»Hat er Sie eingeladen?«
»Ja. Für heute abend acht Uhr in seine Privatwohnung.«
»Die kenne ich. Sie befindet sich auf der Straße, welche nach La Union führt. Es ist eine kleine, prächtige Villa, welche Ihnen sehr gefallen wird. Leider möchte ich bezweifeln, daß die Bewohner Ihnen ebenso gefallen.«
»Wenn sie dem Sennor ähneln, so werde ich mich bei ihnen nicht übermäßig amüsieren.«
»So! Hm! Seine Person hat also auch Ihnen nicht behagt?«
»Gar nicht. Es kam sogar zu einem kleinen Zusammenstoße zwischen ihm und mir.«
Er hatte während der letzten Minuten den Blick meist draußen auf der Straße gehabt, als ob er dort nach etwas forsche. Da ich mit dem Rücken nach dieser Richtung saß, konnte ich nicht sehen, was seine Aufmerksamkeit so sehr in Anspruch nahm. Jetzt fuhr er im Tone der Besorgnis auf:
»Caramba! Haben Sie ihn etwa dabei beleidigt?«
»Einige scharfe Worte hat es gegeben, aber von einer eigentlichen, wirklichen Beleidigung ist wohl keine Rede.«
»Und Sie werden trotz der Differenz, welche Sie mit ihm hatten, zu ihm gehen?«
»Ja. Warum nicht?«
»Tun Sie es immerhin! Aber nehmen Sie sich in acht! Man vergißt Beleidigungen hier nicht so leicht. Die Rache trägt zuweilen ein außerordentlich freundliches Gesicht.«
»Haben Sie Grund zu dieser Warnung?«
»Ich vermute es. Bitte, drehen Sie sich doch einmal um! Sehen Sie den Mann, welcher grad gegenüber an der Gittertüre lehnt?«
Der Mensch, welchen der Yerbatero meinte, stand vis-a-vis am verschlossenen Eingange des Hauses, ganz in der nachlässigen Haltung eines Mannes, dessen einzige Absicht es ist, zu seiner Unterhaltung das Treiben der Straße zu beobachten. Er war in Hose, Weste und Jacke von dunklem Stoffe gekleidet, trug einen breitrandigen Sombrero auf dem Kopfe und rauchte mit sichtbarem Behagen an einer Zigarette.
»Ich sehe den Mann«, antwortete ich. »Kennen Sie ihn?«
»Ja. Er ist bekannt als einer der verwegensten Agenten für gewisse Geschäfte, bei denen es auf einige Unzen Blut nicht ankommt. Er beobachtet Sie.«
»Nicht möglich!«
»Bitte! Ich sage es Ihnen, und Sie können es glauben. Als ich an der Ecke der Plaza de la Independencia auf Sie wartete, bemerkte ich ihn, daß er ebenso stand wie jetzt, scheinbar ganz unbefangen, aber den Blick doch scharf auf das Geschäftshaus von Sennor Tupido gerichtet. Als Sie aus demselben traten, ging er uns nach und stellte sich da drüben auf. Mir kann seine Aufmerksamkeit unmöglich gelten, folglich gilt sie Ihnen.«
»Vielleicht irren Sie sich doch. Es ist nur ein Zufall, daß er in gleicher Richtung mit uns ging.«
»Und auch Zufall, daß er sich da drüben aufstellte? Nein. Solche Zufälle gibt es hier nicht. Beobachten Sie ihn unbemerkt, wenn Sie von hier fortgehen, und Sie werden ganz gewiß sehen, daß er es auf Sie abgesehen hat. Sagen Sie mir morgen wieder, ob ich Recht gehabt habe oder nicht. Ich bitte Sie wirklich, meine Beobachtung zu beherzigen.«
»Aber, Sennor, wenn es sich wirklich um eine Rache handelt, so muß ich doch sagen, daß ich Tupido nicht in der Weise beleidigt habe, daß er mir einen Bravo auf den Hals schicken könne.«
»Vielleicht nennt man in Ihrem Vaterlande eine Beleidigung geringfügig, welche hier nur mit Blut abzuwaschen ist. Sie haben es mit Abkömmlingen der alten Spanier zu tun, was Sie ja nicht vergessen dürfen. Oder gibt es außer Tupido vielleicht einen andern, dessen Zorn Sie erregt haben?«
»Schwerlich! Einen sehr komischen Sennor, dessen Besuch ich empfing und welcher mir bei seinem Fortgehen allerdings sogar mit der Faust drohte, kann ich unmöglich zu den gefährlichen Leuten zählen.«
»Hm! Was nennen Sie komisch, und was nennen Sie gefährlich? Kennen Sie den Namen des betreffenden Mannes?«
»Er nannte sich Esquilo Anibal Andaro.«
»Lieber Himmel! Der ist gar kein komischer Mann. Der ist einer der eingefleischtesten Blancos, die es gibt. Ihm ist alles, alles zuzutrauen. Ich kenne ihn, ich kenne ihn! Wenn Sie mir doch anvertrauen wollen, welchen Zweck sein Besuch hatte und wie derselbe abgelaufen ist!«
Ich erzählte ihm das kleine, mir lustig vorkommende Abenteuer meiner Verwechslung mit dem Obersten Latorre. Die Miene des Yerbatero wurde immer ernster. Er sagte, als ich geendet hatte:
»Sennor, ich wette, daß dieser Andaro Ihnen den Bravo zum Aufpasser gegeben hat. Nehmen Sie sich in acht, und gehen Sie nicht ohne Waffen aus!«
»Kennen Sie den Obersten auch?«
»Ich habe ihn noch nie gesehen, sonst würde Ihre Ähnlichkeit mit ihm auch mir aufgefallen sein. Aber ich weiß, daß es eine Partei gibt, welche große Hoffnungen auf ihn setzt. Daß Sie in Ihrem Äußeren eine solche Ähnlichkeit mit ihm besitzen, kann, wie Sie sehen, unter Umständen bedenklich für Sie werden. Kein Parteigänger ist hier seines Lebens sicher, und wenn man Sie für einen solchen hält, so kann sich leicht eine Kugel oder ein Messer zu Ihnen verirren.«
»Das ist einerseits fatal, andererseits aber hoch interessant.«
»Ich danke für das Interessanteste, wenn es möglich ist, daß ich es mit dem Leben bezahlen muß! Wie nun, wenn dieser Esquilo Anibal Andaro Ihnen nach dem Leben trachtet, weil er Sie für Latorre hält?«
»Das ist geradezu unmöglich.«
»Meinen Sie? Warum?«
»Weil beide zu einer und derselben Partei gehören. Er kam ja doch, um Latorre ein Geschäft anzubieten!«
»Daran glaube ich nicht.«
»Aber, Sennor, er hat es ja doch mir angeboten, weil er mich für den Obersten hielt!«
Über sein Gesicht glitt ein außerordentlich pfiffiges Lächeln.
»Man merkt es, daß Sie ein Bücherwurm sind«, sagte er. »Im Leben geht es weit anders zu als in Ihren Büchern. Latorre gehört nämlich nicht zur Partei Ihres Sennor Andaro, den Sie komisch nennen. Er hält zwar sehr mit seiner eigentlichen Meinung zurück, denn er ist nicht nur ein kühner, sondern auch ein vorsichtiger Mann; aber man weiß doch ziemlich genau, daß er zu den Roten hält und nicht zu den Weißen.«
»Warum aber trägt ihm Andaro ein Geschäft an?«
»Zum Schein nur, um ihn blamieren zu können. So wenigstens denke ich mir. Denken Sie sich doch das Aufsehen, wenn die Blancos sagen könnten: Wir haben eine Unterschrift Latorres, mit welcher er bestätigt, daß er von uns fünftausend Pesos erhalten hat, damit wir ihm die Waffen zum Aufstande liefern! Er hätte sich dadurch für alle Zeit unmöglich gemacht.«
»Ah, jetzt durchschaue ich diesen Andaro.«
»Entweder hält er Sie für Latorre und ärgert sich darüber, daß Sie sich nicht auf seine Leimrute gesetzt haben, oder er hat eingesehen, daß Sie wirklich ein anderer sind, und ärgert sich nun, einem Fremden Einblick in seine Pläne gewährt zu haben, was für ihn und seine Partei gefährlich werden kann, wenn Sie Latorre davon benachrichtigen. In beiden Fällen haben Sie nichts Gutes von ihm und den Blancos zu erwarten. Es muß ihnen daran liegen, Sie am Sprechen zu hindern. Und womit erreicht man das am sichersten? Beantworten Sie sich diese Frage selbst!«
»Wollen Sie mir wirklich Sorge machen, Sennor Monteso?«
»Ja, das will ich. Der Bravo steht nicht zum Scherze so lange da drüben. Darauf können Sie sich wohl verlassen. Ich kenne die hiesigen Verhältnisse besser als Sie.«
»So wäre ich ja gleich mit meinem ersten Sprunge an dieses schöne Land in ein Loch geraten, in welchem ich sehr leicht stecken bleiben kann!«
»Dieser Vergleich ist sehr richtig. Steigen Sie schnell heraus, und laufen Sie davon! Ich meine es gut mit Ihnen. Damit aber will ich nicht etwa sagen, daß Sie gleich heute von hier aufbrechen sollen. Nehmen Sie sich nur vor dem Bravo und andern Fallen in acht, welche man Ihnen legen könnte. Ich bin überzeugt, daß Sie bis morgen mittag, wo ich zu Ihnen komme, irgend etwas erlebt haben werden. Da sollte es mich freuen, zu erfahren, daß meine Warnung nicht unbeachtet geblieben ist.«
»Ich werde sie mir zu Herzen nehmen, Sennor. Und da ich sehe, daß Sie gehen wollen, so erlauben Sie mir, Ihnen die zweihundert Peso jetzt auszuzahlen.«
Ich schob ihm fünf Diez Pesos Fuertes zu. Er wickelte sie zusammen und steckte sie mit einer Miene in die Westentasche, als ob es nur ein Stückchen Zigarettenpapier sei. Dann reichte er mir die Hand, machte mir eine höflich vertrauliche Verbeugung und entfernte sich.
Jetzt nahm ich seinen Platz ein, um den Bravo beobachten zu können. Dieser musterte den aus der Türe tretenden Yerbatero mit einem kurzen Blicke und machte dann eine ungeduldige Bewegung. Nach einer Weile entfernte auch ich mich. Dabei tat ich so, als ob ich den Menschen gar nicht bemerkte. Ich schritt durch mehrere Straßen, blieb an verschiedenen Schaufenstern stehen und überzeugte mich, daß der Mann mir allerdings unausgesetzt folgte.
So verging wohl eine Stunde, und die Dämmerung machte sich bemerkbar. Glockenton machte mich darauf aufmerksam, daß ich mich in der Nähe der Kathedrale befand. Auf meine Erkundigung erfuhr ich, daß man sich jetzt zum täglichen Ave Maria de la noche in die Kirche begebe, und ich schloß mich den gebetsbedürftigen Leuten an.
Der hehre, lichtdurchflossene Raum war von so vielen Gläubigen besucht, daß die Gemeinden mancher europäischen Hauptstädte sich ein Beispiel daran nehmen könnten. Ein gemischter Chor mit Orgelbegleitung tönte von dem Chore herab. Die Sänger waren ziemlich gut geschult, aber der Organist war ein Spieler fünften oder sechsten Ranges. Er verstand das Registrieren nicht und griff sogar sehr häufig fehl.
Die Orgel ist mein Lieblingsinstrument. Ich stieg hinauf, um mir den Mann, welcher die weihevolle Komposition von Palestrina so verdarb, einmal anzusehen. Der Kantor stand dirigierend vorn am Pulte. Der Organista war ein kleines, dünnes, bewegliches Männchen, dessen Gestalt unter den mächtigen Prospektpfeifen noch kleiner erschien, als sie war. Als er sah, daß ich, an der Ecke des Orgelgehäuses lehnend, ihn beobachtete, kam ihm sichtlich die Lust, mir zu imponieren. Er zog schleunigst Prinzipal und Kornett und einige sechzehnfüßige Register dazu. Das gab natürlich einen Lärm, welcher die Vokalstimmen ganz verschlang. Dennoch erhielt er von dem Dirigenten keinen Wink. Das Kirchenstück wurde in dieser Weise bis zu Ende gesungen.
Dann kam ein kurzes Vorspiel, welches aus einem verunglückten Orgeltrio auf zwei Manualen und dem Pedal bestand und in eine mir so bekannte und liebe Melodie leitete. Leider aber hatte der Organista oben Vox angelica, Vox humana, Äoline und Flauta amabile gezogen und dazu für die Bässe die tiefsten und stärksten Register, so daß die schöne Melodie wie ein Bächlein im Meere der Bässe verschwand.
Das konnte ich unmöglich aushalten. Mochte der biedere Orgelschläger mich meinetwegen dafür mit ewiger Blutrache verfolgen, ich huschte zu ihm hin, schob die volltönenden Stimmen hinein und registrierte anders. Er blickte mich erst erstaunt und dann freundlich an. Mein Arrangement schien ihm besser zu gefallen als das seinige.
Nach dem dritten Verse trat der Predicador zum Altare, um ein Gebet vorzulesen. Dies benutzte der Organista zu der leisen Frage an mich:
»Spielen Sie auch die Orgel, Sennor?«
»Ein wenig«, antwortete ich ebenso leise.
Sein kleines, dünnes Gesicht glänzte vor Freude.
»Wollen Sie?« nickte er mir einladend zu.
»Welche Melodie?«
»Ich schlage sie Ihnen auf und das Gesangbuch dazu. Es sind nur drei Verse. Sind Sie hier bekannt?«
»Nein.«
»So winke ich Ihnen, wenn Sie anfangen sollen. Erst ein schönes, liebliches Vorspiel; dann die Melodie recht kräftig mit leisen Zwischenspielen und endlich nach dem dritten Verse eine Fuga mit allen Stimmen und Contrapunkto. Wollen Sie?«
Ich nickte, obgleich er mehr verlangte, als in meinen Kräften stand. Eine Fuge und Orgelpunkt!
Ich zog die sanften Stimmen zu dem ›schönen, lieblichen Vorspiel‹, und da war auch schon das Gebet zu Ende, der Segen erteilt, und der Organista stieß mich mächtig in die Seite, was zweifelsohne der Wink sein sollte, den er mir hatte geben wollen. Ich begann.
Wie ich gespielt habe, das ist hier Nebensache. Ich bin keineswegs ein fertiger Spieler, und ob mein ›Contrapunkt‹ Gnade vor einem Kenner gefunden hätte, bezweifle ich mit vollstem Recht. Aber man war die Kunst des kleinen Organista gewöhnt, und so fiel mein Spiel auf. Im Schiffe der Kirche standen nach dem Gottesdienste die Leute noch alle und oben der Kantor, der Organista und sämtliche Sänger um mich her. Ich mußte noch eine Fuge zugeben und erklärte aber dann, daß ich fort müsse. Der Organista legte sein Ärmchen in meinen Arm und schien sich meiner bemächtigen zu wollen. Er führte mich unten durch die neugierig wartende Menge und erklärte, als wir vor der Kathedrale anlangten, daß ich unbedingt mit ihm gehen und zu Abend bei ihm speisen müsse.
»Das ist unmöglich, Sennor«, antwortete ich, »denn ich bin bereits geladen.«
»Zu wem?«
Ich sagte es ihm.
»So darf ich Sie freilich nicht belästigen. Dafür aber müssen Sie mir die Ehre erzeigen, morgen das Frühstück bei mir einzunehmen. Wollen Sie?«
»Mit Vergnügen.«
»Ich verlasse mich darauf, Sie zehn Uhr bei mir zu sehen. Dann spielen wir miteinander vierhändig und vierbeinig Orgel. Ich habe prächtige Noten dazu. Und zu Mittag essen wir auch bei mir.«
»Um diese Zeit bin ich bereits in Anspruch genommen.«
»Tut nichts, Sennor. Das wird sich wohl ändern lassen. Ich gehe mit zu dem, der Sie in Anspruch nehmen will, und bitte Sie los. Ich kenne Ihren Namen noch nicht, aber wir sind Brüder in organo und werden einander lieb gewinnen.«
»Hier ist meine Karte!«
»Danke! Von mir habe ich keine mit. Ist auch nicht nötig. Ich will von Ihnen das Registrieren lernen, denn, unter uns gesagt, ich ziehe stets die verkehrten Stimmen. Man muß auf die Hände und Füße Acht geben und auf Noten und Gesangbuch sehen. Wie kann man da eigentlich noch an die Register denken! Das ist mir unbegreiflich. Ich werde es Ihnen hoffentlich ablauschen. Übrigens, wenn Sie nach der Quinta des Sennor Tupido wollen, so gehen wir miteinander. Meine Wohnung liegt nur ein wenig abseits Ihres Weges.«
Er zog mich mit sich fort und beschrieb mir die Lage der Quinta so genau, daß ich sie mit geschlossenen Augen hätte finden können.
Indessen war es natürlich Abend geworden, ein wunderbar schöner, südamerikanischer Frühlingsabend. Der Mond schien fast voll auf den blinkenden Marmor der Häuser nieder, an denen wir vorüberkamen, und der aus den Gärten und Höfen aufsteigende Blumenduft lag erquickend in der Luft.
Wir ließen den belebteren Teil der Stadt hinter uns, denn der Organista wohnte draußen ›im Grünen‹, wie er sich ausdrückte. Rechts und links gab es Villen. Ich hatte nicht mehr fünf Minuten bis zur Quinta Tupidos zu gehen. Da lenkte mein Begleiter oder vielmehr Führer in einen ziemlich schmalen Weg ein, der zwischen zwei Landhäusern hindurch führte.
»Wohin?« fragte ich.
»Nach meiner Wohnung. Wir müssen wenigstens ein Glas Wein trinken, wenn Sie keine Zeit haben, mit mir zu speisen. Ich habe Sie ebenso schnell wie herzlich lieb gewonnen. Mein Domicilio liegt gleich hinter diesen zwei Gärten, zwischen denen wir jetzt gehen!«
»Gut, so begleite ich Sie bis an Ihre Türe, an welcher ich mich von ihnen verabschiede. Morgen früh zehn Uhr sehen wir uns ja sicher wieder.«
Bald waren die Gärten zu Ende, und dann standen wir vor einem kleinen Häuschen, welches an seiner niedrigen Außenseite keine Fenster, sondern nur eine Türe hatte. Während wir da, uns verabschiedend, noch einige Worte wechselten, war es mir, als ob ich Schritte hörte. Das leise Geräusch kam von dem Gange her, durch welchen wir soeben gekommen waren. Ich blickte hin.
Ein Sombrero ragte hinter der Ecke der Gartenmauer hervor. Unter diesem Hut mußte ein Kopf, ein Mensch stecken. Der Mann sah, daß er bemerkt worden war. Ein Zurückweichen hätte seiner Absicht nur geschadet, denn es mußte unsern Verdacht erregen; darum wählte er das in dieser Lage beste und trat hervor. Es war der Bravo, vor welchem ich von dem Yerbatero gewarnt worden war.
»Wer ist da? Was wollen Sie, Sennor?« fragte der Organisto in ziemlich kleinlauter Weise. Er war ein winziges Männchen und schien auch kein großer Held zu sein.
Der Gefragte trat um einige Schritte näher, doch so, daß trotz des Mondscheines sein Gesicht unter der breiten Krempe des Hutes so im Dunkeln lag, daß die Züge nicht erkannt werden konnten. Ich war augenblicklich überzeugt, daß es sich um einen Angriff auf mich handle.
»Pardon, Sennores!« antwortete er. »Ich suche die Wohnung des Sennor Arriquez, und man hat mich hierher gewiesen.«
Die Stimme war unbedingt verstellt. Der Mann stand noch drei Schritte von mir entfernt und steckte die Hand in die Tasche.
»Hier wohnt kein Sennor Arriquez«, antwortete der Organista. »Man hat Sie falsch gewiesen.«
Jener trat noch einen Schritt näher; ich aber wendete mich rasch zur Seite, so daß ich wieder drei Schritte zwischen uns legte und den Mond hinter mich bekam. Nun konnte mir die kleinste seiner Bewegungen nicht entgehen.
»Einen Sennor dieses Namens kenne ich nicht«, meinte der Organista kopfschüttelnd. »Vielleicht hat man Ihnen nicht nur eine falsche Wohnung, sondern auch einen falschen Namen genannt.«
»Das glaube ich nicht. Ich meine den fremden Sennor, welcher Orgel gespielt hat.«
»Ah, der steht hier. Aber auch er heißt nicht Arriquez, sondern – –«
Er hielt meine Karte, welcher er noch in der Hand hatte, dem Monde entgegen, um den Namen zu lesen. Dies benutzte der Bravo, indem er sich schnell auf mich warf. Er hatte ein Messer aus der Tasche gezogen. Ein Glück für mich, daß ich gewarnt worden war! Zwar hätte sein Benehmen auf alle Fälle meinen Verdacht erweckt, aber so ganz heiler Haut, wie jetzt, wäre ich wahrscheinlich doch nicht davongekommen. So aber trat ich einen Schritt zur Seite. Die blinkende Klinge zuckte an mir vorüber, und der Kerl bekam von mir einen Fausthieb an den Kopf, daß er taumelte. Gleich hatte ich ihn mit der Linken beim Genick und schlug ihm die Rechte von unten an den Ellbogen, so daß ihm das Messer aus der Hand flog. Dann schleuderte ich ihn gegen die Mauer des Hauses; er sank dort nieder und blieb liegen. Das alles war das Werk nur weniger Augenblicke.
Dem guten Organista war vor Schreck die Karte entfallen. Er stammelte etwas ganz Unverständliches, rang die Hände und schnappte nach Atem; dann aber erhielt er die Sprache zurück und schrie aus Leibeskräften:
»O Unglück, o Traurigkeit! Zu Hilfe, zu Hilfe!«
»Schweigen Sie doch, Sennor!« gebot ich ihm. »Es ist nicht die geringste Gefahr vorhanden.«
»Das ist Verblendung, Herr! Es sind ja Mörder hier! Solche Leute haben stets Helfershelfer bei sich. Wir müssen fort; wir müssen fliehen! Aber wohin, wohin? Was tue ich doch nur? Was – – ah, welch ein Glück! Ich habe doch den Türschlüssel bei mir; ich kann ja in mein Haus! Ich bin gerettet!«
Er schloß schnell auf, trat hinein und schloß die Türe hinter sich zu, ohne mich eingeladen zu haben, mit ihm zu kommen. Er wußte sich in Sicherheit. Ob aber ich nun doch noch abgewürgt oder abgestochen wurde, das war ihm sehr gleichgültig. Er blieb hinter dem Gitter stehen und rief mir durch dasselbe zu:
»Gelobt sei Gott, ich bin gerettet! Machen Sie schnell, daß Sie fortkommen, Sennor!«
»So? Weshalb haben Sie mich nicht mit in Ihr Haus genommen?«
»Danke sehr! Ich will nicht die Rache der Bravos auf mich lenken. Gehen Sie, gehen Sie! Ich darf Sie nicht vor meinem Hause dulden!«
»Ah! Das sagen Sie, trotzdem Sie sich meinen Freund nannten und mir versicherten, daß Sie mich lieben?«
»Wenn die Mörder drohen, da hört alle Liebe und Freundschaft auf. Ich kann mich doch nicht Ihnen zu Gefallen abmurxen lassen!«
»Das verlange ich auch nicht. Ich werde also gehen. Auf Wiedersehen morgen!«
Ich wendete mich von der Türe ab. Da aber rief er mir im Tone des Schreckens nach:
»Was fällt Ihnen ein, Sie Unglückskind! Sie dürfen mich nicht besuchen. Ich muß mir das verbitten!«
Die Angst des kleinen Männchens machte mir Spaß. Der Kerl, welcher mich angefallen hatte, lag, wie es schien, bewußtlos auf der Erde. Ich war überzeugt, daß er keine Helfershelfer hatte, und fühlte mich also ganz sicher. Darum trat ich zur Türe zurück und sagte im Tone des Erstaunens:
»Sie haben mich doch so dringend eingeladen! Wir wollten mit einander um zehn Uhr frühstücken!«
»Frühstücken Sie wo, wann und mit wem Sie wollen, nur nicht bei mir!«
»Sie sind es doch nicht, welcher Angst zu haben braucht, sondern die Feindseligkeit ist ganz gewiß nur gegen mich gerichtet.«
»Ursprünglich ja; aber Sie kennen diese Leute schlecht. Sie sind dem Tode geweiht, und man wird alle Ihre Freunde und jeden, der mit Ihnen verkehrt, auch morden. Keine Partei schont die andere. Machen Sie sich so schnell wie möglich fort! Ich mag mit Ihnen nichts mehr zu tun haben.«
»Gut, so werde ich gehen. Aber haben Sie nicht eine Person bei sich, welche mir helfen kann, den Bravo nach der Polizei zu schaffen?«
»Was denken Sie! Das wäre die größte Dummheit, welche ich begehen könnte. Selbst wenn ich tausend Diener hätte, würde ich Ihnen keinen einzigen von ihnen zur Verfügung stellen. Ich bin viel zu klug, als daß ich etwas tun könnte, was die Rache der Bravos gegen mich herausfordern würde. Lassen Sie ihn liegen und – – Gott sei Dank, da kommt mein Frauchen! Sie bringt Licht, und nun kann mir nichts mehr geschehen. Laufen Sie, laufen Sie! Es ist das allerbeste, was Sie tun können!«
Ich sah einen Lichtschein hinter dem Türgitter und hörte eine scheltende weibliche Stimme. Der gute Organista verschwand. Vielleicht erwartete ihn ein zarter Verweis wegen nächtlicher Ruhestörung. Ich wendete mich zu dem Bravo.
Da mußte ich erkennen, daß mein unnötiges Geschwätz mit dem Kleinen eine Dummheit gewesen war, denn noch war ich nicht ganz bei dem vermeintlich Bewußtlosen, so sprang er plötzlich auf. Er mochte eben in diesem Augenblick die volle Besinnung wieder erlangt haben und schnellte sich nach der Stelle hin, an welcher sein Messer lag. Ich mußte ihm zuvorkommen, denn ich war nicht bewaffnet, und wenn er das Messer erreichte, so konnte er mir wenigstens eine Wunde beibringen. Ich tat also einen raschen Sprung nach der betreffenden Stelle hin, welche mir näher lag als ihm, und streckte zu gleicher Zeit den Arm nach ihm aus. Er warf sich zur Seite, so daß ich ihn nicht fassen konnte, sprang einige Schritte zurück, erhob drohend die Faust und rief mir zu:
»Später werde ich besser treffen!«
Dann rannte er fort, nicht in das Gäßchen hinein, durch welches er sich herbeigeschlichen hatte, sondern in die entgegengesetzte Richtung, in welcher das freie Feld lag.
Ich hätte ihn wohl ergreifen können, hatte aber davon abgesehen, weil es große Anstrengung erfordert hätte, ihn zu transportieren, und ich konnte dem Organista nicht ganz Unrecht geben, nach dessen Versicherung es überhaupt geraten war, den Bravo laufen zu lassen. Da ich nun wußte, daß man es von irgend einer Seite auf mich abgesehen hatte, bedurfte es nur der nötigen Vorsicht, mich vor ähnlichen Überfällen zu bewahren.
Ich hob das Messer auf und ging durch das Gäßchen zurück, natürlich langsam und sorgfältig acht gebend, ob sich vielleicht noch jemand da befinde. Kein Mensch war zu sehen. Dann wendete ich mich nach links, nach der Quinta Tupidos zu, ging aber auf der Mitte der breiten Straße, wo der helle Mondschein mir erlaubte, das Terrain scharf zu überblicken.
An meinem Ziel angelangt, schob ich das Messer in die Tasche. Ich stand an der Türe eines schmalen Vorgartens, hinter welchem die Villa lag. Rechts sah ich den Klingelzug und links ein Messingschild, dessen Inschrift mir sagte, daß ich an der richtigen Stelle sei. Ich klingelte.
»Wer ist da?« fragte darauf eine Stimme vom Hause her.
Ich nannte meinen Namen, worauf eine männliche Dienstperson kam und aufschloß. Der Mann führte mich, ohne ein Wort zu sagen, in das Haus und öffnete dort eine Türe, hinter welcher sich ein kleines, behaglich eingerichtetes Zimmer befand. Tupido saß, einen Cigarro rauchend, auf dem Sofa. Er erhob sich, bot mir die Hand und sagte in sehr verbindlichem Tone:
»Endlich! Sie kommen fast eine Viertelstunde später als ich Sie erwartete, Sennor. Da ich mich auf Sie freute, mußte ich diesen Zeitverlust natürlich sehr bedauern!«
»Und ich habe um Verzeihung zu bitten. Ich hatte eine kleine Abhaltung, welche von mir nicht verschuldet war. Hoffentlich erdrücken Sie mich nicht unter Ihrem Zorne!«
»O nein,« lachte er. »Ich kann Ihnen leicht verzeihen, da die Sennora glücklicher Weise ihre Vorbereitungen zum Souper noch nicht beendet hat. Sie werden sich also noch einige Minuten mit mir begnügen müssen. Nehmen Sie Platz und stecken Sie sich einen Cigarro an!«
Er zog mich neben sich auf das Sofa und schob mir das Kästchen und Feuerzeug hin. Natürlich machte ich von beiden sofort Gebrauch. Er war die Liebenswürdigkeit selbst, ganz anders als am Nachmittage. Als meine Zigarre brannte, legte er mir vertraulich die Hand auf den Arm und sagte:
»Ich will Ihnen aufrichtig gestehen, daß ich es meinem Kompagnon herzlich Dank weiß, Sie an mich adressiert zu haben. Zunächst besitze ich im allgemeinen eine große persönliche Vorliebe für alles, was deutsch heißt, und sodann im besonderen sind Sie mir als ein Herr bezeichnet worden, von dessen bedeutenden Kenntnissen und reichen Erfahrungen ich profitieren könne. Ich habe sie also doppelt willkommen zu heißen, Sennor.«
Das war sehr stark aufgetragen. Dieser Mann mußte mich wirklich für höchst befangen halten, um annehmen zu können, daß er durch solche Überschwenglichkeiten seinen Zweck bei mir erreichen werde. Ich antwortete also in gemessensten Tone:
»Es tut mir wirklich leid, daß der Inhalt des betreffenden Briefes Sie veranlaßt hat, mich falsch zu beurteilen. Ich reise, um zu lernen, nicht aber um zu belehren. Für das letztere mangeln mir alle dazu nötigen Eigenschaften. Wer mir ein so unverdientes Lob erteilt, erwirbt sich nicht etwa ein Verdienst um mich, sondern er bringt mich ganz im Gegenteile in Verlegenheiten, denen ich nicht gewachsen bin.«
»Diese Sprache habe ich erwartet. Ich weiß sehr gut, durch welche rühmenswerte Bescheidenheit der Deutsche so vorteilhaft vor andern sich auszuzeichnen pflegt. Lassen wir also lieber diesen Gegenstand fallen, und sprechen wir von den Absichten, welche Sie bei ihrer jetzigen Reise verfolgen. Ich vermute, daß dieselben entweder merkantilischer oder naturwissenschaftlicher Natur sind.«
»Keins von beiden, Sennor. Ich reise um des Reisens willen. Ich bin weder in den Wissenschaften, noch im Handel unterrichtet und erfahren. Der Grund, warum ich reise, ist ganz derjenige eines Spaziergängers, welcher es liebt, sein Auge an abwechselnden Bildern zu ergötzen. Ich bitte also, der falschen Ansicht, welche Sie von mir haben, eine darauf bezügliche Berichtigung zu erteilen!«
Nachdem er mich mit so ausgezeichneter Freundlichkeit empfangen hatte, mußte ihn meine Art und Weise abkühlen. Sein Ton klang bedeutend zurückhaltender, als er mich fragte:
»Aber wie ist es denn möglich, so weite Reisen ohne einen wirklichen Zweck zu unternehmen? Wahrhaftig, die Deutschen sind ein höchst ideales Volk! Sie sagen, daß Sie spazieren gehen. Und dazu wählen Sie sich eine Gegend, welche alles besitzt, nur nicht den Anreiz zum Promenieren. Haben Sie denn wirklich eine Ahnung von den Gefahren und Entbehrungen, welchen Sie während einer Reise nach dem Westen unterworfen sein werden?«
»Ich habe mich darüber unterrichtet, natürlich nur so weit, als es aus der Entfernung möglich war, und ich sehe keinen Grund, den einmal gefaßten Gedanken aufzugeben.«
»So bewundere ich Ihre Unternehmungslust!«
»Sie wollen sagen, Sie belächeln die Unerfahrenheit, mit welcher ich etwas tue, was jeder andere an meiner Stelle unterlassen würde. Wenn der Unerfahrene nichts unternimmt, gelangt er eben nicht zur Erfahrung.«
Er schüttelte den Kopf. Er schien einzusehen, daß ich noch dümmer sei, als er bisher geglaubt hatte. Es klang fast wie Mitleid, als er mich fragte:
»Und Sie besitzen wirklich die Kühnheit, bis nach Santiago oder gar Tucuman gehen zu wollen? Wissen Sie, wie es bei uns aussieht? Gegenwärtig gibt es zahlreiche politische Parteien, welche sich gegenseitig bekämpfen, und zwar mit allen Mitteln und ohne zu fragen, ob dieselben verwerflich sind oder nicht. Gerade diejenigen Gegenden, durch welche Sie reisen wollen, sind durch diese Wirren unsicher gemacht. Sie wagen viel, vielleicht gar Ihr Leben, wenn Sie darauf bestehen, diesen Vorsatz auszuführen. Ich rate Ihnen ganz entschieden ab.«
Das sagte er natürlich nur zum Scheine. Ich antwortete ihm:
»Ich pflege einen einmal gefaßten und auch reiflich erwogenen Entschluß nicht wieder aufzugeben. Das ist auch hier der Fall.«
»Nun, so habe ich meine Schuldigkeit getan und bin auch noch bereit, Ihnen die Reise zu erleichtern, so viel das in meinen Kräften steht. Natürlich vorausgesetzt, daß Ihnen das angenehm ist.«
»Ich werde Ihren Beistand mit größter Dankbarkeit akzeptieren, Sennor.«
»Schön. So darf ich Ihnen vielleicht meinen Rat zur Verfügung stellen. Die Reise, welche Sie vorhaben, macht man gewöhnlich von Buenos Ayres aus, wohin Sie sich also von hier aus zu begeben hätten. Leider würden Sie da durch Gegenden kommen, welche durch zügellos gewordene militärische Banden unsicher gemacht werden. Aus diesem Grunde schlage ich Ihnen eine andere Route vor, welche zwar ungewöhnlicher ist, Ihnen dafür aber die möglichste persönliche Sicherheit bietet. Gehen Sie quer durch Uruguay und die Provinz Entre Rios bis nach Parana oder Santa Fe. Von da aus haben Sie die beste Gelegenheit, über Cordoba nach Santiago und Tucuman zu kommen.«
»Danke, Sennor! Ich bin bereits jetzt der Ansicht, daß es für mich vorteilhaft sein wird, Ihrem Rate zu folgen.«
»Gewiß ist es das beste, was Sie tun können. In diesem Fall wäre ich im Stande, Ihnen die Reise bedeutend zu erleichtern. Ich könnte Sie mit einem Empfehlungsschreiben an einen sehr einflußreichen, hohen Offizier versehen, in dessen Macht es liegt, Ihnen Ihren Weg zu ebnen. Es ist Lopez Jordan, der Stiefsohn des früheren Präsidenten Urquiza. Haben Sie von ihm gehört?«
»Ich habe erfahren, daß er allerdings ganz bedeutende Verbindungen besitze.«
»Er besitzt weit mehr als das. Es ist aller Grund vorhanden, anzunehmen, daß er vor einer Karriere stehe, welche ihn zur höchsten Stelle der öffentlichen Gewalt bringen wird. Ich kann mich einer näheren Bekanntschaft, ja fast Freundschaft mit ihm rühmen, und hege die Überzeugung, daß meine Empfehlung an diesen bedeutenden Mann für Sie von sehr großem Vorteile sein würde. Da Sie mir empfohlen sind, ist es meine Pflicht, für Sie zu sorgen. An eine Gegenleistung hat man dabei natürlich nicht zu denken. Sie nehmen also meinen Vorschlag bezüglich dieser Empfehlung an?«
»Gewiß. Es wäre ja die größte Unklugheit, denselben zurückzuweisen.«
»Gibt es einen Grund, welcher Sie für längere Zeit hier in Montevideo halten könnte?«
»Nein, Sennor. Hier fesselt mich weder ein persönliches, noch ein geschäftliches Interesse, und ich kann zu jeder Stunde aufbrechen. Die Stadt bietet mir nichts Neues oder Seltenes. Ich will tiefer in das Land hinein und habe gar keinen Grund, mich unnütz hier an der Küste lange aufzuhalten.«
»Das ist gut, Sennor. Heute weiß ich nämlich noch, wohin ich meinen Empfehlungsbrief zu adressieren habe, später aber wüßte ich nicht, wohin ich Sie schicken sollte, da Lopez Jordan nächstens aufbrechen wird, um in amtlicher Eigenschaft die Provinzen zu bereisen. Je eher Sie bei ihm ankommen, desto besser für Sie. Es ist alle Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß Sie sich ihm anschließen könnten, da er nach ganz derselben Gegend gehen will, die auch Ihr Ziel ist. Freilich dürften Sie sich nicht unnötig hier verweilen und müßten vielleicht schon morgen von hier abreisen.«
Es sagte das in einem so eindringlichen und fürsorglichen Tone, daß ich mich gewiß hätte täuschen lassen, wenn mir nicht der Inhalt des Schreibens bekannt geworden wäre. Ich ging scheinbar auf seine Vorstellung ein:
»Unter diesen Verhältnissen bin ich natürlich bereit, schon morgen früh aufzubrechen.«
»Schön! Ich werde Sie also jetzt mit der Empfehlung versehen. Aufrichtig gestanden, habe ich bereits am Nachmittage an dieselbe gedacht, da ich ziemlich überzeugt war, daß Sie meinem Rate Folge leisten würden, und habe also den Brief bereits angefertigt. Lopez Jordan befindet sich gegenwärtig in Parana. Der kürzeste Weg dorthin würde über Mercedes, den Uruguayfluß und Villaguay führen. In welcher Weise reisen Sie?«
Ich zuckte die Achseln.
»Ich bin mit den hiesigen Verhältnissen so wenig vertraut, daß ich Sie ersuchen möchte, mir auch in dieser Beziehung Ihren Rat zu erteilen.«
»Ich rate zur Diligence, der Staatskutsche, deren Benutzung ich Ihnen angelegentlich empfehlen kann. Mit derselben reisen Sie billig und so angenehm und sorglos, wie es unter den hiesigen Verhältnissen möglich ist. Ich weiß, daß morgen am Vormittage eine Diligence in der angegebenen Richtung abgeht. So werde ich Ihnen also gleich jetzt den Brief einhändigen können. Ich habe nur die Adresse hinzuzufügen. Entschuldigen Sie mich!«
Er trat zu einem Stehpulte, welches sich in der Ecke befand. Da wurde die Türe aufgerissen, und es stürmten zwei Knaben herein. Sie standen im Alter von wohl zehn oder zwölf Jahren.
Ich hatte mir sagen lassen, daß die Kindererziehung in den La-Plata-Staaten eine sehr mangelhafte sei, und fand das jetzt bestätigt. Die beiden wie die Puppen aufgeputzten Buben stellten sich vor mich hin und starrten mich in frecher Weise an.
»Papa,« fragte der eine, »ist das der Deutsche?«
»Ja, mein Söhnchen,« antwortete der Vater, indem er an der Adresse des Briefes schrieb, ohne sich um das Benehmen seiner Lieblinge zu bekümmern. Der kleine Fragesteller wendete sich sodann in verächtlichem Tone an mich:
»Bist du wirklich ein Dummkopf?«
Da beeilte sich der andere Liebling, an meiner Stelle zu antworten:
»Nein, er ist ein alberner deutscher Grobian.«
»Wer hat das gesagt?« fragte ich schnell.
»Der Vater,« lautete die Antwort. »Er sagte es der Mutter.«
Da wendete sich ihr Vater um und rief in zorniger Verlegenheit: »Unsinn! Dieser Sennor war nicht gemeint, sondern ein ganz anderer Mann, ein deutscher Arbeiter, welcher einen Auftrag falsch ausgeführt hatte.«
Diese Ausrede wurde sogleich in für ihn höchst ärgerlicher Weise zurückgewiesen, denn der ältere der beiden lieben Buben sagte:
»Und da hast du ihm zum Abendbrode eingeladen!«
»Schweig mit deinen Verwechselungen!« gebot Tupido. »Lassen Sie sich durch diese kindlichen Irrtümer nicht irre machen, Sennor! Hier haben Sie den Brief. Der Inhalt desselben wird Sie im höchsten Grade zufriedenstellen.«
Er gab mir den Brief in die Hand, welcher in einem mittelgroßen, mittels Gummi verklebten Couverte steckte und so dick war, daß er wenigstens drei Bogen enthielt – den eigentlichen Brief und die beiden Kontrakte. Ich wog ihn in der Hand und sagte:
»Ist es bei Ihnen nicht gebräuchlich, offene Empfehlungsschreiben zu geben?«
»Nein, hier zu Lande überhaupt nicht. Es kommt häufig vor, daß man eine geschäftliche Notiz beifügt, welche nur für den Empfänger bestimmt ist.«
»Das ist wohl auch hier der Fall?«
»Allerdings.«
»So muß diese Notiz eine sehr umfangreiche sein! Und ich gestehe offen, daß es mir lieber sein würde, wenn Sie die Güte haben wollten, beides zu trennen.«
»Sennor,« sagte er, »ich pflege nie von meinem Usus abzuweichen und denke, daß Sie mir auch jetzt erlauben werden, bei demselben zu verharren!«
»Hm! Sie sind bereits einmal von demselben abgewichen, indem Sie heute auf den bei Ihnen gebräuchlichen Abzug verzichteten. Ich will dies dankbar anerkennen, indem ich den Brief so besorge, wie Sie ihn mir übergeben.«
Er hatte die Feder noch in der Hand und ging jetzt wieder an das Pult, um sie mit dem Schreibzeuge einzuschließen. Die beiden Buben standen bei mir und sahen den Brief verlangend an.
»Was steht darauf? Zeigen Sie her!« sagte der größere, indem er das Schreiben ergriff, um es mir in seiner ungezogenen Weise aus der Hand zu reißen. Das war mir ungeheuer lieb. Während er in der Mitte festhielt, ergriff ich das Couvert an beiden Enden.
»Laß es sein! Das ist nicht für dich,« sagte ich.
»Zeige nur her!« gebot er starrköpfig. »Der Brief ist von meinem Papa. Er gehört also mir und nicht dir. Ich will ihn sehen!«
Er zerrte mit aller Gewalt. Das eben wollte ich. Das Couvert riß aus einander, und der Inhalt fiel zu Boden. Schnell raffte ich denselben auf, und zwar so, daß die Schriftstücke aus einander gefaltet wurden. Den ›Empfehlungsbrief‹ hatte ich obenauf.
»Na, da hast du das Couvert zerrissen!« sagte ich in ärgerlichem Tone. »Nun kann der Papa ein anderes schreiben. Aber – – was ist das? Was lese ich da?«
Tupido kam auf mich losgeschossen.
»Halt! Nicht lesen, nicht lesen!« rief er aus.
Ich trat zurück, hielt mir den Brief lesend vor die Augen und schob den andern Arm abwehrend gegen ihn vor.
»Nicht lesen, nicht lesen!« wiederholte er zornig, indem er sich bemühte, die Papiere in seine Hände zu bekommen. Ich aber war weit stärker als er und schleuderte ihn so kräftig von mir, daß er auf das Sofa flog. Die beiden Jungens hatten sich schreiend an mich gehängt. Sie ließen sich von mir nach der Türe zerren. Ich öffnete dieselbe und schob die Rangens hinaus. Tupido war wieder aufgesprungen und wollte sich auf mich stürzen.
»Bleiben Sie mir vom Leibe!« donnerte ich ihn an. »Sonst werfe ich Sie an die Wand, daß Sie an derselben kleben bleiben! Hier, diese beiden Kontrakte erhalten Sie zurück, denn ich ersehe aus der Überschrift, daß es eben Kontrakte, also Geschäftspapiere sind; sie gehen mich nichts an.«
»Auch den Brief will ich sofort haben!« schrie der Mann jetzt wütend auf.
»Der bezieht sich auf mich, und ich habe das Recht, ihn zu lesen. Erziehen Sie Ihre Kinder anders, daß sie nicht Couverts zerreißen, auf deren festen Verschluß Ihnen so viel anzukommen scheint!«
»Ich werde die Dienerschaft kommen lassen, welche Ihnen den Brief abnehmen und Sie dann hinauswerfen wird!«
»Ihre Leute werden keins von beiden tun, denn ich werde jeden, der mich berührt, sofort niederschlagen. Ich gehe selbst, denn bei so einem Menschen, wie Sie sind, ist meines Bleibens natürlich nicht. Sie haben die Wahl: Entweder Sie sorgen jetzt dafür, daß ich hier den Brief ohne Störung lesen kann, und in diesem Fall erhalten Sie ihn zurück, oder ich gehe sofort, nehme ihn aber mit und mache den Inhalt an den betreffenden Stellen bekannt.«
Ich hatte Grund, diese Bedingung zu stellen, denn es war jetzt die Türe geöffnet worden, und ich sah eine Dame und einen dienstbaren Geist unter derselben stehen. Beide sagten nichts, hielten aber die Augen erstaunt auf uns gerichtet, die wir einander in feindlicher Haltung gegenüber standen.
Tupido sah meine Entschlossenheit. Er winkte den beiden ab und sagte:
»So lesen Sie meinetwegen in drei Teufels Namen! Aber dann verlange ich den Brief zurück und mag nichts mehr mit Ihnen zu schaffen haben!«
Die beiden Zuschauer waren verschwunden. Ich setzte mich behaglich nieder und las:
»Sennor! Soeben wird mir die Zustimmung meines Kompagnons mitgeteilt. Ich sende Ihnen also schleunigst die Kontrakte zur Unterzeichnung, und Sie wollen mir dann beide durch einen sichern Boten zurückschicken, worauf ich Ihnen den einen mit der Ware zustellen werde.
Der Überbringer dieses Schreibens ist ein unwissender und dabei höchst aufgeblasener Deutscher, der keine Ahnung hat, welche wichtigen Papiere er Ihnen überbringt. Sie wissen, daß alle eingewanderten Deutschen gegen Ihre Partei sind, und, obgleich er der Meinung ist, daß dieser Brief ein Empfehlungsschreiben sei, erwarte ich selbstverständlich nicht, daß Sie ihn als Freund empfangen und behandeln.
Ich habe grad ihn als Boten gewählt, weil man bei einem Teutonen, welcher erst heute aus dem Schiffe gestiegen ist, so wichtige Dokumente nicht suchen wird. Hält man ihn dennoch an und findet sie, nun, so gibt man ihm eine Kugel; das ist alles; es fehlt jede Unterschrift; wir können leugnen und werden sagen, daß es sich nur um eine gegen uns geführte Intrige handelt. Es kann Ihnen nicht schwer werden, den Kerl, welcherdümmer ist als er aussieht, wieder los zu werden. Stecken Sie ihn unter Ihre Soldaten; er scheint ein guter Schütze zu sein, und es schadet gar nichts, wenn man ihm zum Besten des Vaterlandes ein wenig Blut abzapft – –«
So ungefähr lautete der Inhalt dieses liebenswürdigen Schreibens, so weit es sich auf mich bezog. Ich stand auf und warf den Brief auf den Tisch.
»Hier haben Sie Ihren Wisch zurück! Vielleicht legen Sie sich eine andere Meinung von mir bei, wenn ich Ihnen sage, daß ich bereits, bevor ich zu Ihnen kam, wußte, daß ich betrogen werden solle. So dumm, wie Sie meinen, sind die Deutschen denn doch nicht. Ich bin vielmehr der Überzeugung, daß sie trotz Ihrer weltbekannten Ehrlichkeit es an Scharfsinn mit jedem südamerikanischen Schuften aufnehmen. Ich kannte Sie, bevor ich Sie sah.«
Er hatte den Brief schnell an sich genommen und eingesteckt.
»Wen meinen Sie mit dem Worte Schuft?« fragte er jetzt, indem er einen Schritt näher trat und mich drohend ansah.
»Beantworten Sie sich diese Frage gefälligst selbst, Sennor!«
»Wissen Sie, was für eine Beleidigung das ist und womit sie beantwortet wird?«
»Unter Ehrenmännern, ja. Da Sie aber kein solcher sind, so habe ich mich um Ihre Antwort gar nicht zu kümmern.«
»Oho! Sie wird Ihnen werden und zwar so gewiß, wie ich jetzt vor Ihnen stehe.«
»Das kann sich nur auf irgend eine Hinterlist beziehen, gegen welche ich mich zu schützen wissen werde. Leute Ihres Schlages fürchtet man nicht. Ein guter, deutscher Fausthieb setzt einen bei jedem feigen Bravo in Respekt. Wagen Sie es, mir irgend welche Unbequemlichkeit oder gar Gefahr zu bereiten, so wende ich mich nicht etwa an die hiesige Polizei, weil mir das zu umständlich sein würde, sondern ich komme direkt zu Ihnen und ohrfeige Sie wie einen Buben, welcher die Tortilla hat verbrennen lassen. Merken Sie sich das! Und nun gute Nacht, hoffentlich für immer!«
Er zog mir eine wütende Grimasse, sagte aber nichts. Ich ließ mir von dem Diener den Gartenausgang öffnen. Bis das geschah, sagte der Mensch nichts. Dann aber, als die Türe offen stand, machte er mir eine tiefe, natürlich höhnische Verbeugung und fragte:
»Wollen Sie gefälligst hier hinausgehen? Sie haben doch nichts eingesteckt? In diesem Falle – –«
Was er in diesem Falle tun wolle, erfuhr ich nicht, denn er erhielt eine so gewaltige Ohrfeige, daß er um fünf oder sechs Schritte fortgeschleudert wurde und dort seine Gestalt, so lang und hager sie war, auf die Erde ausstreckte. Ich vermute, daß er seine in solcher Weise beantwortete Frage nicht so bald wieder an einen Deutschen gerichtet hat. Natürlich fiel es mir nicht ein, mich darum zu bekümmern, wie lange er liegen bleiben werde. Ich zog die Gittertüre hinter mir zu und ging fort, in der Richtung, aus welcher ich gekommen war. Dabei hielt ich mich abermals auf der Mitte der Straße, denn es war nicht unmöglich, daß der Bravo sich noch in dieser Gegend aufhielt, um einen zweiten Versuch gegen mich zu unternehmen.
Ich war noch gar nicht weit gekommen, so hörte ich vor mir eilige Schritte, welche sich mir zu nähern schienen. Es mußten zwei Menschen sein, welche da liefen, und zwar auf der rechten Seite. Ich ging also auf die linke hinüber, wo der Mondschein nicht durch die Wipfel der Bäume drang und es also Schatten gab. Allerdings mußte man, da ich auf der hellen Straße gegangen war, mich schon von weitem gesehen haben.
Jetzt sah ich die erste Person, ein Frauenzimmer, welches so schnell wie möglich lief. Und nun erblickte ich eine männliche Person, welche der ersteren nacheilte, sie jetzt erreichte und die beiden Arme um sie schlang.
»Hilfe, Hilfe!« rief die Überfallene, allerdings mit nicht allzu lauter Stimme. Vielleicht benahm der Schreck ihr das Vermögen, lauter zu rufen.
»Einen Kuß, einen Kuß will ich haben!« hörte ich die Stimme des Menschen. Die beiden rangen mit einander. Ich eilte selbstverständlich zu ihnen hin. Die Bedrängte sah mich kommen.
»Herr, Herr, beschützen Sie mich!« rief sie mir entgegen.
Der Mensch ließ sie augenblicklich los und entfloh in der Richtung nach der Stadt zu. Die also Gerettete ging sehr einfach nach französischer Mode gekleidet und trug anstatt des Hutes einen spanischen Schleier, welcher jetzt verschoben war, auf dem Kopfe. Sie stand gegen den Mond gerichtet, und ich sah ein ganz allerliebstes, junges Mädchengesicht. In der einen Hand hielt sie ein Fläschchen, wie es schien.
»O Sennor,« sagte sie tief aufatmend, »welch ein Glück, daß Sie sich in der Nähe befanden! Ich kann vor Schreck nicht mehr stehen.«
Sie wankte wirklich, und ich unterstützte sie dadurch, daß ich ihren Arm in den meinigen zog.
»Nehmen Sie meine weitere Hilfe an, Sennorita! Es soll Ihnen nichts ferner geschehen.«
Sie hing sich schwer an mich, als ob sie wirklich nicht ohne Unterstützung stehen könne, und seufzte:
»Welch ein Mensch! Er hat mich auf einer großen Strecke verfolgt, und dann konnte ich nicht mehr fliehen.«
»Kannten Sie ihn? Wer war er?«
»Ich sah ihn noch nie.«
»Es scheint für junge Damen gefährlich zu sein, zu dieser Stunde auf der Straße zu gehen. Wußten Sie das nicht?«
»Ich wußte es, aber dennoch mußte ich zur Apotheke, um die Medicina für meine Großmutter zu holen.«
»Und wo wohnen Sie?«
»Gar nicht allzu weit von hier. Aber dennoch fürchte ich mich außerordentlich. Wie leicht kann dieser Mensch wiederkommen!«
»Wenn Sie mir die Erlaubnis erteilen, werde ich Sie zu Ihrer Wohnung begleiten.«
»Wie gütig Sie sind! Ich nehme Ihr Anerbieten so gern an. Darf ich mich weiter auf Ihren Arm stützen?«
»Tun Sie es immerhin!«
Sie sah mir so ehrlich und unbefangen in das Gesicht, und dennoch war es mir, als ob ich der Sache nicht trauen dürfe. Wir waren bis jetzt stehen geblieben, gingen nun aber fort, meiner eigentlichen Richtung wieder entgegengesetzt. Sie blickte so vertrauensvoll zu mir auf und erzählte mir dabei, daß ihre Eltern gestorben seien und sie nun nur noch das gute Großmütterchen habe, welches gar nicht aus dem Lande stamme, sondern aus Deutschland herübergekommen sei.
Es fiel mir auf, daß sie das Wort Deutschland ganz besonders betonte und mich dabei erwartungsvoll anblickte. Ich sagte aber nichts und ließ sie erzählen.
So kamen wir an Tupidos Quinta vorüber, und weiter ging es, bis die Straße eine breite Lücke zeigte, wo es kein Haus und keinen Garten gab. Wir befanden uns auf einer Blöße, die nur mit einigen hohen, stattlichen Ombu-Bäumen bestanden war.
»Dort drüben liegt unser kleines Häuschen,« sagte das Mädchen, über die Lichtung hinüberdeutend.
Ich sah eine im Mondenschein weiß glänzende Hütte, welche vielleicht fünfhundert Schritte entfernt war.
»Darf ich noch weiter mit bis dorthin?« frage ich. »Oder fühlen Sie sich nun sicher?«
»Sicher werde ich mich erst dann fühlen, wenn ich daheim bin.«
»So kommen Sie!«
Wir bogen in die Blöße ein. Doch blieb ich schon nach wenigen Schritten stehen, denn aus dem dunklen Schatten der Ombu-Bäume lösten sich fünf oder sechs Gestalten, deren eine auf uns zukam, während die andern stehen blieben.
»Halt! Keinen Schritt weiter!« gebot ich. »Was treibt ihr hier?«
Auch das Mädchen war erschrocken. Es schmiegte sich fester an mich.
»Was wir hier treiben?« antwortete eine Stimme, welche mir bekannt vorkam. »Wir warten auf Sie, Sennor.«
Ich nahm das Mädchen in den linken Arm, um den rechten zur Verteidigung frei zu bekommen. Ich fühlte, daß mein Schützling zitterte.
»Ich bin – – kennen Sie mich denn wirklich nicht – Mauricio Monteso!«
Er war es wirklich, der Yerbatero; das sah ich, als er jetzt näher trat.
»Sie sind es?« fragte ich verwundert. »Das ist eine Überraschung! Aber ich wiederhole doch meine Frage: Was treiben Sie hier?«
»Das werden Sie sofort erfahren. Wenn Sie Vertrauen zu uns haben, so treten Sie da unter den Baum, wo man uns nicht sehen kann!«
»Warum?«
»Sie werden es dann erfahren. Jetzt gibt es keine Zeit zur Erklärung, denn er wird gleich kommen.«
»Wer?«
»Derjenige, der die Sennorita angefallen hat, nämlich ihr eigener Vater.«
»Ihr Va – – das ist doch nicht möglich!«
»O doch. Bitte, schweigen Sie jetzt, und halten Sie das Mädchen fest, damit sie nicht entfliehen und uns verraten kann!«
Er trat nahe an das Mädchen heran, hielt ihr sein Messer vor das Gesicht und drohte:
»Sennorita, wenn Sie jetzt einen einzigen Schritt tun oder ein einziges Wort sagen, so stoße ich Ihnen diese Klinge in Ihr liebes, kleines, falsches Herzchen. Verlassen Sie sich darauf, daß ich nicht scherze!«
Das Mädchen zuckte zusammen und drängte sich noch fester an mich als vorher. Ich ergriff ihr Handgelenk, daß sie nicht fortkonnte. Auch die andern Männer waren wieder in den Schatten zurückgetreten. Jetzt nahten schnelle Schritte aus der Gegend, aus welcher ich mit dem Mädchen gekommen war. Ein Mann erschien und blieb für eine Sekunde an der Mauerecke des letzten Gartens stehen. Ich erkannte sogleich den Menschen, welcher das Mädchen angefallen hatte.
»Kein Wort!« flüsterte der Yerbatero meiner Begleiterin zu.
Ich sah, daß er ihr das Messer auf die Brust setzte. Sie zitterte am ganzen Leibe und hütete sich, einen Laut von sich zu geben. Der Mann an der Mauerecke legte die Hand über die Augen und sah nach der Hütte hinüber, in welcher das kranke Großmütterchen wohnen sollte. Wir hörten, daß er einige Worte brummte, dann setzte er sich in schnelle Bewegung nach der Hütte zu. Er mußte dabei an den Bäumen vorüber. Kaum hatte er diese erreicht, so warfen sich die Männer auf ihn und rissen ihn zu Boden. Er wollte schreien; aber der Yerbatero kniete ihm auf die Brust und drohte:
»Schweig', sonst ersteche ich dich, Halunke! Deine Komödie gelingt dir dieses Mal nicht. Bindet ihm den Lasso um den Leib und die Arme, und schafft ihn nach der Hütte! Ihr wißt schon, wie.«
Der Mann mußte sich aufrichten, man schnürte ihm den Lasso um und schaffte ihn fort. Nun befand sich nur noch der Yerbatero bei uns beiden.
»Sennorita, haben Sie den Mann gekannt, welcher soeben mit meinen Kameraden verschwunden ist?«
»Ja,« hauchte das erschrockene Mädchen. »Es war mein Vater.«
»Es war auch derselbe, der Sie scheinbar überfiel, um Sie zu küssen?«
Sie schwieg.
»Antworten Sie, sonst fühlen Sie mein Messer! War er es?«
»Ja.«
»Auf wen war denn die Komödie abgesehen?«
Sie senkte den Kopf und sagte nichts.
»Ich will Sie darauf aufmerksam machen, Sennorita, daß ich alles weiß und daß ich Sie nur frage, damit dieser fremde Sennor alles aus Ihrem Munde erfahren möge. Antworten Sie freiwillig und der Wahrheit gemäß, so wird Ihnen nichts geschehen. Verweigern Sie aber die Antwort, so werden Sie mein Messer schmecken!«
»Warum sind Sie so streng mit mir, Sennor?« fragte sie jetzt. »Warum drohen Sie mir mit dem Messer und wohl gar mit dem Tode? Was ich getan habe, ist doch nicht so sehr schlimm!«
»Es ist sehr schlimm, schlimmer als Sie denken und wissen. Ich aber weiß mehr als Sie. Wer wohnt da drüben in der Hütte?«
»Ich, der Vater und die Großmutter.«
»Womit ernährt sich Ihr Vater? Er lebt vom Spiele. Nicht?«
»Ich kann es nicht leugnen.«
»Und eure Hütte ist der Ort, an welchen man die Vögel schleppt, welche man rupfen will. Sie aber sind das Lockvögelchen, welches die Beute in das Netz bringt. Habe ich recht?«
Erst nach einer Weile stieß sie hervor:
»Muß ich nicht dem Vater gehorchen?«
»Leider! Darum bin ich auch nachsichtig mit Ihnen, aber nur so lange, als Sie aufrichtig antworten. Heute sollten Sie den Sennor nach der Hütte bringen, nicht wahr?«
»Ja.«
»Sie mußten sich in einiger Entfernung von der Quinta des Sennor Tupido aufstellen. Ihr Vater stand bei Ihnen. Es war verabredet worden, daß er Sie überfallen wolle, sobald der Alemano komme. Dieser letztere solle Sie befreien und nach Hause begleiten? Um den Fremden ganz sicher anzulocken, sollten Sie sagen, daß Ihre Großmutter eine Deutsche sei?«
»Ja.«
»Jedenfalls haben Sie das auch getan. Aber, wissen Sie denn, was geschehen sollte, wenn Sie diesen Sennor nach der Hütte gebracht hatten?«
»Man wollte ein Spielchen machen.«
»So sagte man Ihnen; aber man hatte etwas ganz anderes vor. Man wollte ihn ermorden.«
»Santa madonna de la cruz! Das ist nicht wahr!«
Die Entrüstung, mit welcher sie dies sagte, war eine ungeheuchelte; das hörte ich ihrem Tone an.
»Es ist sehr wahr. Man hätte Sie und die Großmutter schlafen geschickt und den Sennor getötet.«
»Mein Vater spielt gern, wie jedermann hier; aber ein Mörder ist er nicht!«
»Armes Mädchen! Das ist eine Täuschung. Ihr Vater verkehrt mit den berüchtigsten Bravos. Doch will ich gegen Sie lieber davon schweigen. Sie, Sennor, werden neugierig sein, zu erfahren, wie ich hierher und hinter diese Geheimnisse gekommen bin. Ich werde es Ihnen nachher erzählen. Jetzt aber können Sie sich Ihre Mörder einmal ansehen, ohne daß es für Sie eine Gefahr dabei gibt. Warten Sie, nachdem ich mich jetzt entfernt habe, noch ungefähr fünf Minuten. Dann gehen Sie langsam mit der Sennorita auf die Hütte zu. Das übrige werde ich besorgen.«
»Warum gehen Sie nicht mit uns?«
»Weil der Mond so hell scheint, und weil man Sie mit der Sennorita erwartet. Man blickt Ihnen ganz gewiß aus dem Fenster entgegen. Darum müssen Sie beide allein kommen, damit kein Verdacht erregt werde. Ich hingegen folge meinen Kameraden, welche auf einem Umwege voran sind, um von hinten an das Häuschen zu kommen.«
»Was sind diese deine Kameraden!«
»Brave Yerbateros, wie ich, die sich selbst vor dem Teufel nicht fürchten. Sie werden sie wohl noch kennen lernen. Also ich gehe, und nach fünf Minuten gehen dann Sie!«
Er wandte sich nach der Straße, in deren Seitenschatten er verschwand. Das Mädchen war von mir zurückgetreten, aber ich hielt sie noch immer am Handgelenk fest.
Fast konnte ich es nicht glauben, daß dieses Kind mit den unschuldsvollen Gesichtszügen die Zubringerin einer Spielerbande sei. Das Mädchen hatte wohl gar keine Ahnung von der Verwerflichkeit dessen, was sie getan und bis heute abend getrieben hatte. Daß man mir nach dem Leben trachtete, wußte sie nicht. Davon war ich überzeugt. Ich war überhaupt geneigt, sie von jeder Schuld frei zu sprechen. Das Mädchen wartete, bis von dem Yerbatero nichts mehr zu sehen und zu hören war; dann fragte sie mich:
»Sennor, glauben auch Sie es, daß mein Vater Ihnen nach dem Leben trachte?«
»Auf diese Frage kann ich keine bestimmte Antwort geben, mein Kind. Ihren Vater kenne ich nicht; von dem Mann aber, welcher mir diese Mitteilung machte, glaube ich annehmen zu dürfen, daß er mir keine Unwahrheit sagt. Ich denke, daß er seine guten Gründe haben werde, einen solchen Verdacht auszusprechen. Wie dem aber auch sei, so bin ich vollständig überzeugt, daß Sie mit diesem ruchlosen Plan nichts zu tun haben.«
»Nein, gewiß nicht, ich nicht und auch die Großmutter nicht.«
»Sie lieben wohl Ihre Großmutter sehr?«
»Sehr, Sennor, viel mehr als den Vater.«
»Und doch gebrauchten Sie dieselbe als Lockung, mich nach der Hütte zu bringen!«
»Das war mir so gesagt worden, und ich mußte gehorchen, sonst wäre es mir nicht gut ergangen.«
»Aber Sie haben Ihren Auftrag in so ausgezeichneter Weise ausgeführt, daß ich annehmen muß, Sie seien in solchen Sachen außerordentlich erfahren. Sie besitzen ein bedeutsames Verstellungsvermögen.«
»Das lernt man ja, wenn man es oft machen muß.«
Fast hätte ich über diese Worte lachen müssen und über den Ton, in welchem sie dieselben vorbrachte. Sie war eine heißblütige, leichtlebige Südländerin und nicht gewöhnt, über das, was sie tat, viel nachzudenken. Es war vorauszusehen, daß sie zu Grunde gehen werde; aber ich konnte ihr nicht helfen. Darum schwieg ich und trat nach den abgelaufenen fünf Minuten den Weg mit ihr an.
Der Mond beschien sehr hell die ganze Fläche, welche zwischen uns und der Hütte lag. Man mußte uns von dem Fenster derselben aus kommen sehen. Als wir noch nicht die Hälfte der Strecke zurückgelegt hatten, fragte mich das Mädchen:
»Was meinen Sie, Sennor, werden die Männer, welche uns anhielten, mit meinem Vater schlimm verfahren?«
»Sie haben wohl keine Veranlassung, ihm viel Gutes zu erweisen.«
»So muß ich die Leute in der Hütte warnen!«
Ich war auf einen Fluchtversuch nicht gefaßt und hielt in Folge dessen ihre Hand nicht mehr so fest wie vorher. Sie riß sich los und eilte davon. Aber mit einigen Sprüngen hatte ich sie wieder erreicht und ergriff sie beim Arme.
»Halt, Sennorita; so schnell und ohne allen Abschied wollen wir uns doch nicht trennen. Es würde unhöflich sein, den Schutz ohne Dank zu verlassen, in den Sie sich begeben haben.«
Sie stieß einen tiefen, ärgerlichen Seufzer aus, sagte aber von jetzt an kein Wort mehr und folgte mir willig weiter. So kamen wir an die Hütte. Noch ehe wir die Türe öffnen konnten, wurde dieselbe von innen aufgestoßen, und beim Schein der drin brennenden Lampe sah ich einen Mann, welcher ein buntes Tuch um den Kopf trug, ungefähr wie die Gauchos sich ähnliche Tücher über den Hut weg um das Kinn binden. Sein Gesicht konnte ich nicht sehen, da er das Licht im Rücken hatte.
»Endlich, endlich!« sagte er. »Deine Großmutter hat mit Schmerzen auf die Medizin gewartet.«
»Du, Vetter, bist da?« fragte sie erstaunt. »Dich konnte man heute und so spät nicht erwarten.«
»Die Sorge um die Kranke trieb mich her. Aber, du bist nicht allein. Seit wann läßt sich mein Mühmchen in so später Stunde in Herrenbegleitung sehen?«
»Seit heute, wo ich von einem wüsten Menschen angefallen wurde. Dieser Sennor befand sich glücklicher Weise in der Nähe und hat mich von dem Zudringlichen befreit. Wollen wir ihn bitten, hereinzukommen, um dem Großmütterchen Gelegenheit zu geben, ihm zu danken?«
Das gewandte Mühmchen spielte ihre Rolle ganz so, wie sie ihr aufgetragen worden war, obgleich sie wußte, daß nun der Erfolg ausbleiben werde. Sie wußte wohl nicht, welches andere Benehmen in ihrer Lage besser einzuschlagen sei.
»Ganz natürlich!« antwortete der Vetter. »Bitte, Sennor, treten Sie herein! Sie sind uns auf das herzlichste willkommen.«
Er trat zur Seite, um die Türöffnung freizugeben; das Licht fiel auf sein Gesicht, und ich erkannte – – den Bravo. Der Kerl verstand es sehr gut, seine Stimme zu verstellen. Daß er anstatt des Hutes ein Tuch um den Kopf trug, gab ihm ein verändertes Aussehen. Hätte ich sein Gesicht nicht am Nachmittage genau betrachten können, so wäre ich jetzt getäuscht worden.
»Danke, Sennor!« antwortete ich zurückhaltend. »Ich will nicht stören. Ich habe die Sennorita bis an ihre Wohnung gebracht, was ich ihr versprochen hatte, und meine Zeit ist mir nicht so reichlich zugemessen, daß ich hier verweilen könnte.«
»Nur auf einen Augenblick, auf einen einzigen Augenblick, Sennor!«
»Nun gut, um das Großmütterchen zu begrüßen. Oder befinden sich noch andere Personen drin?«
»O nein. Nur mein Pate ist noch da mit seinem Sohne, sonst weiter niemand. Sie müssen einen Schluck mit uns trinken, bis der Vater der Sennorita kommt, welcher in einigen Minuten von seinem Ausgange zurückkehren wird. Mein Mühmchen ist ein liebenswürdiges Wesen; Sie müssen sie kennen lernen. Kommen Sie also, kommen Sie, Sennor!«
Er sagte das in so freundlichem und dringendem Ton, daß er jeden andern getäuscht hätte. Ich aber zögerte, seiner Aufforderung zu folgen. Da erklang es hinter mir:
»Gehen Sie getrost hinein, Sennor! Es ist wirklich so, wie Ihnen dieser gute Sobrino sagt. Es wird Ihnen außerordentlich gefallen. Ich gehe auch mit hinein. Gehen Sie, gehen Sie!«
Es war der Yerbatero, welcher mich nach der Türe schob. Der Bravo fragte überrascht:
»Noch einer! Wer sind Sie, Sennor?«
»Ich bin der Begleiter des Vaters, welcher soeben von seinem Ausgange zurückkehrt,« antwortete der Yerbatero. »Nur immer hinein, hinein!«
Er schob mich; ich schob die Sennorita, und diese schob den Bravo zur Seite. So gelangten wir in die Stube, denn die Türe führte aus dem Freien direkt in dieselbe. Ich hatte das erbeutete Messer bei mir und griff nach demselben. Die Sache kam mir verdächtiger vor, als sie war. Eine Art von Mißtrauen wollte sich auch gegen den Yerbatero in mir regen. Ich kannte ihn eigentlich noch gar nicht. Sein Benehmen ließ immerhin die Möglichkeit offen, daß er ein Mitglied der saubern Bande sei. Aber mein Vertrauen wurde augenblicklich wieder hergestellt, als ich bemerkte, daß noch fünf Yerbateros hinter mir sich hereindrängten. Jeder von ihnen hatte sein Messer in der Hand. Das Haus hatte keine Glasfenster und die Läden standen offen. Nur aus dem Parterre bestehend, war es durch eine dünne Wand in zwei Hälften geteilt. Die Verbindungstüre war geschlossen. Auf einem in der Ecke stehenden Stuhle saß eine alte, sehr runzelige Frau, deren Augen mit sichtbarer Sorge auf den vielen Menschen ruhten, welche so unerwartet eingetreten waren. Einige am Boden liegende Strohmatten und ein Schemel, welcher als Tisch benutzt zu werden schien, bildeten das Meublement dieses Raumes.
Der Sobrino machte auch große Augen, als er die Yerbateros bemerkte.
»Wer sind Sie? Was wollen Sie? Wer hat Ihnen erlaubt, hier einzutreten?« fragte er.
»Wir selbst,« antwortete Monteso. »Dieser Sennor hat die Sennorita beschützt, und wir beschützen ihn. So hängt einer am andern, und wir sind mit ihm gekommen. Wo befindet sich denn der liebe Pate mit seinem Sohne?«
»Jedenfalls hier neben,« antwortete das Mädchen schnell, auf die Verbindungstüre zeigend. »Ich werde sie holen.«
»Ja, tun Sie das! Ich möchte die liebenswürdige Gesellschaft vollständig kennen lernen.«
Sie ging in den Nebenraum. Die Yerbateros standen unbeweglich an der Eingangstüre; die Alte saß starr in ihrem Stuhle und sagte kein Wort; Mauricio Monteso musterte den Bravo mit einem verächtlichen Blicke und fragte ihn:
»Haben wir uns nicht heute bereits getroffen, Sennor? Sie standen doch in der Nähe des Geschäftes des Sennor Tupido?«
»Es ist möglich, daß ich da vorübergegangen bin.«
»Nein, Sie standen wartend da. Und sodann hatten Sie sich um die Ecke der Plaza gegenüber der Confiteria aufgestellt, sind durch mehrere Straßen bis zum Dome gegangen, in welchem Sie gewartet haben, bis das Orgelspiel zu Ende war.«
»Sennor, was gehen Sie meine Spaziergänge an!«
»Sie interessieren mich außerordentlich, wenigstens heute haben sie das getan. So weiß ich auch, daß Sie dann bis an das Häuschen gegangen sind, in welchem der Organista wohnt. Und eigentümlich, daß überall, wo Sie gingen, gerade dieser Sennor vor Ihnen ging! Und noch viel eigentümlicher, daß da, wo Sie gingen, ich mit diesen meinen Kameraden Ihnen folgte!«
»Ich habe mit Ihnen nichts zu schaffen!«
»Aber wir mit Ihnen. Leider war es uns nicht vergönnt, Ihnen bis zum Hause des Organisten zu folgen; wir wurden gestört. Glücklicherweise aber gelang Ihr Vorhaben nicht, welches Sie dort ausführen wollten. Dieser Sennor bedurfte unseres Beistandes nicht, da er selbst auf seiner Hut war. Er begab sich zu Sennor Tupido, und Sie hatten sich indessen hierher verfügt. Sie sprachen mit dem Bewohner dieses Häuschens und bemerkten nicht, daß ich draußen am Fenster stand und alles hörte.«
Der Bravo erbleichte.
»Was Sie mir da sagen, ist mir vollständig fremd,« wendete er ein. »Ich weiß von alledem kein Wort.«
»Leugnen Sie immerhin! Wir aber sind unserer Sache gewiß.«
»Ich bin erst vor einigen Minuten hier angekommen und vorher heute noch nicht dagewesen. Fragen Sie den Wirt, wenn er jetzt zurückkehrt!«
»Er ist bereits da, und wir haben ihn gefragt. Er liegt draußen neben dem Häuschen, denn er ist mit einem Lasso gebunden, und er hat uns alles eingestanden.«
»So ein Dummkopf!«
»O, wenn man Ihnen die Spitze eines guten Messers auf die Brust setzen würde, so glaube ich nicht, daß Sie klüger handeln würden. Und wenn Sie nicht gestehen, werden wir dieses Experiment versuchen.«
»So zeige ich Sie an und lasse Sie bestrafen!«
»Das werden Sie wohlweislich unterlassen, denn Sie wissen gar wohl, daß die Polizei keine allzu gute Freundin von Ihnen ist.«
Da hielt ich ihm sein Messer hin und fragte:
»Jedenfalls ist Ihnen dieses Messer wohlbekannt. Wollen Sie das leugnen?«
Er warf einen kurzen Blick darauf und antwortete:
»Das Messer habe ich noch nie gesehen. Lassen Sie mich mit Ihren Fragen in Ruhe!«
Ich sah jetzt unter dem Kopftuche eine zerschundene Stelle seines Gesichtes.
»Bei welcher Gelegenheit sind Sie hier blessiert worden?« fragte ich ihn, indem ich auf die betreffende Stelle deutete. »Das ist wohl geschehen, als ich Sie an die Mauer des Hauses des Organista warf?«
Jetzt wurde er grob:
»Bekümmern Sie sich doch um Ihr eigenes Gesicht, für welches ich das meinige nicht umtauschen möchte! Sie haben nichts zu fragen, nichts zu sagen und nichts zu befehlen. Packen Sie sich fort, sonst werden Sie hinausgeworfen!«
»Nachdem Sie mich vorher so höflich eingeladen haben!«
»Das tat ich, weil ich Sie für einen Caballero hielt. Jetzt sehe ich ein, daß ich mich in Ihnen geirrt habe. Denken Sie nur nicht, daß ich mich vor Ihnen fürchte! Ich stehe nicht allein gegen Sie, sondern ich werde mir Hilfe holen.«
Er öffnete die Nebentüre und rief hinaus:
»Komm heraus, Pate! Hier sind Leute, welche Fäuste oder Messer sehen wollen.«
Anstatt des Gerufenen kam die Sennorita herbei. Sie erklärte mit zufrieden lächelndem Gesicht:
»Der Pate ist gar nicht mehr da. Als ich ihm sagte, welchen Besuch wir haben, ist er mit seinem Sohne durch das Fenster hinausgestiegen, denn er meinte, daß es nicht seine Leidenschaft sei, mit Yerbateros zu verkehren.«
»Welche Feigheit! Durch das Fenster zu steigen und mich hier allein zu lassen! Aber ich fürchte mich dennoch nicht. Macht Platz, Leute! Wer mich anrührt, bekommt das Messer!«
Er zog ein Messer hervor, welches er sich indessen wohl geborgt hatte, und wendete sich nach der Türe. Ich trat zurück, um ihn vorüber zu lassen. Das war eine Falle, in welche er lief, denn kaum wendete er mir den Rücken zu, so umfaßte ich ihn von hinten und drückte ihm die Arme fest an den Leib. Einer der Yerbateros schlang sich den Lasso von den Hüften und band den Bravo mit demselben. Der Kerl versuchte zwar sich zu wehren, doch ohne allen Erfolg. Er schrie und schimpfte aus Leibeskräften, bis ihm der Mund mit seinem Kopftuche zugebunden wurde.
Während wir uns mit ihm beschäftigten, sah ich, daß die liebenswürdige Sennorita zur Türe hinausschlüpfte. Auch die alte Frau erhob sich von ihrem Stuhle und glitt mit einer Schnelligkeit hinaus, welche man ihr gewiß nicht zugetraut hätte. Die andern achteten nicht darauf. Ich hätte die beiden zurückhalten können, tat es aber nicht, da es mir keinen Nutzen bringen konnte.Als der Bravo gebunden war, sagte Monteso:
»Nun haben wir auch diesen fest. Holt jetzt den anderen herein!«
Zwei gingen hinaus, um diesen Befehl auszuführen. Ich freute mich im voraus auf die Gesichter, welche sie bei ihrer Rückkehr machen würden. Nach geraumer Zeit kamen sie wieder. Der eine von ihnen kratzte sich verlegen sein struppiges Haar und meldete:
»Der Halunke ist fort. Wir haben die ganze Umgebung des Hauses durchsucht.«
»Aber wir haben ihn doch ganz sicher neben der Mauer hingelegt, und er hat sich doch nicht von dem Lasso befreien können!«
»So haben andere ihn von demselben befreit,« sagte ich. »Der Pate ist mit seinem Sohne entwichen; die Alte ist mit ihrer Enkelin auch fort. Diese vier Personen genügen wohl, einen Lasso aufzubinden.«
»Alle Teufel! Sie sind fort?« fragte er, nun erst nach den Frauen sich umschauend. »Das habe ich gar nicht bemerkt. Nun ist freilich der Kerl auch fort und mein Lasso mit ihm! Das hat man davon, wenn man nicht aufpaßt! Na, wenigstens haben wir diesen Halunken noch; er ist der Hauptkerl und soll nun auch für die andern zahlen. Was tun wir mit ihm, Sennor?«
Diese Frage war an mich gerichtet. Ich zuckte die Achsel.
»Ich kenne die hiesigen Gesetze nicht und bin auch nicht der Richter, welcher ihm sein Urteil zu sprechen hat.«
»Pah, Richter! Wollten wir diese Sache der Polizei und dem Gerichte übergeben, so hätten wir tausend Scherereien. Wir müßten als Zeugen bis nach beendetem Prozesse hier bleiben und würden indessen von den Freunden dieses Kerls bei Seite geschafft. Vielleicht käme die Behörde gar auf den Gedanken, uns alle einzusperren, damit wir uns ja nicht vorzeitig entfernen könnten. Ich kenne das. Nein, die Richter sind wir selbst. Das ist das Kürzeste und Beste. Und nach den Gesetzen oder nach dem Urteile, welches das Gericht fällen würde, frage ich auch nicht. Ich selbst mache das Gesetz. Im Urwalde ebenso wie in der Pampa ist es Sitte, einen Mörder einfach für immer unschädlich zu machen. Man gibt ihm das Messer oder eine Kugel in den Leib. Das werden wir auch tun.«
»Nein, Sennor, damit bin ich nicht einverstanden.«
»Aber, warum denn nicht?«
»Weil ich weder der Richter noch der Henker dieses Mannes bin.«
»Aber das sollen Sie auch gar nicht sein, sondern wir wollen es übernehmen.«
»Sie haben mit dieser Angelegenheit gar nichts zu tun; sie ist allein meine Sache, weil ich beleidigt bin.«
»Caramba! Jetzt laufe ich seit Nachmittag hinter dem Halunken her, nehme dazu sogar den Beistand meiner Kameraden in Anspruch; es gelingt mir auch, den Mord zu verhüten, und da soll mich diese Sache jetzt nichts angehen? Hat man schon so etwas gehört! Sie haben mir eine große Wohltat erwiesen, Sennor; Sie sind also mein Freund; was man meinem Freunde tut, das ist ganz so, als ob es mir selbst getan wird; wenigstens ist das der Gebrauch unter den Yerbateros. Man hat Sie morden wollen; das gilt gleich einem gegen mich selbst gerichteten Mordversuch, den ich unbedingt bestrafen muß.«
»Wäre ich ermordet worden, so könnten Sie als mein Freund mich rächen; da mir aber nicht das mindeste Leid geschehen ist, so bitte ich Sie, die Sache auf sich beruhen und den Kerl laufen zu lassen!«
»Herr, man merkt, daß Sie ein Deutscher sind. Bekommen in Ihrem Vaterlande die Mörder vielleicht einen Orden oder irgend eine andere Belohnung und Auszeichnung? Bedenken Sie doch: wenn Sie ihm die Freiheit geben, so wird er dieselbe sofort benutzen, den bisher verunglückten Anschlag gegen Sie besser auszuführen!«
»Er mag es versuchen! Ich kenne seine Absichten nun so genau, daß ich sie nicht zu fürchten brauche. Prügelt ihn tüchtig durch, wenn Ihr wollt. Vielleicht macht ihn das willig, uns zu sagen, von wem er seinen Auftrag, mich zu ermorden, erhalten hat.«
»O, das zu erraten, ist kinderleicht; aber er soll es uns dennoch sagen müssen. Wie viele Hiebe soll er erhalten?«
»Ihr schlagt so lange, bis er gesteht, wer ihn gegen mich gedungen hat. Dann aber erhält er keinen einzigen Schlag weiter. Ich mag nicht dabei sein. Ich mag den Menschen überhaupt nicht mehr sehen.«
Ich ging hinaus und schritt suchend einige Male um das Haus. Es war keine Spur von den Bewohnern desselben zu sehen. Ich hörte deutlich die Hiebe fallen, welche der Bravo erhielt, doch vernahm ich keinen Schmerzenslaut. Als zehn Minuten vergangen waren, öffnete ich die Türe und sah hinein. Der Kerl lag auf dem Bauche. Seine Hose war zerschlagen und blutig gefärbt, und doch grinste er mir mit einem höhnischen Lachen in das Gesicht. Er hatte nichts gestanden, überhaupt keinen Ton, keine Silbe hören lassen, er schien die Nerven eines Nilpferdes zu besitzen.
»Sennor, was meinen Sie?« fragte Monteso. »Er gesteht nichts, und wenn wir fortfahren, so schlagen wir ihn tot.«
»Er hat genug. Laßt ihn liegen! Ich kenne ohnedies den Mann, von welchem er seinen Auftrag erhalten hat.«
»Gut, so mag er liegen bleiben. Wir schließen ihn ein, so daß man nicht sogleich zu ihm kann. Besser aber ist es, wir löschen das Licht aus und bleiben hier, um die Bewohner dieses Hauses abzufangen.«
»An ihnen liegt mir nichts. Ich mag nichts mehr von ihnen hören.«
»Gott segne Ihre Milde, Sennor, aber sie ist nicht angebracht. Wenn mich ein Ungeziefer beißt, so mache ich es tot, sonst beißt es mich wieder. Doch, ganz wie Sie wollen. Laßt uns also gehen!«
Er kam mit den andern heraus, schloß die Türe zu und warf den Schlüssel von sich. Wir gingen über die Blöße zurück und bogen dann in die Straße ein. So gelangten wir in die Stadt, ohne belästigt worden zu sein. Wir hatten unterwegs gar nicht gesprochen.
»Gehen Sie sofort in Ihr Hotel?« fragte mich Monteso. »Oder würden Sie uns die Ehre erweisen, ein Gläschen mit uns zu trinken, Sennor. Sie würden uns dadurch außerordentlich erfreuen.«
Ich hatte dem Manne mein Leben zu verdanken und mochte ihn also nicht durch die Zurückweisung dieser freundlichen Einladung betrüben oder gar beleidigen. Darum nahm ich dieselbe an.
Er führte mich von der Hauptstraße in eine der Querstraßen, wo wir in ein unscheinbares Haus traten, dessen Schild anzeigte, daß es eine gewöhnliche Schenke sei.
Zigarettenqualm und wüstes Geschrei drang uns aus der halb offenen Türe der Gaststube entgegen. Schon bereute ich, mitgegangen zu sein; aber Monteso trat nicht in diese Stube, sondern er klopfte an eine Türe, hinter welcher die Küche zu liegen schien. Ein junges, sauberes Weibchen kam heraus und machte ihm einen tiefen Knix.
»Ist oben offen?« fragte er.
»Ja. Es sind einige Sennors da, und meine Schwester ist zur Bedienung oben.«
»So gehen wir hinauf. Sorgen Sie dafür, daß wir nicht von Gesindel belästigt werden!«
Das klang in einem ganz andern Tone, so bestimmt, als ob er von Jugend an gewöhnt sei, Befehle zu erteilen. Sie verneigte sich abermals wie vor einem gebietenden Herrn, und dann stiegen wir die Treppe hinauf.
Droben kamen wir erst in ein kleineres Vorzimmer, in welchem einige Hüte hingen und Stöcke in einem eleganten Halter standen. Monteso schlug eine Plüschportiere zurück, und wir traten in einen schmalen, langen Salon, welcher reich ausgestattet war. Einige Lustres verbreiteten beinahe die Helle des Tages. Die Tische hatten Marmorplatten; Stühle und Diwans waren mit roten Plüsch überzogen. Auf jedem Tische stand eine Flaschenkollektion mit Weinen verschiedener Sorten. Kurz und gut, der Salon hätte in das feinste Hotel einer europäischen Großstadt gepaßt.
Vom Büffet erhob sich ein junges Mädchen, um uns mit tiefen Verbeugungen zu grüßen. An einem Tische saßen vier Herren, welche ihrer Kleidung nach den besten Ständen angehörten. Auch sie grüßten höflich. Einer von ihnen reichte sogar Monteso in kordialer Weise die Hand.
Und hier verkehrten die Yerbateros? Die andern fünf waren ebenso lumpig gekleidet, wie Monteso. Sie gingen barfuß. Ihre Hüte waren in Summa keine fünfzig Pfennige wert. Haare und Bärte waren ungepflegt. Keiner schien sich später als vor Monaten gewaschen zu haben. Ich war erstaunt, ließ aber natürlich nichts davon merken.
Monteso schritt zum hintersten Tische, welcher so groß war, daß wir alle Platz an demselben fanden, gab einen Wink, uns da niederzusetzen, und kehrte zum Büffet zurück, um eine Bestellung zu machen.
Das Mädchen nahm die auf dem Tische stehenden Flaschen weg und brachte andere an deren Stelle. Zu meinem Erstaunen las ich Etiketten wie »Chateau Yquem«, »Latour blanche« und »Haut-Brion«. Wenn diese Weine echt waren, so paßte der Preis derselben freilich nicht zu den nackten Füßen derer, welche die Flaschen leeren wollten.
Monteso setzte sich mir gegenüber, machte mir eine freundlich höfliche Verbeugung und sagte:
»Da ich Sie seit Mittag beobachtet habe, Sennor, so weiß ich genau, daß Sie noch nicht zur Nacht gespeist haben. Denn bei Tupido sind Sie so kurze Zeit gewesen, daß Sie ganz unmöglich an seiner Tafel gegessen haben können. Wir ersuchen Sie daher, unser Gast zu sein und ein Abendbrot mit uns einzunehmen. Freilich können wir Ihnen eben nur das bieten, was arme Yerbateros zu essen pflegen, wenn sie sich einmal in einer Stadt befinden. Es ist frugal genug.«
»Das scheint allerdings so,« lachte ich, indem ich auf die Flaschen deutete. »Wenn das Brot, welches Sie genießen, zu diesem Wasser paßt, so möchte ich wohl alles, aber nur nicht Yerbatero sein.«
»Vielleicht ist es nicht ganz so schlimm, wie es den Anschein hat. Hoffentlich werden Sie unsere Art und Weise näher kennen lernen, denn ich schmeichle mir, daß wir noch sehr oft so wie heute beisammen sitzen werden, wenn auch nicht hier an diesem Orte.«
Er entkorkte einige Flaschen, füllte die Gläser und stieß auf die Fortdauer unsrer jungen Bekanntschaft an. Dann zog er eine, wie es schien, reich gefüllte Brieftasche hervor und reichte mir aus derselben die Geldnoten zurück, welche ich ihm heute geliehen hatte.
»Erlauben Sie mir, gegen unsre heutige Vereinbarung handeln zu dürfen!« sagte er dabei. »Eigentlich müßte ich kündigen und hätte erst übers Jahr zu zahlen. Da die Sache aber meinerseits nichts als Scherz war, so bitte ich, es als solchen aufzufassen. Ich bin keineswegs der arme Mann, für den Sie mich hielten, doch freue ich mich Ihres Irrtumes, da er mir Gelegenheit gegeben hat, Sie kennen zu lernen. Leute von Ihrer Herzensgüte mag es unter den Deutschen viele geben; hier aber sind dieselben äußerst selten. Darum habe ich Sie sofort in mein Herz geschlossen und meinen Kameraden von Ihnen erzählt. Sie können in jeder Beziehung auf unsere Freundschaft rechnen.«
Ich suchte zwar mein Erstaunen möglichst zu verbergen, brachte es aber doch nicht über mich, die Frage zurückzuhalten:
»Aber, Sennor, wenn Sie so viel besser situiert sind, als es den Anschein hatte, warum ließen Sie sich da bei dem hochnasigen Tupido herab, ihm wegen lumpiger zweihundert Papiertaler so viele gute Worte zu geben?«
»Um ihn zu täuschen, Sennor. Wir sind ehrliche Leute, und derjenige, welcher uns Vertrauen schenkt, der wird sich niemals getäuscht fühlen. Wer uns ehrlich bezahlt, der erhält auch ehrliche Ware und kann sich in jeder Beziehung auf uns verlassen. Dieser Tupido aber ist ein Betrüger, ein Schwindler, und darum haben wir ihn ausgewischt. Ich weiß, daß Sie es ihm nicht wieder sagen. Die Probe, welche er von unserm Tee untersucht und auch getrunken hat, war ausgezeichnet; aber des Nachts haben wir in seinem eigenen Magazin, zu welchem wir uns Zugang geschafft hatten, die Pakete umgetauscht. Er hat unter den vielen Zentnern Tee, welche nach seiner Ansicht in seinem Vorratshause liegen, nicht so viel wirklichen Tee, wie man mit drei Fingerspitzen fassen kann.«
»Ah! Sennor, das ist aber Betrug!«
»Betrug? Sie sind ein Deutscher, und jedem andern als Ihnen würde ich dieses Wort sehr übel nehmen. Was nennen Sie Betrug? Ist es Diebstahl, wenn ich dem Diebe das, was er mir gestohlen hat, heimlich wieder abnehme?«
»Warum nicht durch das Gericht?«
»Weil dies ihm gegenüber vielleicht machtlos ist. Bleiben Sie mir mit den Gerichten fern! Werden mir hier tausend Pesos gestohlen, und ich zeige den Dieb an, so kostet es mich vielleicht zwei oder gar drei Tausend, um das eine Tausend zurück zu erhalten, und dabei geht der Dieb wahrscheinlich straflos aus. Unsere Diebe haben nämlich die Angewohnheit, nebenbei Beamte zu sein. Auch stehlen sie niemals, sondern die Sachen kommen ihnen des Nachts in die Häuser gelaufen. Da hilft man sich denn am liebsten selbst. Tupido hat uns betrogen, und wir haben ihn nun ausgezahlt, ohne uns an die Behörde zu wenden. Wir fühlen uns in unserm Rechte und denken nicht, uns darüber ein böses Gewissen machen zu müssen. Die zweihundert Taler habe ich ihm hingeschickt. Ich ließ ihm sagen, daß es mir gelungen sei, sie geborgt zu erhalten. Und nun sind wir mit ihm fertig. Sie kennen das Leben eines Yerbatero nicht. Es gehört zu den mühseligsten und gefährlichsten, welche es gibt, und wir wollen nicht täglich unsre Gesundheit und unser Leben wagen, um Sklaven zu bleiben und Betrüger zu Millionären zu machen.«
»Ich habe allerdings keine Ahnung von den Gefahren, denen ein Teesammler ausgesetzt ist. Welche Lebensgefahr könnte es dabei geben, wenn man in einer wohlangelegten Teepflanzung die Blätter der Sträucher oder Bäume sammelt?«
»Wären Sie nicht unser Gast, so würden wir Sie vielleicht ein wenig auslachen, Sennor. Sie sprechen von wohlangelegten Pflanzungen. Sie meinen Teeplantagen? Zur Erntezeit begeben sich dann die Arbeiter in diesen Garten und pflücken die Blätter ab?«
»So ungefähr habe ich es mir vorgestellt, ganz analog der Art und Weise, wie der chinesische Tee kultiviert wird.«
»Dachte es mir. Aber da befinden Sie sich in einem gewaltigen Irrtume, Sennor. Ich werde Ihnen das erklären, wenn wir bedient worden sind.«
Das Mädchen begann jetzt nämlich, den Tisch zu decken. Was machte ich für Augen, als diese barfüßigen Leute silberne Bestecke vorgelegt erhielten! Das Geschirr bestand aus feinstem Sévres, und was die Speisen betraf, so konnte man sie im besten Restaurant eines Pariser Boulevards oder unter den Linden nicht besser haben. Es gab außer der Suppe sechs Gänge und zuletzt feines Backwerk und die Früchte dreier Erdteile in Menge. Dabei machte der Yerbatero den Wirt in der Weise eines Schloßherrn, welcher gewohnt ist, zu repräsentieren. Und während er mit der Eleganz einer Hofdame speiste und mir immer nur das beste zuteilte, fuhr er in seiner Erklärung fort:
»Der echte Yerbatero holt den Tee aus den Urwäldern, oft aus Gegenden, welche nie eines Menschen Fuß betrat, aus Gegenden, in denen er jeden Schritt breit den Jaguars, Pumas, Krokodilen und wilden Indianern abzukämpfen hat. Haben Sie davon noch nichts gehört?«
»O doch, aber ich habe geglaubt, daß dies nur ausnahmsweise vorkomme. Ich bin gespannt, etwas Näheres über das Leben des Yerbatero zu hören.«
»Nun, was im allgemeinen darüber gesagt werden kann, das ist sehr bald mitgeteilt. Der Yerbatero geht natürlich nicht allein in die Wildnis. Ein Unternehmer engagiert zehn, zwanzig oder auch dreißig von ihnen und sorgt für ihre Ausrüstung. Er versieht sie mit Ponchos und andern Kleidungsstücken, mit Messern, Äxten, Waffen, Branntwein, Tabak und sonstigen Bedürfnissen. Sodann muß eine hinlängliche Anzahl von Stieren zusammengebracht werden, deren Fleisch während der Zeit des Sammelns als Nahrung dient und deren Felle zum Einpacken des Tees verwendet werden. Die Gesellschaft der Yerbateros wählt oder erhält einen Anführer, dem alle während der Saison unbedingt zu gehorchen haben. Dann wird aufgebrochen. Im Urwalde angekommen, bestimmt der Anführer die Stelle, an welcher das Lager errichtet werden soll. Von da aus zerstreuen sich die Yerbateros je zwei und zwei nach den verschiedenen Richtungen, um zu arbeiten. Man sammelt diejenigen kleinen Zweige, welche viele Blätter und junge Schößlinge besitzen, beschneidet sie und trägt sie in den Ponchos oder mittelst Riemen zweimal des Tages nach der Hütte, in welcher man zusammentrifft, um das Mittags- und Abendbrot zu essen. Diese Arbeit wird je nach den Umständen wochen- und auch monatelang fortgesetzt. Sind eine hinreichende Menge von Yerbazweigen vorhanden und auch genug Ochsen geschlachtet, deren Felle als Emballage dienen, so wird in der Nähe der Hütte ein hohes Gestell errichtet, unter welchem die Erde so hart und fest wie möglich geschlagen werden muß. Auf dieses Gerüst legt man die gesammelten Zweige und brennt unter demselben ein Feuer an, welches die Zweige leicht anrösten muß. Ist das geschehen, so wird die Asche entfernt und man nimmt die Yerba vom Gerüste, um sie auf dem heißen Erdboden vollends zu dörren, damit sie die nötige Sprödigkeit erhalten, um zu Pulver zerrieben werden zu können. Dieses letztere geschieht, indem man sie mit Stöcken tüchtig klopft. Indessen sind die Ochsenfelle je in zwei Teile zerschnitten, gehörig eingeweicht und dann so zusammengenäht worden, daß Säcke oder Ballen entstehen, welche fast würfelförmige Form besitzen. In diese Ballen wird das Pulver gepackt und so fest mit hölzernen Schlägeln bearbeitet, daß der Pack, wenn er oben zugenäht worden ist, die Härte eines Steines besitzt. So ein Ballen ist nicht groß, kann aber leicht bis gegen dreihundert Pfund wiegen.«
»Ich höre, daß das Teesammeln allerdings etwas anderes ist, als ich mir gedacht habe. Es gleicht dem Leben eines Fallenstellers oder eines Bienenjägers in den Vereinigten Staaten.«
»Dieser Vergleich ist sehr zutreffend, wenn auch nicht erschöpfend. Sie werden andrer Meinung sein, wenn Sie Länder und Völker durch den Augenschein kennen lernen.«
»Das ist eben mein Bestreben. Darum reise ich! Ganz besonders wollte ich die Pampas kennenlernen.«
»Den Urwald nicht?«
»Natürlich auch.«
»Und sind Sie an eine bestimmte Zeit gebunden? Gibt es einen Zeitpunkt, an welchem Ihre Reise zu Ende sein muß?«
»Nein. Ich bin vollständig Herr meiner Zeit.«
»Aber, Sennor, was hält Sie denn ab, mit uns auf einige Wochen nach dem Urwalde zu kommen?«
»Eigentlich gar nichts.«
»So kommen Sie doch mit uns! Lernen Sie das Leben eines Yerbatero kennen! Haben Sie vielleicht schon einmal vom Gran Chaco gehört? Eine hochinteressante Gegend, wie Sie erfahren werden, wenn Sie sich entschließen, mit uns zu kommen. Wir treffen dort den Sendador, welchen ich Ihnen als den besten Führer empfohlen habe. Er wartet auf uns. Ich habe da etwas Besonderes zu tun.«
»Darf ich nicht erfahren, welches dieser Grund ist?«
»Hm!« brummte er. »Es ist eigentlich ein Geheimnis; aber Ihnen können wir es anvertrauen, vorausgesetzt, daß Sie uns nicht auslachen wollen.«
»Was denken Sie von mir, Sennor! Ich, der Neuling, welcher von den hiesigen Verhältnissen so gut wie gar nichts kennt, sollte Sie auslachen, Männer, welche mir so weit überlegen sind, wie ein Professor dem Schulknaben!«
Der Yerbatero strich sich geschmeichelt den Bart, warf einen fragenden Blick auf seine Kameraden, und als sie ihm beistimmend zunickten, wendete er sich an mich:
»Sie sind jahrelang bei den nördlichen Indianern gewesen und verstehen also, mit Waffen und Pferden umzugehen. Heute habe ich bemerkt, daß Sie geistesgegenwärtig sind und mehr Kenntnisse haben, als wir sechs zusammen genommen. Ich denke also, daß Sie der Mann sind, welchen wir brauchen können. Ich werde Ihnen einen Vorschlag machen. Vorher aber muß ich eine Frage aussprechen, um deren aufrichtige Beantwortung ich Sie dringend ersuche.«
»Fragen Sie!«
»Gut! Ich werde fragen. Aber lachen Sie uns ja nicht aus. So sagen Sie uns einmal, was würden Sie tun, wenn Sie einen Ort wüßten, an welchem ein Schatz vergraben liegt?«
»Ich würde den rechtmäßigen Besitzer darauf aufmerksam machen.«
»Rechtmäßigen Besitzer! So! Hm! Aber wenn nun kein solcher rechtmäßiger und überhaupt kein Besitzer vorhanden wäre?«
»So würde ich den Schatz für mich heben.«
»Verstehen Sie sich denn auf Magie?«
»Unsinn! Magie gibt es gar nicht. Und Magie hat man nicht nötig, um einen Schatz zu heben. Weiß man, wo einer vergraben liegt, da mag man getrost nachgraben, zu jeder beliebigen Zeit des Tages oder der Nacht; man wird ihn sicher finden.«
»So! Hm!« brummte er nach seiner Gewohnheit. »Wenn das wahr wäre, so sollte es mich freuen.«
»Es ist wahr.«
»Nun, Sennor. Sie sind gelehrter als wir alle und wie Sie Ihre Überzeugungen vorbringen, haben sie einen Klang, daß man ihnen glauben muß. Ich sehe ein, daß Sie der Mann sind, den wir brauchen. Wir wissen nämlich einen Ort, an welchem ein Schatz zu heben ist, sogar zwei solche Orte.«
»So eilen Sie hin, die Schätze schleunigst zu heben.«
»Hm! Ja, wenn das so schnell ginge! Ich bin schon dort gewesen, habe aber nichts entdeckt. Den Ort kennen wir ganz genau; aber die betreffende Stelle konnten wir nicht finden, weil wir nicht gelehrt genug waren, die Schrift zu verstehen.«
»Aha! Es handelt sich also um eine Schrift?«
»Ja, leider! Sie sind ein Gelehrter, und darum – –«
»Bitte!« unterbrach ich ihn. »Muten Sie mir nicht zu viel zu. In welcher Sprache ist die Schrift verfaßt?«
»In der Inkasprache, aber mit lateinischen Buchstaben geschrieben, im sogenannten Khetschua.«
»Das ist im höchsten Grade interessant, zumal für mich!«
»Warum für Sie?«
»Ich habe während meines Aufenthaltes unter den nordamerikanischen Indianern mich sehr bemüht, ihre Sprachen zu erlernen. Ebenso habe ich, bevor ich jetzt nach Südamerika ging, mir einige Bücher gekauft, welche die Sprachen der hiesigen Indianerstämme behandeln. So habe ich mich über zwei Monate lang mit dem Khetschua beschäftigt. Also muß die Schrift, von welcher Sie sprachen, mich lebhaft interessieren. Wer ist denn im Besitze derselben?«
»Eben der Kamerad, welchen ich Ihnen als den besten Sendador empfohlen habe.«
»Er ist der Eigentümer des Dokumentes?«
»Ja. Er hat es von einem sterbenden Mönch erhalten.«
»Warum wurde gerade ihm das Geschenk gemacht?«
»Weil er den Mönch als Führer begleitete. Sie waren nur zu zweien. Kein Mensch befand sich bei ihnen. Er brachte den frommen Herrn von jenseits der Anden herüber und sollte ihn bis nach Tucuman ins Kloster der Dominikaner geleiten. Unterwegs aber wurde der Padre, welcher sehr alt war, plötzlich so krank, daß er starb. Kurz vor seinem Tode übergab er dem Sendador die Schrift. Ich habe die Schrift gesehen. Es sind zwei Zeichnungen dabei.«
»Konnten Sie sie nicht lesen?«
»Nein. Aber der Sendador ist ein halber Gelehrter. Er hat sie Jahre lang durchstudiert. Er glaubte, seiner Sache ganz sicher zu sein und nahm mich mit an die beiden Orte, aber er hatte sich doch nicht richtig informiert, denn wir fanden nichts.«
»Hat er Ihnen denn nichts über den Inhalt der Schrift mitgeteilt?«
»Alles, was er wußte.«
»Darf ich das erfahren, was Sie sich gemerkt haben?«
»Jener Padre war ein gelehrter Mann. Er hatte sich die Erlaubnis ausgewirkt, nach Peru zu gehen und gelehrte Schnuren aufbinden zu dürfen – –«
»Nicht aufknüpfen? Sie meinen entziffern.«
»Ja. Es hat da ein Volk gegeben, die Inkas genannt, welche, anstatt zu schreiben, Schnuren knüpften. Ich habe gewußt, wie diese Schnuren genannt werden, es aber wieder vergessen.«
»Khipus?«
»Ja, so war das Wort.«
»Jeder Khipus besteht aus einem Schnurenbündel, das heißt aus einer Hauptschnur, an welche dünnere Nebenschnüre von verschiedener Farbe verschiedenartig angeknoten wurden. Jede Farbe und jede Art der Knoten hatte ihre eigene Bedeutung.«
»So ist es. Grad so hat mir auch der Sendador gesagt. Solcher Khipus sollen viele vergraben und verborgen liegen. Der Padre hat nach ihnen gesucht und auch welche gefunden. Er hat sich lange, lange Jahre bemüht, ihre Bedeutung zu enträtseln, und das ist ihm endlich auch gelungen. Eine alte Indianerin, welche er von einer Krankheit geheilt hatte und die ihm deshalb wohl wollte, schenkte ihm zwei Khipus, welche sie von ihren Vorfahren überkommen hatte. Sie konnte sie nicht lesen, aber sie hatte überliefert bekommen, daß es sich um große Schätze handle. Der Padre hat auch diese beiden enträtselt. Über die anderen Khipus hat er ein Buch geschrieben, welches aber nicht gedruckt worden ist. Den Inhalt dieser beiden hat er geheim gehalten; er hat sie nach Tucuman bringen wollen und sie vorher übersetzt, oder, wie es wohl richtiger ist, die Knoten und Farben in Buchstaben verwandelt. Leider ist er, wie bereits erwähnt, unterwegs gestorben und hat die Übersetzung dem Sendador vermacht.«
»Nicht auch die Khipus?«
»Nein. Die hat er in Peru in seiner Sammlung gelassen, wohin er zurückkehren wollte.«
»Hm! Vielleicht ist er nur der Schätze wegen über die Anden gegangen. Und nach Tucuman hat er gewollt, zu den Dominikanern?«
»Ja.«
»So kommt mir Ihr Sendador verdächtig vor.«
»Warum?«
»Sagen Sie mir erst, was Sie über den Inhalt des Schreibens wissen.«
»Nun, es hat zwei berühmte Inkas gegeben, welche sich durch sehr glückliche Kriegszüge ausgezeichnet haben. Während dieser Kriege sind große Schätze versteckt worden, welche bis heute noch nicht gehoben sind. Eine Stadt hat am See gelegen. Die Bewohner derselben haben, bevor die Belagerung begann, alle ihre silbernen und goldenen Gefäße in den See gesenkt. Sie wurden besiegt und ausgerottet. Die Schätze liegen noch jetzt auf dem Grunde des Sees, und niemand, als nur der eine Khipus, weiß davon.«
»Wie aber ist dieser Khipus erhalten worden? Er hat sich doch in der betreffenden Stadt in Verwahrung befunden?«
»Es ist einigen gelungen, zu entfliehen. Die haben ihn mitgenommen. Sie haben sich nach einem höher im Gebirge gelegenen Orte geflüchtet; aber auch dorthin ist der Sieger ihnen gefolgt. Die Bewohner dieses letzteren Ortes haben ihre Schätze in einen alten Schacht versteckt und den Eingang desselben so vermauert, daß er von seiner Umgebung nicht zu unterscheiden gewesen ist. Da sie sich nicht freiwillig ergeben haben, sind auch sie getötet worden. Einer war nicht tot, sondern nur verwundet. Er ist des Nachts davongekrochen und entkommen. Später kehrte er zurück in das Haus des Kaziken des Ortes, wo die Khipus verborgen lagen. Das Haus lag in Trümmern, aber das Versteck war unversehrt. Der Mann nahm die beiden Khipus mit sich. Er fand keine Gelegenheit, sie zu benutzen; vielleicht konnte er sie nicht einmal lesen, denn der Sendador sagte mir, daß nicht alle Inkas die Knoten haben lesen können. Der Mann vererbte die Khipus weiter, bis sie an die Frau kamen, welche sie dem Padre gab.«
»Sennor, wenn das kein Roman ist, so gibt es überhaupt keinen Roman.«
»Sie glauben mir nicht?«
»Ihnen glaube ich gern; aber das, was man Ihnen gesagt hat, möchte ich bezweifeln.«
»Der Sendador belügt mich nicht!«
»Mag sein. Vielleicht hat er sich selbst getäuscht. Es kommen in dieser Geschichte einige bedeutende Unwahrscheinlichkeiten vor. Und dann habe ich den Sendador im Verdachte der Unterschlagung.«
»Meinen alten, ehrlichen Freund in einem solchen Verdachte! Wäre Ihnen dieser Mann so bekannt, wie mir, so würden Sie sich hüten, ein solches Wort auszusprechen.«
»Und dennoch muß ich Sie damit betrüben, daß ich Ihnen mitteile, dieser Verdacht habe einen sehr triftigen Grund. Hatte der Sendador den Padre schon früher gesehen, bevor er von diesem als Führer engagiert wurde?«
»Nein. Mein Freund hat dies einige Male erwähnt.«
»Er kannte ihn also bis dahin nicht, war auch weder ein Freund noch ein Verwandter des frommen Herrn?«
»Weder das eine noch das andere.«
»Hat der Sendador ihm während ihres Gebirgsüberganges vielleicht einen ganz besonderen Dienst erwiesen?«
»Nein. Warum fragen Sie so? Wie hängt das mit den beiden Khipus zusammen?«
»Sehr eng. Wo liegen die beiden Orte, an denen die Schätze verborgen sein sollen? In der Nähe von Tucuman?«
»Sie sind im Gegenteile sehr entfernt von dieser Stadt.«
»Nun, warum hat der Padre sich nach Tucuman begeben und nicht nach den erwähnten Orten? Sie geben doch zu, daß ein Übergang über die Anden nicht nur beschwerlich, sondern auch gefährlich ist, für einen alten Herrn sogar lebensgefährlich?«
»Das ist wahr. Für alte Leute bringt die außerordentlich dünne Luft und der dadurch verursachte Blutandrang stets eine Lebensgefahr hervor.«
»Sie haben gesagt, der Padre sei ein alter Herr gewesen. Die Reise war also lebensgefährlich für ihn. Einer solchen Gefahr setzt man sich aber nur dann aus, wenn man von wichtigen Gründen dazu gedrängt wird. Er hat gewiß die Schätze heben wollen. Ein Padre aber trachtet nicht nach irdischen Besitz. Wenn er dennoch nach dem Schatze gestrebt hat, so hat er ihn jedenfalls nicht für sich, sondern für andere erlangen wollen. Geben Sie das zu?«
»Ja, denn Ihre Gründe zwingen mich.«
»Wer könnte es nun wohl sein, für welche er die Schätze bestimmt hat? Sollte etwa der Sendador der Erbe sein?«
»Anfangs lag das wohl nicht in der Absicht des Mönches.«
»Wahrscheinlich auch später nicht. Der Sendador sollte überhaupt von der ganzen Angelegenheit nichts erfahren. Erst in der Nähe des Todes hat der Padre ihm die betreffende Mitteilung gemacht. Er gab sein Geheimnis nicht freiwillig, sondern gezwungen preis. Wo aber mag man diejenigen zu suchen haben, denen er es eigentlich offenbaren wollte?«
»Natürlich die Dominikaner in Tucuman.«
»Ich halte diese Ansicht für die richtige. Die Ordensbrüder wären wohl besser im Stande gewesen, die Schrift zu lesen oder den Inhalt der beiden Khipus zu verstehen, als der Sendador. Ein guter Grund, anzunehmen, daß die Hinterlassenschaft des Padres nicht für ihn, sondern für sie bestimmt war.«
»Aber der Padre hat die Khipus gar nicht bei sich gehabt!«
»Das glaube ich nicht.«
»Mein Freund sagte es, und ich habe keinen Grund, die Worte desselben zu bezweifeln.«
»Ich habe desto mehr Grund. Woher war der Padre?«
»Das weiß ich nicht, denn er hat es dem Sendador nicht mitgeteilt.«
»Wo befanden sich seine Sammlungen, von denen Sie sprachen? Wo lag das Buch, welches nicht gedruckt wurde, also das Manuskript eines so hochwichtigen Werkes?«
»Niemand weiß es.«
»Sollte der Padre gestorben sein, ohne gerade dies Wichtigste dem Sendador mitzuteilen? Sollte er die Übersetzung der Khipus bei sich getragen haben und nicht auch die Khipus selbst, welche doch wenigstens, ich sage wenigstens, denselben Wert hatten wie die Übersetzung?«
»Hm! Sie bringen mich mit diesen Fragen wirklich in Verlegenheit!«
»Ich bin überzeugt, daß Ihr Freund durch dieselben in eine noch viel größere Bedrängnis geraten würde. Sind meine Vermutungen richtig, so hat er nicht bloß die Schrift widerrechtlich an sich genommen, sondern auch die beiden Khipus unterschlagen.«
»Der Padre hatte sie ja gar nicht bei sich, wie ich Ihnen schon wiederholt erklärt habe!«
»Und ich behaupte, daß er sie bei sich hatte. Er vertraute beides dem Sendador an. Dieser versteht doch die Khetschuasprache?«
»Jawohl.«
»Aber Khipus kann er nicht lesen?«
»Nein.«
»Nun, so sind die beiden Khipus ihm nicht nur überflüssig, sondern sogar gefährlich gewesen. Er kannte das Geheimnis, indem er die Übersetzung las. Kamen die Khipus zufälliger Weise abhanden, und zwar in die Hände eines Mannes, der sie zu entziffern verstand, so war das Geheimnis verraten. Daraus ergab sich die Notwendigkeit, sich ihrer zu entledigen, sie zu vernichten. Was gedenkt der Sendador zu tun, nachdem seine Nachforschungen vergeblich gewesen sind?«
»Er gibt sie nicht auf.«
»Er wird keinen besseren Erfolg erzielen.«
»Vielleicht doch, denn er will sich einem Manne anvertrauen, welcher sich in die beigegebenen Zeichnungen besser zu finden vermag, als er selbst. Ich habe den Auftrag erhalten, mich nach so einem Manne umzusehen, und glaube ihn gefunden zu haben.«
»Ich vermute, daß Sie mich meinen.«
»Das ist auch wirklich der Fall.«
»So befinden Sie sich in einem großen Irrtume. Ich bin für Ihre Absichten vollständig unbrauchbar und untauglich. Auch ist die Sache gefährlich. Warum sucht der Sendador nicht selbst nach einem passenden Manne? Warum bleibt er im Urwalde verborgen, und überläßt Ihnen die Aufgabe, welche er wenigstens ebenso leicht ausführen könnte. Allerdings, er würde auch so gefragt werden, wie ich Sie jetzt nach allem ausforsche. Bei verdächtigen Stellen können Sie als Mittelsperson ausweichen und sich auf ihn berufen; er aber müßte direkt antworten, und das ist nicht ungefährlich.«
»Aber wenn ich Sie zu ihm bringe, so muß er Ihre Fragen ja auch beantworten!«
»Ja, aber dann ist es zu einem Rücktritte für mich wohl bereits zu spät.«
»O nein. Sie können sich in jedem Augenblicke von unserm Unternehmen lossagen.«
»Ja, dann aber stecke ich als fremder Mann ganz einsam und verlassen in einem Urwalde oder einer Wüste des Gran Chaco und bin ein verlorenes Menschenkind. Sollte der Sendador das nicht berechnet haben?«
Monteso fuhr sich in komischer Wut mit beiden Händen in das wirre Haar.
»Sennor, Sie machen mich mit Ihrem unmotivierten Mißtrauen ganz verrückt!« erklärte er. »Aber ich hoffe, Sie noch bekehren und für das Unternehmen engagieren zu können.«
»Hoffen Sie nicht zu viel! Ich wiederhole, daß ich nicht der geeignete Mann bin. Ein Fremder muß unfähig sein, Ihren Forderungen zu entsprechen. Sie ahnen nicht, welche Kenntnisse unter Umständen dazu gehören, den betreffenden See und den vermauerten Schacht zu entdecken.«
»Den Schacht fanden wir nicht; den See aber haben wir. Nur die betreffende Stelle desselben war nicht zu entdecken.«
»Das glaube ich gern. Angenommen, daß in Wirklichkeit solche Schätze in demselben versenkt worden sind, meinen Sie etwa, daß man an der betreffenden Stelle nur niederzutauchen brauche, um das Gesuchte zu finden? Ich wiederhole, daß zur Lösung Ihrer Aufgabe Kenntnisse gehören, von denen Sie gar keine Ahnung haben. Wollte ich Ihnen das erklären, so würden Sie mich nicht verstehen. Diese Kenntnisse kann nur ein Inländer oder wenigstens ein Gelehrter besitzen, welcher Jahre lang die betreffenden Verhältnisse hier studiert hat. Ich aber befinde mich erst seit wenigen Stunden hier im Lande und bin gar nicht einmal ein Gelehrter.«
»Das wird sich finden. Ich habe Vertrauen zu Ihnen; das genügt mir einstweilen. Auch sind Sie bereits an die Gefahren und Entbehrungen einer solchen Reise gewöhnt. Sie haben vollständige Freiheit, nach Belieben über sich zu verfügen. Was kann ich weniger von Ihnen verlangen? Und wenn wir einig werden, so wird das ja auch zu Ihrem Vorteile sein. Sagten Sie mir heute nicht, daß Sie nicht reich seien?«
»Das sagte ich allerdings.«
»Nun, so bedenken Sie, daß Sie sofort ein steinreicher Mann sein werden, wenn unser Vorhaben gelingt. Welchen Teilsatz jeder erhält, das muß freilich erst besprochen werden.«
»Das reizt mich nicht. Ich sagte Ihnen vorhin, daß es ganz andere Schätze gebe, als diejenigen, nach denen Sie suchen. Und aus Rücksicht auf einen so fraglichen Gewinn lasse ich mich nicht auf Abenteuer ein, welche fast wahrscheinlich zu einem schlimmen Ende führen.«
Ich hatte längst aufgehört, zu essen. Der Yerbatero war erst jetzt fertig. Er ballte seine Serviette zusammen, warf sie unmutig auf den Tisch und fragte:
»So sagen Sie sich also von uns los?«
»Nein. Ich reite mit Ihnen, aber ohne mich zu irgend etwas verbindlich zu machen.«
Sein verfinstertes Gesicht heiterte sich sofort auf.
»Schön, schön!« rief er aus. »Das ist ein Wort, welches ich gelten lasse. Wir sind also einig?«
»O nein! Seien wir nicht allzu sanguinisch! Ich will Ihnen offen gestehen, daß die Angelegenheit an sich einen großen Reiz für mich besitzt. Die Sache an und für sich entspricht so ganz und gar gewissen Neigungen von mir. Und da ich mir das Land und die Bewohner desselben ansehen will, so ist es am besten, ich mache es so wie derjenige, welcher schnell schwimmen lernen will: Ich springe da in das Wasser, wo es am allertiefsten. Also, wenn Sie mich mitnehmen wollen, so gehe ich mit. Aber ich mache meine Bedingungen.«
»Heraus mit ihnen!«
Monteso lachte jetzt am ganzen Gesichte. Die Erklärung, daß ich mit wolle, erfreute ihn außerordentlich. Ich erfuhr später tagtäglich, daß er mich wirklich tief in sein ehrliches Herz geschlossen hatte.
»Eigentlich habe ich nur eine einzige Bedingung,« sagte ich. »Wer nimmt überhaupt teil an der Expedition?«
»Nur der Sendador und wir, die wir hier sitzen. Wir sechs haben eine lange Reihe von Jahren zusammen gearbeitet, wir kennen uns; wir passen zu einander und wissen, daß wir uns auf einander verlassen können. Sie haben es nur mit tüchtigen und verschwiegenen Leuten zu tun.«
»Auf diese letzte Eigenschaft, nämlich die Verschwiegenheit, gründe ich die Bedingungen, welche ich zu machen beabsichtige. Ich habe Ihnen offen das Mißtrauen angedeutet, welches ich gegen den Sendador hege. Es liegt nicht nur in meinem, sondern auch in Ihrem Interesse, daß er nichts davon erfährt. Wenn Sie mir versprechen, auf das strengste darüber zu schweigen, schließe ich mich Ihnen an, sonst aber nicht.«
»Einverstanden! Hier meine Hand, Sennor! Und Ihr andern schlagt natürlich auch ein!«
Sie folgten willig dieser Aufforderung, und so war denn für den nächstliegenden Teil meiner Zukunft entschieden: ich schloß mich diesen Yerbateros an.
»So sind wir also endlich einig,« sagte Monteso im Tone der Befriedigung. »Alles weitere wird sich ganz von selbst ergeben. Jetzt noch eine Hauptsache, eine Frage, wegen der Zeit der Abreise und Ihrer Ausrüstung. Können Sie morgen vormittag von hier fort?«
»Ist mir sehr recht. Sie wissen ja, daß ich keine Veranlassung habe, mich hier länger zu verweilen, als unbedingt nötig ist.«
»Dann also morgen vormittags. Sie werden sich vorher mit der erforderlichen Ausrüstung versehen müssen.«
»Welche Gegenstände gehören zu derselben?«
»Ein Poncho; Hut haben Sie bereits. Zu demselben gehört ein Kopftuch, welches man beim Reiten über den Hut bindet, und zwar so, daß die frische Luft vorn gefangen und nach Hals und Nacken geleitet wird. Das kühlt sehr angenehm. Ich werde in der Frühe zu Ihnen kommen, um Ihnen beim Einkaufe der Sachen behilflich zu sein, da ich in dieser Beziehung wohl erfahrener bin als Sie. Außer dem Poncho brauchen Sie eine Chiripa.«
»Beschreiben Sie mir dieselbe.«
»Sie besteht in einer Decke, welche hinten am Gürtel befestigt, dann zwischen den Beinen hindurch und nach vorn gezogen wird, wo man sie wieder am Gürtel befestigt. Ferner brauchen Sie eine weite, leichte Pampashose und dazu tüchtige Gauchosstiefeln ohne Sohle. Dann einen Recadosattel, Gewehr, Lasso, Bola und Messer. Mit dem Lasso und der Bola werden Sie mit der Zeit leidlich umzugehen lernen. Da ich Sie, wie sich übrigens ganz von selbst versteht, als meinen Gast betrachte, so ersuche sich Sie um die Erlaubnis, die Kosten dieser Ausrüstung tragen zu dürfen.«
»Ihre Güte rührt mich tief, Sennor. Ich würde dieselbe annehmen, wenn von Kosten überhaupt die Rede sein könnte. Ich bin bereits mit einer guten Ausrüstung versehen. Ich werde ganz dieselbe Kleidung anlegen, welche ich in der Prärie getragen habe.«
»Aber, Sennor, die wird im höchsten Grade unpraktisch sein! Bedenken Sie den Unterschied zwischen dort und hier!«
»Es gibt keinen Unterschied, den ich in Beziehung auf die Kleidung zu beachten habe. Ein erprobtes Gewehr habe ich auch mit, ebenso meinen Lasso; im Gebrauche der Bola werde ich mich fleißig üben. Es fehlt mir nur der Sattel und das Pferd.«
»Beides besorge ich, Sennor. Pferde haben wir ja mit. Ich werde eines für Sie herauslesen, und einen Sattel besorge ich gern dazu.«
Eben jetzt kam ein neuer Gast herein. Er war sorgfältig gekleidet, ein junger Mann, grüßte höflich und ließ sich am nächsten Tische nieder, woselbst er nach einer Flasche des dort stehenden Weines langte. Da er uns den Rücken zukehrte und dann sich mit einer Zeitung beschäftigte, so war anzunehmen, daß wir ihm vollständig gleichgültig seien, und es war also kein Grund vorhanden, uns seinetwegen in unserer Unterhaltung stören zu lassen.
»Welchen Weg schlagen wir ein?« sagte ich.
»Wir reiten quer durch Uruguay und Entre Rios nach Parana und fahren dann auf dem Flusse bis nach Corrientes. Von da aus müssen wir links nach dem Chaco einbiegen.«
Der erste Teil dieser Reise war ganz genau die Route, welche Tupido mir vorgeschlagen hatte. Das war mir interessant.
»Natürlich ist das für Sie eine große Anstrengung,« fuhr der Yerbatero fort. »Darum werden wir zuweilen an geeigneten Orten Halt machen, damit Sie sich erholen können.«
Er hielt die Meinung, welche er von mir hegte, fest. Ich war kein »Greenhorn« mehr wie damals, als ich zum ersten Male den fernen Westen betrat. Darum sagte ich:
»Sie brauchen nicht so ungewöhnliche Rücksicht zu nehmen, Sennor. Ich reite ausdauernd.«
»Weiß schon!« lächelte er. »Den ersten Tag hält man es aus; am zweiten bluten die Beine; am dritten ist die Haut von denselben fort, und dann liegt man wochenlang da, um später ganz dasselbe durchzumachen. Zum Reiten muß man in der Pampa geboren sein. Wir werden also morgen nur bis San José reiten, übermorgen bis Perdido, und dann wenden wir uns kurz vor Mercedes nördlich ab, um auf der Estancia eines Vetters von mir auszuruhen. Die weitere Tour müssen wir dort beraten. Sie führt nach der Grenze, also nach der Gegend, welche grad jetzt sehr wenig sicher ist.«
»Von dieser Unsicherheit haben doch wir nichts zu befürchten! Was geht uns die politische Zerfahrenheit der hiesigen Bevölkerung an!«
»Sehr viel, Sennor. Es gibt hier eben ganz andre Verhältnisse als in Ihrem Vaterlande. Besonders hat der Reisende sich in acht zu nehmen. Sie reiten früh als freier, unparteiischer Mann aus, und des Abends kann es vorkommen, daß Sie als Soldat aus dem Sattel steigen und später für eine Partei kämpfen müssen, für welche Sie nicht das mindeste Interesse haben.«
»Das wollte ich mir verbitten! Ich bin ein Fremder, ein Deutscher, und niemand darf sich an mir vergreifen. Ich würde mich sofort an den Vertreter meiner Regierung wenden.«
»Sofort? Man würde das sehr leicht verhindern; ein Fluchtversuch würde Ihnen die Strafe der Desertion einbringen, den Tod. Und ehe Sie Gelegenheit finden könnten, sich an Ihren Vertreter zu wenden, würden Ihre Gebeine auf der Pampa bleichen. Gewalt hilft da nicht, sondern nur Vorsicht allein. Übrigens stehen Sie unter unserm Schutze, und können sich denken, daß wir Sie in keine Gefahr führen werden, da wir uns dabei ja selbst derselben aussetzen würden. Lassen wir also diesen Gegenstand fallen. Wir haben ihn bis zur Erschöpfung erörtert. Das Mädchen mag den Tisch frei machen, damit wir Platz zu einem Spielchen bekommen.«
Dieses Wort wirkte wie elektrisierend auf die andern. Sie sprangen auf, um selbst zu helfen, das Speisegeschirr fortzuräumen. Monteso holte eine Karte herbei. Dann wurde Geld aus den Taschen gezogen, und zwar so viel, daß ich unwillkürlich mit meinem Stuhle vom Tische rückte.
»Bleiben Sie, Sennor!« sagte der Yerbatero. »Natürlich sind Sie eingeladen, sich zu beteiligen.«
»Danke, Sennor! Ich spiele nicht. Ich möchte aufbrechen.«
Er sah mich ganz und gar ungläubig an. Dort zu Lande spielt eben jedermann, und zwar sehr leidenschaftlich und sehr hoch. Eine Weigerung, mitzuspielen, kommt gar nicht vor und würde die andern beleidigen.
»Aber, Sennor, was fällt Ihnen ein! Sind Sie krank?« fragte er.
»Nein, aber sehr müde,« lautete meine Ausrede.
»Das ist für Sie freilich eine Entschuldigung, zumal Sie morgen den ersten und anstrengenden Ritt vor sich haben.«
Glücklicher Weise stand jetzt der zuletzt angekommene Gast auf, trat herbei und erklärte, daß er gern bereit sein werde, meine Stelle einzunehmen, wenn man ihm die Erlaubnis dazu erteile. Er erhielt sie sofort, und ich stand auf, um ihm Platz zu machen und zu gehen. Meinen neuen Kameraden die Hand reichend, verabschiedete ich mich von ihnen. Um Bezahlung der Zeche hatte ich mich nicht zu bekümmern, wie Monteso schnell erklärte, als ich mit der Hand in die Tasche griff und mich zum Mädchen wendete.
»Lassen Sie das, Sennor!« sagte er. »Sie würden uns beleidigen. Früh neun Uhr bin ich mit dem gesattelten Pferde vor Ihrem Hotel. Aber wäre es nicht besser, daß ich Sie jetzt begleite? Sie wissen ja – –«
»Danke, Sennor! Von hier bis zum Hotel wird mir nichts geschehen. Ich nehme mich in acht. Buenas noches!«
»Gute Nacht, Sennor! Träumen Sie von dem See und dem vermauerten Schachte! Vielleicht zeigt Ihnen der Traum den richtigen Weg.«- – –