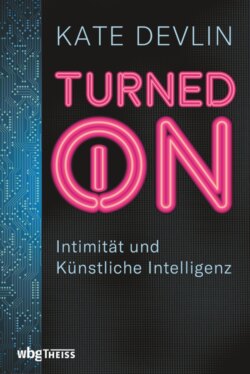Читать книгу Turned on - Kate Devlin - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Zwei Beine schlecht?
ОглавлениеVon Februar bis September 2017 veranstaltete das Londoner Wissenschaftsmuseum eine Ausstellung, die sich der Entwicklung humanoider Roboter widmete. Humanoide Roboter sind Roboter, die über menschenähnliche Merkmale verfügen, jedoch nicht unbedingt menschenähnlich sein müssen. Die lebensechteren Versionen kennt man als Androiden (wenn sie die Erscheinungsform eines Mannes haben) oder Gynoiden (wenn sie als Frau in Erscheinung treten).
Die Robots-Ausstellung fing bei der Geburt an. Das erste Exponat, das einem gleich zu Beginn des Rundgangs unmittelbar ins Auge sprang, war ein verblüffend überzeugendes animatronisches Baby, das – aufrecht vor einer Wand und umgeben von farbigem Licht – langsam seine Gliedmaßen bewegte. Das Baby war ursprünglich eine Filmrequisite. Im Kontext einer Filmszene wäre es vermutlich äußerst überzeugend, aber dort im gedämpften Licht, befestigt an einer ansonsten leeren Wand wie ein zur Schau gestelltes Insekt, wirkte es unheimlich und verstörend.
Die Ausstellung gliederte sich in fünf zeitlich geordnete Abschnitte: Staunen (1570–1800), Gehorchen (1800–1920), Träumen (1920–2009), Bauen (1940 bis heute) und Imaginieren (vom Jahr 2000 aus in die Zukunft). Als roter Faden und Bezugsrahmen dienten bei jeder Station unsere Selbstbilder. Staunen beschäftigte sich mit der Weltsicht, wie sie in der Frühen Neuzeit vertreten wurde, als man die Welt als ein Uhrwerk verstand. In Gehorchen ging es um die Idee des Arbeiters als Automat in spiegelbildlicher Entsprechung zur Mechanisierung der Fabrikarbeit. Träumen brachte Wissenschaft und Wissenschaftsfiktion zusammen, indem es die Hoffnungen und Ängste, die wir mit unseren mechanischen Pendants verbinden, zum Thema machte. Bauen galt der Erkundung des kybernetischen Zeitalters und der mit ihm ursächlich verbundenen Arbeit der letzten 75 Jahre. Imaginieren drehte sich um die Frage, wie sich das Zusammenspiel zwischen Mensch und Roboter in der Zukunft gestalten könnte, einschließlich einiger recht konkreter Spekulationen darüber, welche Beziehungen wir mit diesen Maschinen unterhalten werden.
Glanzpunkt von Robots war zweifellos die Art und Weise, wie hier über 100 humanoide Roboter zu einer ganz besonderen Kollektion zusammengestellt wurden, die als eine der bislang besten gelten kann. Mir bot sich dadurch eine fantastische Gelegenheit, an Androiden und Gynoiden entlangzuwandeln, über die ich sonst immer nur gelesen hätte (die anschließende Gelegenheit, im Museumsshop bei den Robotersouvenirs zuzuschlagen, war auch nicht zu verachten). Der in der Ausstellung präsentierte Zeitstrahl illustrierte sehr schön, wie weit wir mit der Fabrikation unserer Vertreter gekommen sind.
* * *
Die erste digital gesteuerte Vollversion eines anthropomorphen Roboters auf zwei Beinen war der WABOT-1, der 1970 von der Waseda-Universiät in Japan herausgebracht wurde. Er sah aus, als sei er aus dem Satz eines riesigen Metallbaukastens zusammengesetzt worden. Alles an ihm bestand aus blockartigen Metallpanelen und Metallvernietungen. Dennoch hatte er eine gewisse Ähnlichkeit mit der menschlichen Gestalt: kastenförmig, Winkelarme und -beine mit künstlichen Augen, Ohren und Mund.
Mit dem zweibeinigen humanoiden Roboter P2 trieb Honda die Entwicklung 1997 weiter voran. Dessen Bewegungen waren nicht nur realistisch, mit seiner solideren Gestalt wirkte er auch ausgereifter als seine Vorgänger. Im Jahr 2000 brachte Honda schließlich ASIMO heraus. ASIMO (Advanced Step in Innovative Mobility – der Name war auch eine kleine Verbeugung vor einem sehr bedeutenden Sciencefiction-Autor) konnte mit Menschen interagieren, weil er die Erkennung von Objekten, von Gesten und Gesichtern und auch von Geräuschen beherrschte. Lasersensoren ermittelten die Oberflächenstruktur des Bodens und erlaubten es ASIMO, navigierbare Wege zu benutzen. Er kam sogar mit Treppen klar.
Seit ASIMO sind eine ganze Reihe humanoider Roboter entwickelt worden, sowohl aus kommerziellem Interesse als auch für Forschungszwecke. Manche, wie Hiroshi Ishiguros Geminoid-Serie, sollen in erster Linie ultrarealistisch sein; andere hingegen, wie Aldebarans NAO, sind klein, quelloffen und preiswert genug, so dass sie umfangreich für Forschungs- und Bildungszwecke genutzt werden können. Roboter wie der iCub – ein humanoider Roboter von der Größe eines dreijährigen Kindes – sind entwickelt worden, um Hypothesen zu überprüfen. Der iCub wurde speziell dafür konstruiert, dass er auf die gleiche Weise mit seiner Umwelt interagiert und etwas über die Welt lernt, wie das möglicherweise ein kleines Kind tut.
Warum aber sollten überhaupt Roboter gebaut werden, die über eine menschliche Gestalt verfügen? Es sind jede Menge Roboter im Einsatz, die keine menschliche Erscheinungsform haben. Es ist eine unglaublich schwierige und kostspielige Aufgabe, Roboter zu erschaffen, die körperlich all das beherrschen, was wir als selbstverständlich voraussetzen: das Gleichgewicht halten, laufen, Dinge aufheben oder mit unterschiedlich starkem Druck anfassen. Wir wissen, dass es soziale Interaktionen auch mit nichtmenschlichen Robotern geben kann, warum also sollten wir, außer in unseren Sci-Fi-Visionen, so viel Zeit und Geld in solch eine schwierige Aufgabe investieren?
Ein Grund besteht darin, dass unsere Welt genau so eingerichtet ist. Wir haben Umgebungen geschaffen, die sich für Menschen eignen: entsprechend hohe Türen und Gänge, Treppen mit den richtigen Abmessungen für Menschenbeine und Regale in Reichweite unserer Arme. Es wäre ganz praktisch, hätten wir Roboter, die sich in unsere Umgebung einfügen könnten. „Warum die menschliche Gestalt?“, fragt eine Figur in Isaak Asimovs bleibendem Sciencefiction-Roman Die Stahlhöhlen (The Caves of Steel). Weil, so wird ihr geantwortet, sie die erfolgreichste Gestalt in der Natur darstellt und weil es leichter wäre, Roboter so zu konstruieren, dass sie sich in unsere Welt einfügen, als alle unsere Werkzeuge und Gerätschaften für sie umgestalten zu müssen.
In Der Herumtreiber (Runaround), einer Sciencefiction-Erzählung von 1942, legte Asimov seine Drei Gesetze vor, an die sich die Roboter in seiner Erzählliteratur zu halten haben. Diese lauten: 1) Ein Roboter darf keinen Menschen verletzen oder durch Untätigkeit zu Schaden kommen lassen; 2) Ein Roboter muss den Befehlen eines Menschen gehorchen, es sei denn, solche Befehle stehen im Widerspruch zum ersten Gesetz; und 3) Ein Roboter muss seine eigene Existenz schützen, solange dieser Schutz nicht dem ersten oder zweiten Gesetz widerspricht. Später fügte Asimov noch ein nulltes Gesetz hinzu, dem zufolge ein Roboter der Menschheit keinen Schaden zufügen oder durch seine Untätigkeit gestatten darf, dass sie zu Schaden kommt.
In einem 1981 geführten Interview mit der Zeitschrift Compute! merkte Asimov an, dass die Drei Gesetze die „einzige Möglichkeit“ darstellten, „wie ein vernünftiger Mensch mit Robotern, oder mit irgendetwas anderem, umgehen kann“. Leider werden seine Gesetze immer wieder falsch interpretiert. Asimov aber war sich dieses Problems durchaus bewusst, hat er doch selbst zahlreiche Kurzgeschichten verfasst, bei denen er Schlupflöcher in den Gesetzen nutzte, um daraus eine Handlung zu entwickeln. Die Gesetze sind ein großartiger Ausgangspunkt für die ethische Entscheidungsfindung, doch es gibt einfach keine Möglichkeit, sie bei einer Maschine absolut sicher nachzubilden. Das einzig Sichere, was wir über das Handlungsvermögen von Maschinen bisher sagen können, ist, dass sie imstande sind, Befehlen Folge zu leisten. Und ethische Regeln, die in ihrer Gesamtheit alle Eventualitäten in der realen Welt abdecken können, gibt es nicht. Wie sollten wir mit ihrer Programmierung auch nur beginnen können, wenn es so viele Unklarheiten gibt? Wir können uns ja nicht einmal auf einen allgemeingültigen Ethik kodex für Menschen einigen. Bei der allgemeinen UN-Erklärung der Menschenrechte, mit der wir einem solchen Kodex vermutlich noch am nächsten gekommen sind, handelt es sich um eine Auflistung der angestrebten Ergebnisse – wie sie erreicht werden sollen, sagt sie nicht.
Etliche Gruppierungen haben sich darangemacht, einen Ethikkodex nach dem Vorbild Asimovs zu entwickeln. Sie haben begriffen, dass wir versuchen müssen, die ethische Entwicklung unserer Roboter sicherzustellen, bevor wir sie dazu zu bringen versuchen, dass sie sich ethisch verhalten. Wir brauchen Regeln für Menschen, nicht für Roboter. Im September 2010 traf sich eine Expertengruppe in Großbritannien, um allgemeine Prinzipien aufzustellen.3 Sie entwickelten Regeln für die Roboterindustrie, nicht für die Roboter selbst. Dazu zählten: keine Konstruktion von Robotern zur Verwendung als Waffen, außer im Falle der Gefährdung der nationalen Sicherheit; Sicherstellung, dass Roboter sich an die bestehenden Menschenrechte halten (wie etwa das auf Wahrung der Privatsphäre); Einhaltung der Sicherheitsvorschriften; und Sicherstellung, dass jemand – ein Mensch – die rechtliche Verantwortung für die ihm oder ihr gehörenden Roboter innehat. Interessanterweise sagten die Fachleute auch, dass Roboter „nicht so konstruiert werden sollen, dass Täuschungen möglich sind … ihre Maschinennatur soll erkennbar sein“. Humanoide Roboter sind eindeutig Maschinen, die der Gestalt des Menschen einige Grundelemente entlehnen, doch was ist mit Androiden- und Gynoidenrobotern? Handelt es sich um eine Täuschung, wenn ein Konstrukteur versucht, einen menschenähnlichen Roboter zu entwickeln und dabei besondere Sorgfalt auf eine möglichst realitätsnahe Erscheinung verwendet?
Im März 2016 enthüllte das Unternehmen Hanson Robotics im texanischen Austin seinen Sozialgynoiden Sophia. Seitdem ist viel und regelmäßig über Sophia berichtet worden. Sie soll, wie es heißt, der Schauspielerin Audrey Hepburn nachempfunden sein, auch wenn man das nicht unbedingt meinen würde, wenn man sie das erste Mal sieht. Sophia kann verschiedene Gesichtsausdrücke annehmen, und sie nutzt Spracherkennung und KI, um interaktive Gespräche zu führen. Sophia ist ganz bewusst als Roboter mit einem gefälligen menschlichen Gesicht entworfen worden. Der Hinterkopf ist durchsichtig und man kann die innere Verdrahtung sehen, das Gesicht aber ist so, dass es auf natürliche Weise menschlich erscheint. David Hanson, der Erbauer, ließ verlauten, Sophia würde einen geeigneten Begleitroboter abgeben und könnte im Gesundheitswesen, im Kundendienst und im Bildungsbereich arbeiten.
Sophia wurde als Gast in Talkshows und Nachrichtensendungen buchstäblich herumgereicht und sogar bei den Vereinten Nationen vorgestellt. Besonders umstritten war, dass Saudi-Arabien ihr im Oktober 2017 die Staatsbürgerschaft zuerkannte. Dies war das erste Mal überhaupt, dass einem Roboter eine Staatsangehörigkeit verliehen wurde. Die Aktion wurde nicht überall gut aufgenommen, denn schließlich ging sie von einem Land aus, das eine erschreckende Menschenrechtsbilanz aufweist, in dem Frauen unter einer Geschlechter-Apartheid zu leiden haben und in dem Nichtmuslime keine Staatsbürger sein können. Dem US-amerikanischen Talkshowmaster Jimmy Fallon gegenüber meinte Hanson scherzhaft, dass der Roboter „im Grunde genommen lebendig“ sei, und brachte damit die Leute gegen sich auf, die sich Sophias vieler Begrenztheiten bewusst waren. Die KI-Ethik-Community arbeitete sich an Sophia äußerst kritisch ab. Das Ganze sei „offensichtlicher Quatsch“, und Hanson wurde als „Zauberer von Oz“ bezeichnet. Ich teile die Kritik: Sophia hat vielleicht ein Gesicht und einen Oberkörper wie ein Mensch, im Wesentlichen aber ist sie ein Chatbot, der algorithmische Vorgaben abarbeitet.
„Die meisten Menschen kümmert das nicht“, kontert Ben Goertzel, der leitende Wissenschaftler von Human Robotics. Er sieht es so: Auch wenn die Leute wissen, dass Sophia nicht versteht, was vor sich geht, wollen sie doch eine Beziehung zu dem Roboter herstellen, so als hätten sie es bei ihm mit einer realen Person zu tun. Das mag stimmen. Aber selbst wenn, ist die Frage, ob Hanson Robotics unverantwortlich handelt, wenn das Unternehmen die Vorstellung vorantreibt – oder die Menschen zumindest in dem Glauben belässt –, dass Sophia eine schlaue und lebensnahe Maschine ist. Führende Roboteringenieure wie Joanna Bryson und Yann LeCun haben mit ihr ein Problem. Bryson beunruhigt, dass es sich bei Sophia um eine „gewaltige Täuschung“ handelt – eine überzeugende Puppe, mit der die Naivität und Ahnungslosigkeit der Leute in Sachen Künstliche Intelligenz und Robotik ausgenutzt wird. Als eine derjenigen, die die Regeln von Asimov im Jahr 2010 umgeschrieben haben, steht Bryson auf dem Standpunkt, dass Sophia im Hinblick auf Maschinentransparenz gegen geltende Richtlinien verstößt.
Menschen mögen vielleicht unbewusst annehmen, dass Sophia über eine hochentwickelte Form von Intelligenz verfügt, dennoch kann man sie unmöglich mit einem echten menschlichen Wesen verwechseln. Sicher, für einen Gynoiden sieht sie gut aus. Wir sind aber weit entfernt von einem Roboter, dessen Menschenähnlichkeit wirklich überzeugend wäre.