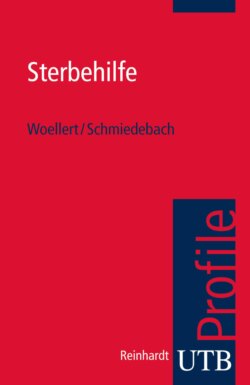Читать книгу Sterbehilfe - Katharina Woellert - Страница 9
Оглавление2
Begriffsver wendung
Die Diskussion um die Behandlungsentscheidungen am Lebensende ist durch verschiedene medizinische, pflegerische, juristische, ethische und theologische Argumente geprägt. Deshalb ist es sinnvoll, vor dem Einstieg in die eigentliche Diskussion deutlich zu machen, welche Begriffe in der Debatte eine Rolle spielen und wie diese definiert sind. Um die Streitpunkte in der deutschen Auseinandersetzung nachvollziehen zu können, ist es ebenso wichtig, die Rechtslage zum Thema Sterbehilfe zu kennen. Beides soll dieses Kapitel leisten.
Die gängige Begriffsverwendung und deren Problematik
Sterbehilfe oder Sterbebegleitung. Zunächst ist zu klären, wie sich die Begriffe Sterbehilfe und Sterbebegleitung zueinander verhalten. Sterbehilfe wird vor allem im Zusammenhang mit den Adjektiven passiv, indirekt und aktiv gebraucht; damit kann man die Art der medizinischen Intervention rechtlich und definitorisch einordnen. Der Ausdruck Sterbebegleitung ist weiter gefasst: Er beschreibt auch palliativmedizinische und -pflegerische Maßnahmen und somit die Begleitung des Patienten in seiner letzten Lebensphase.
Der Terminus Sterbehilfe wird vielfach kritisch beurteilt, auch wenn er im Recht nach wie vor Anwendung findet. Dabei gelten vor allem zwei Aspekte als problematisch: erstens die begriffliche Nähe zum Terminus „verhelfen“. Er drückt deutlich aus, dass auch andere Personen am Entscheidungs- und Umsetzungsprozess beteiligt sind. Statt sich am Gesundheitszustand des Patienten zu orientieren, wird dadurch die Handlung von Medizinern bzw. Pflegepersonen in den Mittelpunkt gestellt.
Zweitens ist auch die Nähe zu dem Begriff „Hilfe“ problematisch (Nationaler Ethikrat 2006, 26). Helfen ist ein positiv besetzter Vorgang. Zumindest bei der allgemein kritisch beurteilten und strafbaren aktiven Sterbehilfe steht diese Bezeichnung somit im Gegensatz zum Wortsinn. Die Bundesärztekammer begegnete dieser begrifflichen Schwäche dadurch, dass sie in ihren Richtlinien zum Thema seit 1993 den Ausdruck Sterbebegleitung statt Sterbehilfe im Titel führt (Bundesärztekammer 1993).
Euthanasie. Der Begriff Euthanasie stammt wie gesagt aus dem Griechischen und bedeutet „guter Tod“ (siehe Kapitel 1); der Wortsinn hat also eine positive Färbung. Im deutschen Sprachkontext ist der Begriff dagegen aufgrund seiner Verwendung in der Zeit des Nationalsozialismus größtenteils eher negativ belegt (Benzenhöfer 1999, 109–129).
Folglich unterscheidet sich die deutsche Diskussion deutlich von der beispielsweise im angelsächsischen Raum geführten, die weiterhin auf den Ausdruck Euthanasia zurückgreift (Sohn / Zenz 2001). In Deutschland bevorzugt man dagegen in der Regel die Begriffe Sterbehilfe oder Sterbebegleitung (Nationaler Ethikrat 2006, 26); nur vereinzelt finden sich in der wissenschaftlichen Diskussion die Bezeichnungen aktive und passive Euthanasie, so beispielsweise bei Kodalle 2004.
Passive, indirekte und aktive Sterbehilfe. In der aktuellen Debatte haben sich mehrere Perspektiven mit jeweils eigenen Begrifflichkeiten durchgesetzt. Auf einer ersten, der Behandlungsebene, wird zwischen aktiver, indirekter und passiver Sterbehilfe unterschieden (Wiesing/Ach 2000, 195–197).
Definition
Passive Sterbehilfe: das Einstellen oder das Nichtergreifen von lebenserhaltenden medizinischen Maßnahmen bei Schwerkranken oder Sterbenden (z. B. Verzicht auf Wiederbelebung); das Sterben wird zugelassen.
Definition
Indirekte Sterbehilfe: Maßnahmen bei Schwerkranken oder Sterbenden, die Leid mindern sollen und bei denen als unbeabsichtigte Nebenwirkung der Eintritt des Todes beschleunigt wird (z. B. der Einsatz hoch dosierter Schmerzmittel). Behandlungsziel ist das Lindern von Leid.
Definition
Aktive Sterbehilfe: medizinische Maßnahmen bei Schwerkranken oder Sterbenden, die den Tod vorzeitig herbeiführen sollen (z. B. das Verabreichen von Gift). Ziel ist die Lebensbeendigung.
Vorrangiges Unterscheidungskriterium ist also das Behandlungsziel. Bei der passiven Sterbehilfe besteht dieses in der Beschränkung auf eine Basisversorgung und somit im Verzicht auf intensivmedizinische Maximalbehandlung – lebenserhaltende Maßnahmen werden entweder eingestellt oder aber gar nicht erst ergriffen, also etwa: keine künstliche Ernährung, Beatmung, Dialyse, Medikamentengabe, Reanimation und Ähnliches. – Beim Abschalten eines Beatmungsgerätes vollzieht der Arzt zwar einen aktiven Eingriff, er überlässt den Patienten damit aber wieder dem ursprünglich ablaufenden Sterbeprozess, der durch die intensivmedizinische Behandlung unterbrochen worden war. Damit wird das Sterben zugelassen, weswegen das Abschalten eines Atemgerätes trotz der aktiven Handlung ebenfalls der passiven Sterbehilfe zugeordnet wird (Birnbacher 1995; Gesang 2001).
Bei der indirekten Sterbehilfe besteht das Behandlungsziel über eine Basisversorgung und den Verzicht auf Intensivmedizin hinaus darin, dem Schwerkranken oder Sterbenden sein Dasein weitestmöglich zu erleichtern. So können beispielsweise starke Schmerzen, Atemnot oder Angstzustände mit hoch dosierten Medikamenten behandelt werden, wobei in Kauf genommen wird, dass sich die voraussichtliche Lebenserwartung unter Umständen als unbeabsichtigte Folge von Nebenwirkungen verringert.
Die aktive Sterbehilfe besteht in der Durchführung lebensverkürzender Maßnahmen, beispielsweise in der Verabreichung von Gift. Das Behandlungsziel besteht hierbei in einer Beschleunigung des Sterbens; der Tod tritt vorzeitig ein.
Die rechtlich und berufsethisch getroffene Unterscheidung in aktive und passive Sterbehilfe ist allerdings umstritten. Mit dem Hinweis auf die Umstände, dass auch das Nicht-Handeln bei einem lebensbedrohlich erkrankten Patienten eine aktive Entscheidung des Arztes voraussetze und dass beispielsweise das Abschalten eines Beatmungsgerätes eine aktive Handlung sei, wird die Unterscheidbarkeit der beiden Formen angezweifelt, so beispielsweise von Eibach 2000.
Untersuchungen zeigen, dass über die richtige Verwendung der Begriffe passive, indirekte und aktive Sterbehilfe selbst unter speziell geschulten Ärzten mitunter Unsicherheit herrscht. So schätzten in einer Befragung von in der Palliativmedizin fortgebildeten Ärzten etwa die Hälfte das Abschalten einer Beatmungsmaschine falsch als aktive Sterbehilfe ein (Weber et al. 2001). Es stellt sich die Frage, ob solche Fehleinschätzungen neben fehlender Aufklärung und begrifflicher Unschärfe nicht noch andere Gründe haben. Offenbar fällt es vielen Menschen schwer, das Sterbenlassen mit all seinen Konsequenzen zu akzeptieren.
Strittig ist auch, ob künstliche Ernährung und Flüssigkeitszufuhr im Rahmen der passiven Sterbehilfe unterlassen werden dürfen. Laut Bundesärztekammer muss die Basisbetreuung in jedem Fall gewährleistet sein, die unter anderem auch das Stillen von Hunger und Durst umfasse. Viele Sterbende haben aber kein Hunger- und Durstempfinden mehr, ja oftmals ist es ein Zeichen für den fortschreitenden Sterbeprozess, dass Flüssigkeit und Nahrung abgelehnt werden. Ernährungsmaßnahmen, die über die Befriedigung subjektiv empfundener Bedürfnisse hinausgehen, sind daher nach Auffassung der Bundesärztekammer wiederum nur nach medizinischer Indikation angezeigt (Bundesärztekammer 2004). Damit ist der Unterschied zwischen Nicht-essen-Können und Nicht-essen-Wollen als Ausdruck eines beginnenden Abschieds vom Leben angesprochen (Heubel 2007). In der Praxis kann es aber sehr schwierig sein, die mitunter nur nonverbale Kommunikation des Patienten richtig zu deuten. Es ist daher oft nicht einfach, die Vorgaben der Bundesärztekammer umzusetzen.
Auch der Begriff indirekte Sterbehilfe ist nicht unumstritten. Ein Kritikpunkt ist die Benennung an sich, da der Tod des Patienten bei den damit bezeichneten Maßnahmen weder direkt noch indirekt das Handlungsziel sei. Die eigentlich Intention, nämlich die Verlagerung des Behandlungsziels vom Heilen zur Leidminderung unter Inkaufnahme eines eventuell beschleunigten Todes, werde durch diese Bezeichnung nicht erfasst (Nationaler Ethikrat 2006, 28f ). Darüber hinaus tut sich bei dieser Kategorie eine weitere Schwierigkeit auf: Die Grauzone zwischen aktiver und indirekter Sterbehilfe macht es unter Umständen möglich, eine bewusste Tötungshandlung als erlaubte, indirekte Sterbehilfe zu verschleiern. Andererseits weisen einige Studien darauf hin, dass bei sorgfältiger und korrekter Dosierung die Anwendung von Schmerz- und Beruhigungsmitteln nur selten eine lebensverkürzende (Neben-)Wirkung hat (Bosshard et al. 2006). Es besteht aber auch hier, wie bei allen medizinischen Maßnahmen, ein gewisses Komplikationsrisiko (Sahm 2006). So gesehen wäre es sinnvoller, in diesem Fall von einer unbeabsichtigten Nebenwirkung und nicht von indirekter Sterbehilfe als gesonderte Kategorie zu sprechen.
Sterbehilfe im engeren und im weiteren Sinne. Eine zweite Perspektive bezieht sich auf den Gesundheitszustand des Betroffenen. Da Ärzte und Pflegende grundsätzlich dazu verpflichtet sind, lebenserhaltend zu wirken, ist es wichtig zu klären, in welchen Fällen von dieser Pflicht Abstand genommen werden darf und passive oder indirekte Sterbehilfe geboten sein kann. Hier sind zwei medizinische Szenarien denkbar: erstens bei Sterbenden und zweitens bei schwerstkranken Patienten mit infauster, d. h. aussichtsloser, Prognose, die eine Heilung unwahrscheinlich erscheinen lässt (Bundesärztekammer 2004). Dafür werden auch die Begriffe Sterbehilfe im engeren und im weiteren Sinne verwendet (Roxin 2001, 93).
Sterbende sind im Sinne der Bundesärztekammer „Kranke oder Verletzte mit irreversiblem Versagen einer oder mehrerer lebenswichtiger Funktionen, bei denen der Eintritt des Todes in kurzer Zeit zu erwarten ist“ (Bundesärztekammer 2004, C-1040). Der Sterbevorgang muss also bereits begonnen haben und der Tod demnach nahe bevorstehen. Patienten mit infauster Prognose sind jene, „die sich zwar noch nicht im Sterben befinden, aber nach ärztlicher Erkenntnis aller Voraussicht nach in absehbarer Zeit sterben werden, weil die Krankheit weit fortgeschritten ist“ (Bundesärztekammer 2004, C-1040). Dieser zweite Zustand ist beispielsweise im Fall einer schweren Krebserkrankung gegeben, wenn der Sterbeprozess zwar noch nicht begonnen, das Grundleiden aber einen unumkehrbar tödlichen Verlauf genommen hat und demnach keine Hoffnung auf Heilung mehr gegeben ist. Kritische Gegenstimmen dazu sagen allerdings, dass das Leben an sich irreversibel tödlich verlaufe, und zielen damit auf die grundsätzliche Schwierigkeit ab, den Beginn des Sterbevorganges exakt zu bestimmen (Klinkhammer 2007).
Definition
Sterbehilfe im engeren Sinne (Sterbende): Der Patient liegt im Sterben, d.h. eine oder mehrere vitale Funktionen haben irreversibel versagt. Der Eintritt des Todes steht unmittelbar bevor.
Definition
Sterbehilfe im weiteren Sinne (Patienten mit infauster Prognose): Die Erkrankung des Patienten hat einen irreversiblen, tödlichen Verlauf genommen. Daher besteht keine Hoffnung auf Heilung mehr.
Die Bundesärztekammer nahm diese Differenzierung 1998 in ihre Richtlinien zur ärztlichen Sterbebegleitung auf. Die Unterscheidung wurde relevant, als Anfang der 1990er Jahre das Schicksal von schwerst hirngeschädigten Patienten zum Thema medizinethischer Diskussionen wurde. Berühmtheit erlangte 1994 der „Kemptener Fall“, in dem der Bundesgerichtshof schließlich entschied, dass der Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen bei einer Patientin im so genannten Wachkoma, die sich also nicht unmittelbar im Sterben befand, zulässig gewesen sei (siehe Kapitel 5). Der bis dahin sehr eng gefasste Symptombereich, in dem Sterbehilfe als zulässig erachtet wurde, war damit höchstrichterlich entscheidend erweitert worden.
Dennoch ist nach wie vor umstritten, wie komatöse Krankheitszustände bezüglich eventueller Sterbehilfemaßnahmen zu werten seien. Problematisch ist vor allem, dass sich hinter dieser allgemein üblichen Bezeichnung eine ganze Reihe verschiedener Zustände verbirgt, die eine sehr unterschiedliche medizinische Betreuung notwendig machen, von einfachen pflegerischen Maßnahmen bis hin zu einer umfangreichen intensivmedizinischen Betreuung. Daher ist es nach bisherigem Kenntnisstand nicht möglich, diese Symptomgruppe hinsichtlich ihrer Prognose verallgemeinernd zu beurteilen. Vielmehr kommt es auf die Bewertung des Einzelfalles an.
Die Bundesärztekammer begegnet dieser Schwierigkeit, indem sie in ihren Grundsätzen ausdrücklich darauf hinweist, dass auch Patienten mit schweren zerebralen Schädigungen ein Anrecht auf medizinische Versorgung und Therapie haben. Erst wenn sich ihr Zustand dahingehend verändert, dass das Leiden einen infausten Verlauf nimmt, oder wenn der Sterbevorgang gar schon eingesetzt hat, gelten passive und indirekte Sterbehilfe als zulässig (Bundesärztekammer 2004).
Kernaussage
Es ist umstritten, ob bei andauernder Bewusstlosigkeit (Wachkoma) Sterbehilfemaßnahmen zulässig sind.
Freiwillige, nicht-freiwillige und unfreiwillige Sterbehilfe. Und schließlich zielt eine dritte Perspektive, die Zustimmungsebene, auf das Ausmaß der Beachtung des Patientenwillens ab. Im Falle einer freiwilligen Sterbehilfe äußert der Patient seinen Wunsch zu sterben bewusst, freiwillig und ohne jeden äußeren Zwang. Es liegt ein eindeutiger, erklärter Wille vor. Bei der nicht-freiwilligen Sterbehilfe ist der Patient nicht einwilligungsfähig, weshalb ein Stellvertreter für ihn entscheiden muss. Hier gilt es, den mutmaßlichen Willen zu ermitteln. Im Falle einer unfreiwilligen Sterbehilfe wird der Patient entweder zuvor nicht über seinen Willen befragt oder er wird gegen seinen Willen getötet. (Beispiele für unfreiwillige Sterbehilfe sind aus den Niederlanden bekannt, siehe Kapitel 3.) In Kapitel 5 gehen wir ausführlich auf die Schwierigkeiten ein, die sich bei der Ermittlung des Behandlungswunsches – vor allem von nicht einwilligungsfähigen Patienten – ergeben.
Definition
Freiwillige Sterbehilfe: Der Patient stimmt der Sterbehilfemaßnahme bewusst und ohne jeden Zwang zu.
Definition
Nicht-freiwillige Sterbehilfe: Der Patient ist nicht einwilligungsfähig. Ein Vertreter muss an seiner Stelle in seinem Sinne für ihn entscheiden; der mutmaßliche Wille des Patienten muss ermittelt werden.
Definition
Unfreiwillige Sterbehilfe: Die Sterbehilfemaßnahme erfolgt ohne Berücksichtigung oder gegen den Willen des Patienten.
Sedierung am Lebensende. Damit wird eine Maßnahme bezeichnet, die darauf abzielt, das Bewusstsein eines schwer leidenden und im Sterben begriffenen Patienten durch die Gabe von Medikamenten teilweise oder vollständig auszuschalten. Ziel ist die Leidensminderung. Auf diese Maßnahme wird nur zurückgegriffen, wenn der Leidenszustand (z. B. Schmerz, Unruhe, Angst oder Atemnot) durch andere palliative Maßnahmen nicht mehr beherrschbar ist. Die Sedierung am Lebensende geriet in den Verdacht, ähnlich wie die indirekte Sterbehilfe den Sterbevorgang zu beschleunigen. Aufgrund dieser „Doppelwirkung“ (Neitzke / Frewer 2004) wurde sie auch in ihren rechtlichen Konsequenzen oft als solche eingeschätzt. Neuere Untersuchungen gehen jedoch davon aus, dass die Medikamente bei richtiger Dosierung keinen Einfluss auf den Sterbeprozess haben (Bosshard et al. 2006).
Definition
Sedierung am Lebensende: Maßnahme, die das Bewusstsein eines Schwerkranken oder Sterbenden durch die Gabe von Medikamenten teilweise oder vollständig ausschaltet, um so anders nicht beherrschbaren, quälenden Zuständen (z. B. Schmerzen, Unruhe) zu begegnen
Tötung auf Verlangen und Beihilfe zur Selbsttötung. Eine spezielle Situation der aktiven Sterbehilfe wird durch die Bezeichnung Tötung auf Verlangen erfasst. Dabei handelt es sich um den Wunsch eines schwerst kranken Menschen, ihn beispielsweise durch die Injektion einer tödlichen Dosis an Medikamenten „von seinem Leid zu erlösen“; der Ausführende handelt dabei auf ausdrücklichen Wunsch des Betroffenen. Davon ist die Beihilfe zur Selbsttötung abzugrenzen.
Entscheidend zur Beurteilung des Unterschiedes ist der Umstand, wer die so genannte Tatherrschaft über den lebensbeendenden Akt innehat. Führt der Lebensmüde beispielsweise den Schierlingsbecher selbst zum Munde, so handelt es sich um eine Selbsttötung, da er den Akt der Giftzufuhr selbst bestimmt; wurde das Gift durch einen Dritten bereitgestellt, liegt Beihilfe zur Selbsttötung vor. Tötung auf Verlangen ist dagegen gegeben, wenn beispielsweise die Giftspritze auf Verlangen des Betroffenen durch eine dritte Person verabreicht wurde (OLG München, Beschluss vom 31.7.1987–1 Ws 23/87).
Definition
Tötung auf Verlangen: Tötung eines Schwerkranken auf dessen ausdrücklichen Wunsch durch eine dritte Person. Die „Tatherrschaft“ liegt bei der dritten Person.
Definition
Beihilfe zur Selbsttötung: Einem Schwerkranken wird auf dessen ausdrücklichen Wunsch die Möglichkeit gegeben, sich selbst das Leben zu nehmen (beispielsweise durch die Bereitstellung von Gift). Die „Tatherrschaft“ liegt beim Kranken.
Vorschläge zu einer alternativen Terminologie
Über die Verwendung der verschiedenen Termini ist in jüngster Zeit eine breite Diskussion entbrannt. Die bisher üblichen Bezeichnungen und vor allem die Unterscheidung in passive, indirekte und aktive Sterbehilfe stehen in Fachkreisen derzeit auf dem Prüfstand. Auch wenn diese Begriffe nach wie vor verwendet werden, lohnt sich ein Blick auf die Vorschläge zu einer alternativen Terminologie, da sie ein Umdenken im Umgang mit Sterbenden und mit dem Tod zum Ausdruck bringen. Im Folgenden sollen die Vorschläge der maßgeblichen Institutionen vorgestellt werden: der Bundesärztekammer, des Deutschen Juristentages und des Nationalen Ethikrates.
Zunächst fällt auf, dass die Bundesärztekammer in ihren „Grundlagen zur ärztlichen Sterbebegleitung“ in keiner Version auf die Begriffstrias passive, indirekte und aktive Sterbehilfe zurückgreift. Obwohl sie das dieser Benennung zu Grunde liegende Konzept bemüht, verzichtet sie auf die umstrittene Bezeichnung und umschreibt stattdessen die damit bezeichneten Sachverhalte. In der derzeit aktuellen Version von 2004 heißt es:
„Maßnahmen zur Verlängerung des Lebens dürfen in Übereinstimmung mit dem Willen des Patienten unterlassen oder nicht weitergeführt werden, wenn diese nur den Todeseintritt verzögern und die Krankheit in ihrem Verlauf nicht mehr aufgehalten werden kann. Bei Sterbenden kann die Linderung des Leidens so im Vordergrund stehen, dass eine möglicherweise dadurch bedingte unvermeidbare Lebensverkürzung hingenommen werden darf.“ (Bundesärztekammer 2004)
Nur der Ausdruck aktive Sterbehilfe wird in dem Dokument verwendet, allerdings nicht ohne den damit bezeichneten Sachverhalt zu erläutern. Dieser Wortwahl liegt ein bewusster Abwägungsprozess zu Grunde; die problematischen Begriffe sollen so vermieden werden (Bundesärztekammer 1999, 23).
Auch auf dem Deutschen Juristentag 2006 wurde das Thema Sterbehilfe diskutiert (Verrel 2006). In den Beschlüssen lassen sich alternative Begriffsvorschläge lesen, auch wenn diese nicht ausdrücklich als Alternativterminologie ausgewiesen sind. Das Papier verzichtet auf den Ausdruck Sterbehilfe und verwendet stattdessen die Bezeichnung Sterbebegleitung. So lautet der Titel der Themengruppe „Patientenautonomie und Strafrecht bei der Sterbebegleitung“. Statt passiver Sterbehilfe verwenden die Verfasser den Ausdruck straflose Behandlungsbegrenzung. Indirekte Sterbehilfe wird durch die Bezeichnung Leidenslinderung bei Gefahr der Lebensverkürzung ersetzt. Auch der Begriff aktive Sterbehilfe wird nicht verwendet. Stattdessen wird ausschließlich auf den Ausdruck Tötung auf Verlangen zurückgegriffen (Deutscher Juristentag 2006). Beim Deutschen Juristentag handelt es sich um ein am juristischen Diskussionsprozess wesentlich beteiligtes Gremium. Die hier wiedergegebenen Aussagen sind daher ein wichtiger Ausschnitt aus der juristischen Debatte.
Beide Alternativvorschläge basieren auf dem der herkömmlichen Terminologie zu Grunde liegenden Konzept. Demnach kann unter bestimmten Umständen das ansonsten übliche Behandlungsziel, bestehend aus Lebenserhaltung und Leidminderung, verändert werden. Stattdessen stehen dann Leidminderung und die Begleitung im Sterben im Vordergrund. Dieses Konzept greift allerdings nur in der letzten Lebensphase eines Menschen. Es setzt voraus, dass das Sterben als Teil des Lebens und somit als natürlicher, aber auch gestaltbarer Prozess begriffen wird. Die bisher übliche Terminologie bezeichnet zwar genau diese Vorstellung, erfasst sie aber nicht widerspruchsfrei, was durch die Alternativvorschläge geleistet werden soll.
Kernaussage
Am Lebensende kann das sonst übliche Behandlungsziel verändert werden: Statt Heilen und Leidmindern können dann Leidmindern und Begleiten im Sterben maßgeblich werden.
Anders sieht es bei der Stellungnahme des Nationalen Ethikrates zur „Selbstbestimmung und Fürsorge am Lebensende“ aus (Nationaler Ethikrat 2006). Darin wird nicht nur eine gänzlich neue Terminologie vorgeschlagen, sondern auch eine konzeptionelle Erweiterung vorgenommen. Der Vorschlag sieht vor, sich terminologisch künftig an den Begriffen Sterbebegleitung, Therapien am Lebensende, Sterbenlassen, Beihilfe zur Selbsttötung und Tötung auf Verlangen zu orientieren.
Der Begriff Sterbebegleitung bezeichnet Maßnahmen, die vor allem der Wahrung von Autonomie und Würde in der Sterbephase dienen. Pflegerisches und medizinisches Handeln haben sich demnach an dem Wohl und dem Wohlbefinden des Patienten zu orientieren. Dazu gehören Körperpflege, das Stillen von Hunger und Durst, das Mindern von Angst, von Atemnot und Übelkeit sowie menschliche und seelsorgerische Zuwendung. Der Begriff bezeichnet somit gewissermaßen ideale Rahmenbedingungen, innerhalb derer medizinische (Be-)Handlungsentscheidungen am Lebensende getroffen werden sollten.
Der Ausdruck Therapien am Lebensende soll den bisher gebräuchlichen Begriff indirekte Sterbehilfe ersetzen und erweitern. Er umfasst alle medizinischen Maßnahmen am Ende des Lebens, die entweder das Ziel haben, Leben zu verlängern oder aber – sofern dies nicht mehr möglich ist und gegebenenfalls unter Inkaufnahme eines beschleunigt eintretenden Todes – Leid zu mindern. Die Bezeichnung Sterbenlassen wird als Alternative zum bisherigen Ausdruck passive Sterbehilfe vorgeschlagen. Missverständnissen, die sich aus der Bedeutung der Adjektive aktiv und passiv ergeben, wäre durch die neue Terminologie vorgebeugt. Auch die Sedierung am Lebensende wird dieser Kategorie zugeordnet. Der Begriff Beihilfe zur Selbsttötung behält seine bisher übliche Bedeutung. In der Bezeichnung Tötung auf Verlangen dagegen geht der Terminus aktive Sterbehilfe auf.
Der Vorschlag des Nationalen Ethikrates ist somit Ausdruck eines Umdenkens. Grundsätzlich wird auch hier auf das beschriebene Konzept zurückgegriffen. Dennoch kommt es dabei zu einer Schwerpunktverschiebung. Mit dem Begriff Sterbebegleitung wurde so für einen bis dahin zu wenig beachteten Bereich eine eigene Bezeichnung geschaffen: die Pflege und Betreuung von Sterbenden über die rein medizinischen Maßnahmen hinaus. Hier geht es um menschliche Zuwendung und seelsorgerischen Beistand. So wird die vielleicht wichtigste Seite des Sterbeprozesses, die der Zwischenmenschlichkeit, gewürdigt.
Literatur
Bundesärztekammer 2004; Eibach 2000