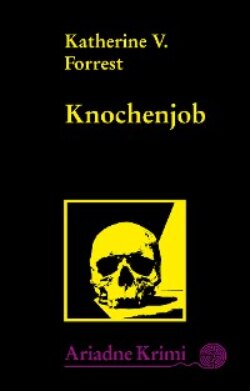Читать книгу Knochenjob - Katherine V. Forrest - Страница 6
ОглавлениеDer Tümpel, nicht tiefer als ein Felsbrocken und schwarz wie ein Grab, spiegelt den verblassenden Mond und die Sterne, nicht jedoch das umstehende Schilf. Über seine Oberfläche – bedeckt mit Blättern, kleinen Zweigen und Rindenstückchen, Federn und winzigen Knochen – ziehen Kreise.
Eine große schwarze Blase steigt allmählich aus den Tiefen des Tümpels empor, dehnt sich langsam und gleichmäßig bis an ihre Grenze, verschwindet dann mit einem Plock des Verendens; nur ein weiterer sich ausbreitender Kreis auf der Wasseroberfläche erinnert noch an sie.
Die heraufziehende Dämmerung enthüllt am Horizont die runden Konturen entfernter Hügel. Sie begrenzen ein weites Tal, hier und da mit Nebelschwaden bedeckt, eingenommen von einem unbeirrbaren Heer aus Bärentraube, Holunder, Beifuß, Ambrosien, Wacholder, Hartriegel, Giftsumach und Disteln, dazwischen aufragend Kiefern und Zwergeichen. Die nächtlich kühle Erde, fett von verwesten Pflanzen und Tieren, klamm vom Tau, verströmt den Gestank von Tod und Fäulnis.
Eine riesige schwarze Gestalt bahnt sich behutsam einen Weg durch den Schilfgürtel zum Wasser. Im schwachen Licht ist ihre Silhouette zu erkennen: Es ist eine Büffelkuh, ein Koloss, der höchste Punkt ihrer muskelbepackten Schultern gut zwei Meter hoch. Sie geht schützend vor ihrem Jungen her, einem vier Monate alten Kalb, das hinter ihr herspringt; unbeholfen und unschuldig, aber schon wachsam knabbert es an zarten Grashalmen im niedrigen Gebüsch.
Weiteres Leben erwacht. Der erste zaghafte Ruf eines Vogels hallt mit scharfer Klarheit quer durch das Tal. Ein ängstliches Rascheln von Ratten, Eichhörnchen und Hasen, die zaghaft ihre Umgebung erkunden. Im dichten Unterholz hält sich ein Säbelzahntiger versteckt und schläft.
Noch ein Geräusch: Das Kalb schlabbert und schlürft Wasser, trottet am Ufer des Tümpels entlang. Seine Mutter folgt ihm, schiebt ihren wuchtigen Körper weiter in das seichte Gewässer, wo sie ihre Hufe fester aufsetzt. Wachsam und bewegungslos steht sie im ebenholzfarbenen Wasser, beobachtet ihr Kalb, lauscht, den Kopf erhoben, die gekrümmten Hörner aufgerichtet. Hier lauern anscheinend keine Gefahren. Beruhigt stillt sie ihren Durst.
Schon bald klettert das Kalb, auf der Suche nach dem saftigen, taufeuchten Gras, die Uferböschung wieder hinauf. Da hört es angsterfülltes Platschen, bemerkt, dass seine Mutter ihm nicht folgt, und hält an, macht kehrt auf seinen dünnen Beinen.
Die Büffelkuh hat sich nicht vom Fleck gerührt – sie kann nicht. Ihre Hufe stecken fest. Sie versucht wieder und wieder, mit aller Gewalt aus dem scheinbar harmlosen, seichten Tümpel zu gelangen. Ihr Kalb tänzelt nervös umher. Sie nimmt all ihre Kraft zusammen, und es gelingt ihr, einen teerverschmierten Huf herauszuziehen. Zum Befreien der übrigen fehlt ihr jedoch ein Hebel. Sie ist in eine vom Wasser verborgene Masse eingesunken. Die ist zwar dünn, so dass sie sich allmählich Bewegungsfreiheit verschaffen kann, doch ohne Ergebnis. Die Büffelkuh muss machtlos mit ansehen, wie ihr Kalb panisch wird. Sein Blöken und seine unregelmäßigen Hufschläge sind deutliche Signale für die Raubtiere.
Im Unterholz erwacht mit einem Ruck der Säbelzahntiger und kriecht, die Ohren für die Laute der Verzweiflung gespitzt, aus seinem Versteck. Geschmeidig und lautlos springt er in großen Sätzen durch das Gras, zielstrebig auf den Ort des Aufruhrs zu.
Die Anstrengungen der Büffelkuh werden zur Raserei, als das gelbbraune, gefleckte Raubtier durch die taufeuchten Binsen in ihr Blickfeld kriecht, seine gelben Augen auf ihr Kalb fixiert, seine gewaltigen gebogenen Reißzähne schimmernd im zunehmenden Licht der Dämmerung.
Die Raubkatze, auf Beute aus, beurteilt das Kalb mit kalter, flinker Berechnung als verirrtes Tier; die erste Mahlzeit des Tages wird schnell und leicht zu töten sein. Sie kauert auf den Hinterläufen, lauert. Die Büffelkuh brüllt, rasend in ihrer Qual.
Der Säbelzahntiger bricht den Angriff ab, springt zurück, knurrt, wappnet sich gegen die sicherlich ungestüme Verteidigung seines geplanten Opfers durch das Muttertier.
Das wütende Brüllen hält an, aber der Büffel bricht nicht aus dem Tümpel hervor. Die Raubkatze, tief auf ihren Hinterläufen, mit schlagendem Schwanz, schleicht vorsichtig vorwärts, die Augen auf den Büffel geheftet. Warum verteidigt er sein Junges nicht – warum nicht sich selbst? Der erwachsene Büffel ist eine viel verlockendere Beute, bei weitem nicht zu groß für das Jagdvermögen der Raubkatze, ein üppiges Festessen für diese und viele weitere Mahlzeiten.
Die Raubkatze knurrt herausfordernd. Der Büffel, der mit aller Macht darum ringt, sich zu befreien, kann nur aufsässig und wütend brüllen.
Weitere Raubtiere tauchen auf. Fünf durch das Knurren und Wüten von Jäger und Gejagten angelockte Schreckenshunde kreisen im Gras hinter dem Säbelzahntiger das verängstigte Kalb schnell ein, blecken riesige, spitze Zähne in ihren mächtigen Mäulern.
Wieder brüllt die Büffelkuh in Todesangst. Am Rand des Tümpels reckt sich der Säbelzahntiger zu voller Größe auf, spielt mit seiner bewegungsunfähigen Beute. Mit triumphierendem Gebrüll schlägt er eine Schleife am Ufer des Tümpels, von der Büffelkuh weg, als wolle er sie verschonen, macht dann plötzlich kehrt, duckt sich und springt. Er schlägt seine Klauen in ihren Rücken, rammt die beiden säbelgleichen Zähne in ihren Nacken, zieht sie heraus, sticht wieder zu und wieder. Das Raubtier springt leichtfüßig in den Tümpel, vollendet seinen Sieg, indem es den massigen Körper am Kopf herunterzieht.
Das Leben der Büffelkuh verebbt in einem purpurroten Strom im schwarzen Wasser, sie sieht nicht das leuchtend rote Blut, das aus der knurrenden, sich keilenden Meute der Schreckenshunde spritzt, die ihr Kalb in den sich schnell rötenden Tümpel reißen, wo sie es gierig verschlingen.
Nach einigen Minuten ebben die Fressgeräusche ab. Die Raubkatze, gesättigt, eine Pfote auf ihrer grausam zerrissenen, übel zugerichteten Beute, hebt ihren blutverschmierten Kopf und brüllt ihre Überlegenheit heraus. Im Begriff, großspurig aus dem Tümpel zu schreiten und die Reste ihrer Beute zu ihrem Bau zu schleifen, muss sie feststellen, dass ihre übrigen drei Beine feststecken. Sie zerrt vergeblich, knurrt wütend, stemmt sich mit allen vier Pfoten in den Tümpel, um einen Hebel anzusetzen, doch dadurch sinkt sie gänzlich ein, noch weniger bewegungsfähig als ihre Beute zuvor. Vier der fünf Schreckenshunde sind ebenfalls in Not, sitzen fest wie die Raubkatze, nur einer von ihnen kann sich in die Sicherheit des Schilfs retten.
Während das Kämpfen, Heulen und Brüllen im Tümpel unvermindert anhält, tauchen Koyoten und Wiesel auf, von dem Aufruhr und dem metallischen Blutgeruch angezogen, daneben weitere Schreckenshunde, ein Luchs und ein Puma. Sie sichten furchterregende Feinde, die zur hilflosen Beute geworden sind, und greifen an, zerrend, reißend. Ein paar Geier ziehen immer niedrigere Kreise über dem Gemetzel; doch abgeschreckt vom Beißen und Knurren der gefangenen Tiere und der gierigen, opportunistischen Brutalität der Neuankömmlinge, flattern sie wieder empor, warten geduldig, bemerken nicht die teerige, erstarrende Masse, die ihnen bei der Keilerei der Opfer und Angreifer auf die Federn geschleudert wird.
Als sie schließlich an der Reihe sind und sich daranmachen, Tote wie Lebende zu fressen, hüpfen sie in den Tümpel, um beim Reißen und Ziehen am Fleisch eine gute Position zu haben: Damit sind auch sie gefangen, außerstande zu entkommen.
Und so kommen alle um, die das Schlachtfeld betreten haben, um die Hilflosen zu morden. Eine siebeneinhalb bis zehn Zentimeter dicke, tödliche, zähe Asphaltschicht, hervorgequollen aus den Tiefen der Erde, hat Opfer und Räuber gleichermaßen in ihrer Gewalt.
Der schwarze Tümpel schließt sich allmählich, unaufhaltsam über ihnen allen, begräbt sie in seinem teerigen Konservierungsmittel, bewahrt ihre Knochen und die Geschichte dieses Gemetzels – für die kommenden fast vierzigtausend Jahre.