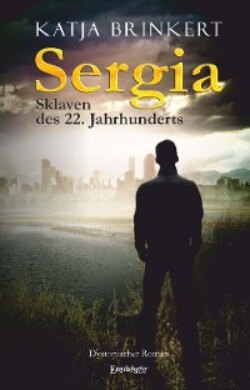Читать книгу Sergia - Sklaven des 22. Jahrhunderts - Katja Brinkert - Страница 6
ОглавлениеCharles trat das Gaspedal bis zum Anschlag durch. Er war wie immer viel zu spät und so strapazierte er seinen Wagen aufs Äußerste. Mit quietschenden Reifen bog er um die letzte Kurve und schlitterte gekonnt in eine freie Parklücke. Als er aus dem Wagen stieg sah er, wie sich eine Gardine im Haus bewegte.
Er stieg aus seinem Wagen und blickte sich um. Die Häuser in der engen Straße waren heruntergekommen, der Putz blätterte von den Wänden und die Vorgärten sahen ungepflegt und verwildert aus. Sein schicker, silberner Mercedes wirkte zwischen den geparkten Rostlauben deplatziert, und wie jedes Mal, wenn er seinen geliebten Wagen hier abstellte, fragte Charles sich, ob er nachher noch da sein würde. Liebevoll strich er mit der Hand über den glänzenden Lack, dann überquerte er die Straße und ging durch den kleinen, verwahrlosten Vorgarten zu dem Haus seines Schwagers. Noch bevor er die Klingel betätigen konnte, öffnete sich die Tür.
»Du fährst wie ein Henker«, begrüßte Albert seinen Gast.
»Und du könntest endlich mal deinen Garten in Ordnung bringen«, konterte Charles grinsend.
Albert starrte seinen Besucher einen Moment an, dann verzog er sein Gesicht zu einem halbherzigen Lächeln, trat zur Seite und ließ seinen Gast eintreten.
Charles ging durch den dunklen Flur ins Wohnzimmer. Die Möbel hier hatten ihre besten Tage bereits hinter sich. Der Cordbezug des Sofas war auf der Sitzfläche abgewetzt und hatte sogar schon einige Löcher, der Tisch war übersäht von Kratzern, und eine der Schranktüren hing schief in ihren Angeln. In seinem teuren Designer-Anzug wirkte Charles in diesem Raum genauso deplaziert, wie sein Auto draußen auf der Straße. Albert war seinem Schwager gefolgt und deutete nun auf den gedeckten Esstisch.
»Ich befürchte, es ist schon wieder kalt«, sagte er mit einem leichten Vorwurf in der Stimme.
»Es tut mir leid, aber ich musste noch etwas Geschäftliches regeln«, antwortete Charles entschuldigend.
Albert verzog das Gesicht.
»Geschäft«, knurrte er. »Ein schönes Geschäft ist das.«
Charles Blick verfinsterte sich.
»Du sagst es«, antwortete er. »Es ist das Geschäft, das mein Großvater während der Weltwirtschaftskrise aufgebaut hat, und ich werde sein Imperium so gut weiterführen, wie es mir möglich ist.«
Albert schnaubte angewidert.
»Vor 300 Jahren nannte man so etwas Sklaverei«, konterte er.
»Die Dumare Sergia Corporation ist ein weltweit operierendes Unternehmen und ja, zu unserem Betriebskapital zählen auch Sergia. Wir produzieren mit ihrer Hilfe Lebensmittel, bauen Häuser und treiben die technische Entwicklung weiter voran.
Wir machen ein zivilisiertes Leben, so wie du es kennst, überhaupt erst möglich.«
Charles atmete tief durch und versuchte, seinen Ärger hinunter zu schlucken. Es hatte einfach keinen Sinn, mit seinem Schwager darüber zu diskutieren, wie er seinen Lebensunterhalt verdiente. Albert würde es niemals verstehen und er hatte keine Lust, schon wieder mit ihm zu streiten.
»Wo ist Luke?«, fragte Charles, um das Thema zu wechseln.
Albert seufzte.
»Er ist mit diesen Hoverbike-Typen unterwegs.«
»Schon wieder?«, fragte Charles, und runzelte die Stirn. »Du musst ihm den Umgang mit diesen Typen verbieten.«
Albert seufzte erneut.
»Ich komme nicht mehr an den Jungen ran«, sagte er und ließ den Kopf hängen. »Er lässt sich nichts mehr von mir sagen und ist total verschlossen. Charles, ich mache mir solche Sorgen, dass er auf die schiefe Bahn gerät.«
»Soll ich mal versuchen mit ihm zu sprechen?«, bot Charles an.
Albert nickte.
»Vielleicht hört er ja auf dich, aber ich kann es mir nicht vorstellen«, antwortete er niedergeschlagen.
Gemeinsam gingen sie zum Esstisch und Albert gab seinem Gast Kartoffeln und Gemüse auf.
»Fleisch kann ich heute leider nicht bieten«, sagte er und lächelte entschuldigend.
»Kein Problem, ich versuche sowieso im Moment, meinen Fleischkonsum ein wenig zu reduzieren«, antwortete Charles.
In diesem Moment fiel die Haustür geräuschvoll ins Schloss.
»Luke?«, rief Albert.
»Wer sonst?«, kam eine barsche Antwort aus dem Flur.
Charles runzelte die Stirn. Das war ganz und gar nicht Lukes Art, mit seinem Vater zu sprechen.
»Komm, das Essen wird kalt«, sagte Albert so laut, dass Luke ihn im Flur hören konnte.
Von draußen war ein genervtes Stöhnen zu hören, dann kam Luke um die Ecke geschlurft. Er war ein schlanker, junger Mann mit blonden, kurz geschnittenen Haaren. Seine Gesichtszüge waren sehr fein, fast mädchenhaft, jetzt waren sie jedoch verkniffen und er wirkte älter als seine 18 Jahre.
»Hallo Luke«, begrüßte Charles seinen Neffen.
»Hey, Onkel Charly«, sagte Luke, und hob übertrieben lässig eine Hand zum Gruß.
»Was ist das für eine Jacke?«, fragte Albert seinen Sohn, und deutete auf die nagelneue, schwarze Lederjacke, die Luke trug.
»Die?«, fragte Luke, und griff mit einer Hand zum Revers, als merke er erst jetzt, dass er überhaupt eine Jacke trug.
»Ja, diese Jacke«, entgegnete Albert ungeduldig.
»Die ist cool, oder?«, sagte Luke und grinste.
»Mir ist egal ob sie cool ist, ich will wissen, wo du sie her hast«, sagte Albert.
»Ist doch egal«, patzte Luke seinen Vater an.
»Luke«, sagte Charles nun streng, »ich glaube nicht, dass dieser Ton deinem Vater gegenüber angemessen ist.«
Luke stöhnte, und verdrehte demonstrativ die Augen.
»Ich hab die Jacke von Kevin, jetzt zufrieden?«, antwortete er schließlich.
»Und wo hat Kevin die Jacke her?«, fragte Albert weiter.
»Ist doch egal«, antwortete Luke erneut, und wandte sich zum Gehen.
»Luke, wir sind noch nicht fertig«, rief Albert ihm hinterher, aber Luke hatte das Wohnzimmer schon verlassen und die Tür hinter sich zu geknallt.
Albert ließ den Kopf hängen.
»Siehst du jetzt, was ich meine?«, fragte er sein Gegenüber unglücklich.
Charles nickte.
»Darf ich?«, fragte Charles, und deutete auf die geschlossene Tür.
»Ich glaube nicht, dass es etwas bringen wird, aber tu dir keinen Zwang an«, antwortete Albert.
Charles ließ seinen vollen Teller stehen, und ging durch den dunklen Flur zu Lukes geschlossener Zimmertür. Er klopfte kurz, dann öffnete er die Tür einen Spalt breit.
»Darf ich rein kommen?«, fragte er.
»Na klar«, antwortete Luke gelangweilt.
Charles öffnete die Tür ganz und betrat das Zimmer. Luke lag ausgestreckt auf seinem Bett und starrte an die Decke, die Lederjacke lag achtlos zusammengeknüllt auf dem Boden.
Der Schreibtisch am Fenster quoll über vor Computerteilen, von denen wahrscheinlich mindestens die Hälfte defekt war.
Auf einem zweiten, kleineren Tisch stand Lukes ganzer Stolz, sein neuer High-Tech Rechner, den er von Charles zu seinem 18. Geburtstag bekommen hatte. Auf den Regalen an den Wänden stapelten sich Bücher über die verschiedensten Programmiersprachen und Anwendungsprogramme. Charles schob den Schreibtischstuhl hinüber zum Bett und setzte sich.
»Was ist los mit dir, Luke?«, fragte er.
»Was soll mit mir los sein?«, konterte Luke, ohne seinen Onkel dabei anzusehen.
»Genau das frage ich dich.«
»Du fängst schon genauso an wie er«, sagte Luke genervt, und deutete mit dem Kopf in Richtung seiner Zimmertür.
»Vielleicht macht dein Vater sich einfach Sorgen um dich?«, fragte Charles.
»Das ist doch Schwachsinn, ich habe alles im Griff«, antwortete Luke, wobei er weiter an die Decke starrte.
»Sieh mich bitte an, Luke«, sagte Charles.
Betont angestrengt setzte Luke sich auf und blickte seinen Onkel an.
»Ich glaube ganz und gar nicht, dass du alles im Griff hast«, sagte Charles.
Luke verdrehte die Augen.
»Merkst du nicht, wie du dich verändert hast?«, fragte Charles seinen Neffen.
»Ja, ich habe mich verändert und ich bin froh darüber. Ich sitze nicht mehr den ganzen Tag vor diesem doofen Computer. Ich habe jetzt Freunde, mit denen ich rumhängen kann«, antwortete Luke gereizt.
Charles nickte langsam.
»Wenn du das meinst. Dann hast du wahrscheinlich hierfür keine Verwendung mehr.«
Mit diesen Worten warf er Luke ein kleines Päckchen zu, kaum größer als eine Streichholzschachtel. Luke fing es geschickt auf.
»Was ist das?«, fragte er, und zeigte zum ersten Mal an diesem Abend so etwas wie Interesse.
»Etwas, für das in deinem neuen Leben, mit deinen neuen Freunden, wohl kein Platz mehr ist«, antwortete Charles.
Dann stand er auf, und ging zur Tür. Bevor er sie öffnete drehte er sich noch einmal um.
»Falls du doch nicht alles im Griff haben solltest, kannst du mich jederzeit anrufen. Du weißt, dass ich immer für dich da bin.«
»Ja ja«, brummte Luke und ließ sich wieder rittlings auf sein Bett fallen.
Charles seufzte, und ging zurück zu seinem Schwager ins Wohnzimmer. Doch auch hier war die Stimmung nicht besser als in Lukes Zimmer, und so verabschiedete Charles sich schon bald mit dem Vorwand, noch arbeiten zu müssen.
Im Laufe der nächsten Woche musste Charles oft an seinen Neffen denken, der sich so zu seinem Nachteil verändert hatte. Natürlich war es nicht normal für einen Jungen seines Alters gewesen nur zu Hause vor dem Computer zu sitzen und niemals Freunde zu treffen. Aber es war auch nicht normal, dass er nun alles, was er in den letzten Jahren verpasst hatte, auf einmal nachholen wollte.
Charles hatte seine Kontakte ein bisschen spielen lassen, und dabei herausgefunden, dass drei der fünf Mitglieder von Lukes neuer Gang mehrfach wegen Diebstahls vorbestraft waren. Sie hatten bereits mehrere Wochen im Jugendarrest verbracht, und es sah nicht so aus, als hätte dieser Aufenthalt irgendetwas an ihrer Gesinnung geändert.
Charles hatte seinem Schwager nichts von diesen Erkenntnissen erzählt, Albert machte sich bereits genug Sorgen um seinen Sohn. Aber Charles befürchtete, dass das dicke Ende bald kommen würde. Und er musste nicht lange warten.
Zwei Wochen nach seinem letzten Besuch bei Albert und Luke klingelte mitten in der Nacht sein Telefon. Benommen griff er zum Hörer.
»Dumare«, meldete er sich verschlafen.
»Guten Morgen, Mr. Dumare. Hier spricht Officer Falk vom Cleveland Police Department.«
Mit einem Mal war Charles hellwach.
»Es tut mir leid, dass ich Sie zu dieser frühen Stunde stören muss, Sir, aber hier ist ein junger Mann, der behauptet, er sei ein Verwandter von Ihnen.«
Charles schluckte. Er wusste bereits, wessen Stimme er hören würde, noch bevor das erste Wort gesprochen war. Nach einer kurzen Pause erklang Lukes Stimme. Der Junge wirkte kleinlaut und es hörte sich an, als könne er nur mit Mühe die Tränen zurückhalten.
»Onkel Charly?«
»Was ist passiert, Luke?«, fragte Charles.
»Ich wollte das nicht, Onkel Charly, wirklich. Aber sie haben mich dazu überredet, ich wollte dabei nicht mitmachen«, jammerte Luke, ohne auf die Frage seines Onkels einzugehen.
»Was ist passiert?«, fragte Charles nun fordernder.
Dann ertönte wieder die Stimme des Officers.
»Wir haben Ihren Neffen heute Nacht mit einigen anderen Jugendlichen aufgegriffen, als sie versucht haben, in ein Elektronik-Geschäft einzubrechen.«
Charles saß wie versteinert auf der Kante seines Bettes.
»Mr. Dumare?«, fragte der Officer als Charles nicht antwortete.
»Ich komme so schnell ich kann«, antwortete Charles tonlos, dann legte er ohne ein weiteres Wort auf.
So schnell wie heute Nacht war er noch nie in seine Kleider gesprungen. Innerhalb von nicht einmal zwei Minuten saß er bereits in seinem Wagen, und raste durch die menschenleeren Straßen ins benachbarte Cleveland. Eine viertel Stunde später hatte er das Polizeirevier erreicht. Er parkte seinen Wagen vor der Wache und eilte in das hell erleuchtete Gebäude. Am Empfangstresen des Reviers saß eine Polizistin mittleren Alters über ein Datapad gebeugt und diktierte dem Gerät einen Bericht.
»Guten Morgen, mein Name ist Dumare«, sagte Charles.
Die Polizistin blickte auf.
»Oh, Mr. Dumare. Officer Falk erwartet Sie bereits. Gehen Sie bitte den Gang entlang, zweite Tür rechts.«
Mit diesen Worten deutete sie auf einen kahlen Korridor zu ihrer Rechten. Charles nickte kurz und folgte der Beschreibung. Er machte sich nicht die Mühe anzuklopfen, sondern öffnete direkt die Bürotür. Am Schreibtisch ihm gegenüber saß ein hakennasiger Mann Mitte fünfzig, mit schütterem, grauem Haar. Als Charles den Raum betrat, blickte dieser überrascht auf.
»Charles Dumare.«
»Ah, Mr. Dumare«, antwortete Officer Falk.
Er erhob sich von seinem Stuhl und streckte Charles seine Hand entgegen.
»Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Es ist mir eine Ehre, Sie persönlich kennen zu lernen.«
»Wo ist mein Neffe?«, fragte Charles, ohne die ausgestreckte Hand zu ergreifen.
»Wir haben ihn mit den anderen Jugendlichen vorübergehend in einer unserer Arrestzellen untergebracht«, erklärte Officer Falk.
»Und was genau ist vorgefallen? Sie sagten etwas von einem Einbruch?«, fragte Charles weiter.
»Ja«, bestätigte der Polizist. »Drei der Jugendlichen hatten bereits die Hintertür des Ladens aufgebrochen, zwei weitere standen Schmiere. Ihren Neffen haben wir vor dem Geschäft aufgegriffen, er hat ganz offensichtlich dort Wache gestanden.«
»Officer Falk, ich bin davon überzeugt, dass mein Neffe rein zufällig während dieses Einbruchs an besagtem Laden vorbei kam«, sagte Charles nun betont freundlich.
»Aber er hat seine Schuld bereits zugegeben«, konterte der Polizist.
»Wie gesagt, ich bin überzeugt, mein Neffe hat mit der ganzen Sache nichts zu tun«, beharrte Charles lächelnd.
»Mr. Dumare«, protestierte der Polizist, doch Charles unterbrach ihn.
»Ich denke es ist das Beste, wenn ich die Angelegenheit mit Ihrem Vorgesetzten weiter bespreche.«
»Chief Hillard ist zu Hause«, antwortete der Officer.
»Dann rufen Sie ihn bitte an, und teilen Sie ihm mit, dass ich ihn unverzüglich zu sprechen wünsche.«
»Aber …«, stammelte der Polizist, doch Charles unterbrach ihn erneut.
»Unverzüglich, Officer Falk«, wiederholte er.
Dann setzte er sich in den Stuhl vor dem Schreibtisch des Officers, schlug die Beine übereinander, und faltete die Hände in seinem Schoß. Überfahren von dieser Bestimmtheit, griff der Polizist zu seinem Telefon und wählte die Nummer seines Vorgesetzten. Er brauchte nicht lange, um seinen Chief davon zu überzeugen, umgehend aufs Revier zu kommen. Es genügte, den Namen Dumare zu erwähnen.
Charles musste etwa zwanzig Minuten warten, bis der Leiter des Polizeireviers eintraf. Der Chief war ein drahtiger Mann Ende vierzig, mit streng zurückgekämmten, dunkelbraunen Haaren und buschigen Augenbrauen. Er reichte Charles die Hand. Diesmal ergriff Charles sie.
»Wirklich eine unangenehme Sache, Sir«, sagte der Chief.
»Eine unangenehme Sache, die wir sicherlich aus der Welt schaffen können«, antwortete Charles lächelnd, und zog seine Geldbörse aus der Tasche.
»Sir?«, fragte der Chief vorsichtig.
»Ich bin überzeugt die Polizei von Cleveland ist jederzeit dankbar für die Unterstützung eines braven Bürgers«, fuhr Charles fort.
»Mr. Dumare, Sie glauben doch nicht im Ernst, dass Sie einen Straftäter bei uns freikaufen können«, mischte Officer Falk sich in das Gespräch.
Charles lächelte weiter betont freundlich.
»Officer Falk, ich bin mir sicher, Sie haben noch anderweitig zu tun«, sagte der Chief zu seinem Officer, und blickte ihn warnend an.
»Aber Sir«, empörte Falk sich weiter.
»Officer, bitte lassen Sie uns alleine, ich möchte mir in Ruhe die Argumente von Mr. Dumare anhören«, sagte der Chief.
Officer Falk biss die Zähne zusammen.
»Vielleicht können Sie sich in der Zwischenzeit nützlich machen und den Neffen von Mr. Dumare nach vorne bringen.«
Falk knirschte mit den Zähnen.
»Ja, Chief«, knurrte er.
Dann drehte er sich um und verließ stampfend das Büro.
Nachdem er die Tür hinter sich geschlossen hatte, wandte der Chief sich wieder Charles zu.
»Mr. Dumare«, sagte der Chief nun, »wie genau hatten Sie sich diese Unterstützung vorgestellt?«
Bei diesen Worten ließ er den Geldbeutel seines Gegenübers nicht aus den Augen. Charles öffnete langsam seine Börse und holte ein Bündel Scheine hervor.
»Wie ich bereits versucht habe ihrem Officer zu erklären bin ich davon überzeugt, dass mein Neffe nur zur falschen Zeit am falschen Ort war.«
Er legte das Geld zwischen ihnen auf den Tisch. Der Chief blickte die Scheine einen Moment gierig an, dann griff er zu, und steckte sie schnell ein.
»Ja, Sir, ich glaube auch, dass es sich hier um ein bedauerliches Missverständnis handelt«, sagte er.
»Dann sind wir uns also einig, dass mein Neffe mich begleiten wird, wenn ich jetzt gehe?«
»Selbstverständlich, Sir«, antwortete der Chief.
Charles erhob sich, und lächelte zufrieden.
»Vielen Dank für Ihre Kooperation, Chief Hillard. Ich freue mich immer, wenn ich die Arbeit der Polizei unterstützen kann.«
Gemeinsam verließen sie das Büro und gingen nach vorne in den Hauptraum der Polizeistation, wo die Polizistin noch immer ihren Bericht diktierte. Auf einem Stuhl in der Ecke saß Luke zusammengekauert wie ein Häufchen Elend. Er blickte nur kurz auf, als sein Onkel zusammen mit dem Chief den Raum betrat, dann senkte er wieder beschämt den Kopf.
Charles blickte zu ihm hinüber, dann wandte er sich zur Tür.
»Komm Luke, wir gehen«, sagte er knapp.
Luke zuckte zusammen, sprang dann abrupt auf, und folgte seinem Onkel nach draußen ohne sich noch einmal nach den Polizisten umzublicken. Als sie das Revier verlassen hatten, versuchte Luke, ein Gespräch mit seinem Onkel zu beginnen.
»Onkel Charly?«, fragte er vorsichtig.
»Steig in den Wagen«, sagte Charles in einem Ton, der keinen Widerspruch duldete.
Luke ließ niedergeschlagen den Kopf hängen, nickte und tat wie ihm geheißen. Ohne ein weiteres Wort setzte Charles sich ans Steuer, startete den Motor und gab Gas. Sie fuhren etwa zehn Minuten schweigend, bis Charles den Wagen an den Straßenrand steuerte und den Motor abstellte.
Es war mittlerweile kurz vor sechs und die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne glitzerten durch die Bäume. Sie standen am Rand einer großen Wiese, am Horizont konnte man die ersten Häuser von Medikon-City erkennen.
»Lass uns ein Stück zu Fuß gehen«, sagte Charles, ohne seinen Neffen anzublicken.
Er stieg aus und entfernte sich vom Wagen, wohl wissend, dass Luke ihm folgen würde. Nach ein paar Minuten blieb er stehen und drehte sich zu seinem Neffen.
»Was zum Teufel hast du dir dabei gedacht?«, fragte er und sah Luke nun zum ersten Mal direkt an.
»Es tut mir leid, Onkel Charly«, sagte Luke leise und Tränen traten ihm in die Augen.
»Glaubst du jetzt immer noch, dass du alles im Griff hast?«, fragte Charles weiter.
Luke schüttelte den Kopf, während eine Träne an seiner Wange hinunter lief.
»Ich habe gar nichts mehr im Griff«, antwortete er schluchzend.
Charles zögerte einen Moment, dann nahm er seinen Neffen in den Arm. In diesem Moment brachen bei Luke alle Dämme und er begann hemmungslos zu schluchzen.
»Du bist so ein verdammter Idiot«, flüsterte Charles ihm ins Ohr.
Als Luke sich beruhigt hatte, ließ Charles seinen Neffen los und legte seine Hände auf Lukes Schultern.
»Das nächste Mal werde ich dir nicht mehr helfen«, sagte er.
Luke schüttelte energisch den Kopf.
»Es wird kein nächstes Mal geben, das verspreche ich dir.«
»Das will ich hoffen. Hoffentlich hast du aus dieser Geschichte etwas gelernt.«
Luke nickte und wischte sich die letzte Träne von der Wange.
»Onkel Charly«, begann er vorsichtig, »müssen wir Dad davon erzählen?«
Charles seufzte, und senkte kurz den Blick, bevor er Luke wieder direkt ansah.
»Eigentlich sollte ich es ihm erzählen«, begann er.
»Bitte, Onkel Charly«, flehte Luke und erneut traten ihm Tränen in die Augen.
»Ich bin unter zwei Bedingungen bereit, diese Geschichte zu vergessen.«
»Alles«, versprach Luke.
»Erstens wirst du diese Jungs nie wieder sehen. Wenn mir zu Ohren kommt, dass du dich noch einmal mit ihnen triffst …«
»Ganz bestimmt nicht«, fiel Luke ihm ins Wort.
»Außerdem wirst du dich bei deinem Vater für dein unmögliches Verhalten entschuldigen«, fuhr Charles fort.
»Ich war wohl ein ganz schöner Dummkopf«, murmelte Luke.
»Dein Vater hat sich wirklich Sorgen um dich gemacht. Ich glaube nicht, dass er so eine Behandlung verdient hat.«
Luke atmete tief durch.
»Du hast Recht, ich werde mich entschuldigen«, sagte er schließlich. »Aber was soll ich ihm erzählen, wo ich heute Nacht war?«
»Das musst du schon selbst wissen. Doch ich würde zumindest bis zu einem gewissen Punkt bei der Wahrheit bleiben.
Und ich erwarte, dass du den Hausarrest, oder was immer Albert sich für dein Fortbleiben und deine Aufsässigkeit einfallen lässt, klaglos annimmst.«
Luke nickte erneut.
»Ja, Onkel Charly«, sagte er ergeben.
»Guter Junge«, sagte Charles lächelnd und packte Luke freundschaftlich am Genick.
Gemeinsam gingen sie weiter den Wiesenweg entlang, doch jetzt war die Stimmung gelöster.
»Ich glaube, ich habe mich noch gar nicht bei dir bedankt«, sagte Luke nach einer Weile.
»Nein, das hast du nicht«, bestätigte Charles.
»Danke«, murmelte Luke.
Charles lächelte erneut.
»Was wäre ich für ein Onkel, wenn ich meinem Lieblingsneffen nicht ab und zu aus der Patsche helfen würde«, erklärte er.
»Aber ich bin dein einziger Neffe«, entgegnete Luke verwirrt.
Charles zwinkerte seinem Neffen zu und Luke musste gegen seinen Willen ebenfalls lächeln. Dann griff Luke in seine Tasche, und holte ein kleines Päckchen hervor. Charles erkannte es sofort, es war das Päckchen, das er Luke vor zwei Wochen, nach ihrem gescheiterten Gespräch, gegeben hatte.
Die Verpackung war noch unangetastet, Luke hatte es noch nicht geöffnet.
»Ich glaube, ich sollte langsam mal hier rein schauen«, sagte er, und riss das Papier auf.
Als er auf den Inhalt starrte, schnappte er überrascht nach Luft.
»Ein 5000 Exabyte Speicherchip?«, fragte er.
»Ich dachte, er würde dir gefallen. Es ist ein Prototyp«, antwortete Charles.
Luke starrte noch immer auf den kleinen Chip.
»Wow, Onkel Charly, das ist der Hammer«, japste er begeistert.
»Verdient hast du ihn nicht«, sagte Charles.
Luke schwieg betreten.
»Aber ich hoffe trotzdem, dass du ihn gebrauchen kannst«, fügte Charles nach einer kurzen Pause lächelnd hinzu.
»Und ob«, sagte Luke, und strich mit einer Hand ehrfürchtig über den Speicherchip.
Wie zu erwarten war, hatte Albert sich über den nächtlichen Ausflug seines Sohnes furchtbar aufgeregt, doch Lukes kleinlaute Entschuldigung hatte ihn ein wenig besänftigt. Als Konsequenz verlangte er von seinem Sohn, genau wie Charles, dass er jeglichen Kontakt zu den ‚Bike Bandidos‘ abbrach, außerdem hatte Luke vier Wochen Hausarrest – und das genau in den Frühjahrsferien. Aber wie Luke seinem Onkel versprochen hatte, nahm er die Strafe ohne zu murren an. Er war sich durchaus bewusst, dass er sie verdient hatte.
Als die Schule nach drei Wochen wieder begann, und Luke das Haus zum ersten Mal verlassen durfte, hatte er einen dicken Kloß im Hals. Die Bandidos wussten noch nicht, dass Luke sich von ihnen los gesagt hatte und nun befürchtete er, dass die Gang vor der Schule auf ihn warten würde. Und er hatte Recht.
Als er um die letzte Ecke bog, und das Schulgebäude in Sicht kam, schwebten dort, vor dem Haupteingang, fünf Hoverbikes.
Luke atmete tief durch und ging zögernd weiter.
»Hey, Bad Luke«, wurde er sofort von einem vierschrötigen Jungen begrüßt.
»Hallo Kevin«, antwortete Luke reserviert.
»Wo bist du die ganze Zeit gewesen?«, fragte Kevin vorwurfsvoll.
»Ich hatte Hausarrest«, antwortete Luke.
Die fünf Biker lachten laut.
»Hausarrest?«, fragte der Junge zu Kevins Linken belustigt.
»Du lässt dir von deinem Alten vorschreiben, wann du aus dem Haus gehen darfst?«
Luke schwieg. Seine fünf ehemaligen Freunde hatten ihn stets spüren lassen, dass sie sich für selbstständiger und reifer hielten. Luke hatte versucht mit ihnen mitzuhalten - und war grandios gescheitert.
»Wohin bist du eigentlich so schnell verschwunden, als der Bulle dich damals aus der Zelle geholt hat?«, fragte nun der Junge zu Kevins Rechten.
»Mein Onkel hat mich abgeholt«, antwortete Luke.
Die Bandidos lachten wieder.
»Der kleine Luke möchte aus dem Kinderparadies abgeholt werden«, äffte einer von ihnen.
Luke antwortete nicht.
»Ist dein Onkel der Polizei-Präsident, oder was?«, fragte Kevin.
»Nein«, antwortete Luke.
»Wie konnte er dich dann so schnell da raus holen?«, fragte Kevin weiter.
Seine Stimme hatte jetzt einen gefährlichen Unterton.
»Was hast du ihnen erzählt?«
»Nichts«, sagte Luke sofort. »Ich weiß doch nicht mal genau, was ihr da in dem Laden vor hattet.«
»Und das ist auch gut so«, knurrte der Junge zu Kevins Linken.
»Mike«, sagte Kevin streng und der Angesprochene schwieg augenblicklich.
»Also, warum konnte dein Onkel dich da raus holen?«, wandte Kevin sich wieder an Luke.
»Mein Onkel ist Charles Dumare«, murmelte Luke kaum hörbar.
»Wow«, entfuhr es dem Biker zu Kevins Rechten.
Dafür kassierte er einen missbilligenden Blick seines Anführers.
»Soso, der mächtige Dumare«, sagte Kevin. »Dann hast du wohl zu Hause deinen eigenen kleinen Haus-Sergia, der dir den Arsch abwischt und dir hinterher negert.«
Luke schüttelte den Kopf.
»Onkel Charly spricht bei uns nicht über sein Geschäft.«
»Stellt euch vor, wir hätten ein paar Sergia, die die Brüche für uns machen würden«, sagte Mike und grinste breit.
Auch Kevin grinste jetzt.
»Nun zum Geschäft, Luke. Wir geben dir noch eine Chance.
Wir treffen uns heute Abend um halb zwölf in der Jacobstreet. Dort gibt es einen kleinen Supermarkt.«
»Nein«, stieß Luke erschrocken hervor.
»Was meinst du mit ‚nein‘?«, fragte Kevin drohend.
Er stieg von seinem Hoverbike ab, und baute sich vor Luke auf.
»Ich werde nicht mitmachen«, sagte Luke.
Seine Stimme zitterte und sein Herz schlug ihm bis zum Hals.
Dies war das erste Mal, dass er Kevin die Stirn bot.
»Das war keine Frage, Kleiner«, blaffte Kevin sein Gegenüber an, und kam noch einen Schritt näher, so dass sein Gesicht direkt vor Lukes war.
Eingeschüchtert wollte Luke einen Schritt zurück weichen, prallte dabei aber gegen Mike, der sich unbemerkt hinter ihn gestellt hatte, um ihm den Fluchtweg zu verbauen.
»Du wirst tun, was wir dir sagen«, fuhr Kevin drohend fort.
»Nein, ich bin da raus«, japste Luke.
Er starrte Kevin mit angstgeweiteten Augen an.
Kevin musste Mike wohl ein für Luke unsichtbares Zeichen gegeben haben, denn plötzlich packte Mike Luke und drehte ihm die Arme auf den Rücken. Luke stöhnte vor Schmerz auf.
Kevin ballte seine rechte Hand zur Faust und hielt sie Luke vor das Gesicht.
»Ich lasse mich von dir nicht verarschen, Kleiner«, zischte er.
Luke konnte nicht mehr antworten. Sein Mund war zu trocken und obwohl sein Hirn fieberhaft arbeitete fiel ihm nichts ein, was er dem Bandenchef noch hätte sagen können, um aus dieser Situation wieder heraus zu kommen.
»Mr. Williams sagte nein«, ertönte plötzlich eine Stimme zu ihrer Linken.
Die Gruppe der Jugendlichen wirbelte überrascht herum. Vor ihnen stand ein uniformierter Mann, doch es war kein Polizist. Luke erkannte die Kleidung des Mannes sofort, er trug die Uniform eines Supervisors von Onkel Charly.
Ein Glücksgefühl breitete sich in ihm aus, wie er es noch nie verspürt hatte. Er war gerettet.
»Halten Sie sich da raus, Mann«, blaffte Kevin den Uniformierten an.
»Sie werden Mr. Williams augenblicklich loslassen«, fuhr der Mann ruhig fort.
Kevin lachte laut auf.
»Warum sollte ich?«, konterte Kevin.
Der Uniformierte blickte sich kurz um und die sechs Jungen folgten seinem Blick. An der nächsten Straßenecke, etwa zehn Meter von ihnen entfernt, standen sieben weitere Männer.
Mike lockerte seinen Griff und Luke eilte zu seinem Retter.
Dieser nickte Luke zu, dann wandte er sich wieder an die Gangmitglieder.
»Ich gehe davon aus, dass Sie Mr. Williams nicht mehr belästigen werden«, sagte er warnend.
Leise fluchend packte Kevin sein Bike. Er startete den Elektromotor und raste davon. Seine Anhänger folgten ihm augenblicklich.
»Danke«, sagte Luke zu dem Supervisor, als die ‚Bike Bandidos‘ verschwunden waren.
Er wollte dem Supervisor so viel mehr sagen, doch er konnte die Erleichterung, die er verspürte, nicht in Worte fassen. Sein Kopf schien vollkommen leer.
»Ihr Onkel hatte erwartet, dass diese Rocker Ihnen noch einmal Ärger machen würden«, antwortete der Supervisor.
»Dann richten Sie bitte auch Onkel Charly meinen Dank aus.«
»Selbstverständlich«, antwortete der Supervisor.
Er wandte sich ab und verschwand mit seiner Verstärkung so schnell, wie er gekommen war.
Als Luke am Nachmittag nach Hause kam, zitterten ihm noch immer die Knie. Er hatte die fünf Biker für seine Freunde gehalten, doch sie hatten ihn nur ausgenutzt. Er konnte nur inständig hoffen, dass die Warnung des Supervisors sie tatsächlich beeindruckt hatte. Luke betrat das Wohnzimmer und stutzte. Auf dem Sofa saß sein Vater.
»Was machst du hier? Hast du heute Urlaub?«, fragte Luke überrascht.
Albert seufzte, stand auf und ging zu seinem Sohn.
»Sie haben mich gefeuert«, antwortete Albert.
»Was?«, fragte Luke. »Warum?«
»Ich weiß es nicht. Ich habe versucht mit dem Boss zu sprechen, aber seine Sekretärin ließ mich nicht durch. Heute Morgen, als ich kam, war bereits eine Mitteilung in meiner Mailbox, dass ich das Gebäude innerhalb einer Stunde zu verlassen habe.«
Luke starrte seinen Vater entgeistert an.
»Aber das können die doch nicht so einfach machen«, ereiferte er sich.
»Natürlich können sie«, seufzte Albert.
»Aber das ist nicht fair, du arbeitest seit zwanzig Jahren in dieser Firma und hast dir nie etwas zu Schulden kommen lassen«, sagte Luke.
»Was ist in der heutigen Zeit schon noch fair?«, entgegnete Albert.
Er ging zurück zum Sofa und ließ sich in die schäbigen Polster fallen.
»Wir werden nun erst mal den Gürtel ein wenig enger schnallen müssen«, fuhr er fort.
»Noch enger?«, murmelte Luke mehr zu sich selbst als zu seinem Vater.
Sein Vater blickte ihn finster an.
»Du weißt, ich habe immer alles getan, damit es uns an nichts fehlt.«
»Ja, natürlich, entschuldige«, sagte Luke und senkte beschämt den Kopf. »Aber könntest du nicht Onkel Charly fragen, er würde uns bestimmt helfen.«
»Nein, niemals«, unterbrach Albert seinen Sohn heftig. »An seinem Geld klebt das Blut von unzähligen Sergia, ich werde keinen Cent von ihm annehmen.«
Luke starrte sein Gegenüber bestürzt an. Im Gegensatz zu seinem Vater war es ihm egal, wie sein geliebter Onkel seinen Lebensunterhalt verdiente.
»Wir werden das schon schaffen«, sagte Albert, und zwang sich zu einem Lächeln. »Du wirst sehen, ich habe im Handumdrehen einen neuen Job. Und wenn alle Stricke reißen nehmen wir einen zusätzlichen Kredit auf.«
»Glaubst du denn, dass die Bank dir noch einen zweiten Kredit gewährt?«, fragte Luke.
»Lass das mal meine Sorge sein«, sagte Albert ausweichend.
»Aber was, wenn du keinen neuen Job findest? Und dann die Schulden nicht mehr bezahlen kannst?«
Luke machte eine kurze Pause, bevor er leiser weiter sprach.
»Was, wenn sie dich am Ende abholen?«
»Luke, mach dir bitte keine Sorgen.«, versuchte Albert seinen Sohn zu beruhigen.
»Vielleicht könnte ich einen Nebenjob annehmen«, überlegte Luke laut.
»Nein«, sagte Albert bestimmt. »Ich möchte, dass du dich voll auf die Schule konzentrierst.«
»Wie du meinst«, sagte Luke.
Er war davon überzeugt, dass seine schulischen Leistungen nicht darunter leiden würden, wenn er ein paar Stunden in der Woche jobben würde. Aber er wollte sich nicht schon wieder mit seinem Vater streiten. Die letzten Spannungen waren einfach noch nicht lange genug her, um neue Meinungsverschiedenheiten zu provozieren.
Es war später Vormittag. Albert lag auf seinem abgewetzten Sofa, und starrte an die Zimmerdecke. Es war nun acht Wochen her, seit er seinen Job verloren hatte, und die Aussichten auf eine neue Anstellung waren sehr trübe. Er hatte unzählige Bewerbungen geschrieben und genauso viele Absagen erhalten.
Er grübelte darüber nach, wie es weiter gehen sollte, denn das Geld war nun mehr als knapp und er wusste noch nicht einmal, wie er die nächste Rate für seine Kredite aufbringen sollte.
In diesem Moment klopfte es. Albert fuhr erschrocken hoch und blickte verstört zur Tür. Wer in Gottes Namen kam ihn mitten am Tag besuchen? Niemand außer Luke wusste, dass er arbeitslos und somit tagsüber zu Hause war.
Es klopfte erneut, dieses Mal energischer.
Albert erhob sich schwerfällig, schlurfte zur Tür und öffnete.
Vor ihm stand sein Schwager, flankiert von zwei seiner uniformierten Supervisoren. Albert starrte die drei Männer verblüfft an.
»Charly«, sagte er, »ich hatte dich nicht erwartet.«
»Ich bin geschäftlich hier«, antwortete Charles.
Er stand wie versteinert in der Tür, kein Muskel regte sich in seinem Gesicht.
Albert starrte ihn einen Moment verständnislos an, dann weiteten sich seine Augen angstvoll.
»Charly, nein!«, keuchte er.
»Geh zur Seite, Albert«, befahl Charles.
Auf den ersten Blick schien er gänzlich unbeeindruckt von der Angst seines Gegenübers und starrte seinen Schwager an, als wäre er ein Fremder. Doch seine Hände hatte er zu Fäusten geballt.
»Charly, NEIN!!!«, stieß Albert hervor.
»Ist er da?«, fragte Charles.
»In seinem Zimmer«, antwortete Albert mit zitternder Stimme.
Charles wandte sich an seine Supervisoren.
»Den Flur entlang, zweite Tür rechts.«
Die beiden Männer drängten sich an dem erstarrten Albert vorbei und marschierten den Flur entlang.
»Charly, er ist dein Neffe!«, schrie Albert jetzt verzweifelt, und packte sein Gegenüber am Revers.
»Ich mache nur meinen Job«, entgegnete Charles.
Seine steinerne Maske bekam allmählich Risse und ihm war anzumerken, dass er sich nur noch mit Mühe beherrschen konnte. Seine Augen verengten sich zu Schlitzen und sein ganzer Körper bebte vor unterdrückter Wut.
»Wir sind doch deine Familie, Charly«, jammerte Albert weiter und schüttelte sein Gegenüber heftig. »Deine Schwester würde sich im Grabe umdrehen, wenn sie wüsste, was du hier tust.«
Das war zu viel für Charles. Er riss sich wutentbrannt von seinem Schwager los und funkelte ihn zornig an.
»Meine Schwester würde sich im Grabe umdrehen, wenn sie wüsste, dass du bei der Beantragung deiner beiden Kredite nicht dich, sondern euren Sohn als Pfand angegeben hast, du feiger Hund«, brüllte er.
»Versteh doch, Charly. Ich bin über 50 und nicht mehr gesund. Darum wollte die Bank mir nicht mal 300 Dollar geben. Luke hingegen war ihnen ganze 10.000 wert. Was zum Teufel hätte ich denn tun sollen?«
»Du hättest zu mir kommen können, verdammt«, brüllte Charles. »Stattdessen verkaufst du deinen eigenen Sohn!«
»Ich habe ihn nicht verkauft«, verteidigte Albert sich verzweifelt. »Ich habe doch immer pünktlich bezahlt. Bitte Charly, lass mich bei der Bank anrufen, sie werden die kommenden Raten stunden, bis ich eine neue Arbeit gefunden habe.«
»Sie werden deine Raten nicht stunden«, knurrte Charles.
Er atmete tief durch, bemüht, seine Fassung wieder zu erlangen.
»Woher willst du das wissen?«, stammelte Albert.
»Warum glaubst du wohl bin ich hier?«, blaffte Charles seinen Schwager an. »Luke stand bereits auf der Liste.«
»Er … WAS? WARUM?«
»Wie du schon sagtest: Du bist über 50 und hast Vorerkrankungen. Statistisch gesehen geht deine Chance einen neuen Job zu finden gegen null«, sagte Charles.
Er bebte zwar noch immer vor Wut, hatte sich nun aber wieder unter Kontrolle.
»Aber könnte ich nicht bei dir?«, begann Albert vorsichtig.
»Nein«, entgegnete Charles sofort. »Du hättest zu mir kommen können, als es noch nicht zu spät war. Deine Kredite wurden gestern Abend an die Dumare Corporation überschrieben und somit ist dein Sohn nun Eigentum der Dumare Sergia Corporation.«
»Aber du bist die Dumare Corporation«, flehte Albert mit tränenerstickter Stimme. »Du könntest …«
»Sei froh, dass ich die Listen ein paar Stunden vor den anderen Mastern bekomme«, unterbrach ihn Charles barsch. »Was glaubst du, wie begehrt ein gesunder 18-Jähriger ist? Daniel Gardner hätte sich alle zehn Finger nach ihm geleckt. Dann hätte dein Sohn den Rest seines Lebens in den Kohlebergwerken geschuftet.«
Albert starrte seinen Schwager entsetzt an. Er zitterte am ganzen Leib und klammerte sich mit einer Hand an die Klinke der Haustür.
»Charly, bitte«, flehte er erneut. »Er ist dein Neffe, der Sohn deiner Schwester. Deine Familie!!«, jammerte er. »Du kannst doch nicht unsere Familie zerstören!«
»Das werde ich nicht, denn das hast du bereits getan«, blaffte Charles.
Erneut rang er um seine Fassung, doch dieses Mal war er auf seinen aufwallenden Zorn vorbereitet und ließ sich nicht noch einmal von ihm übermannen. Er war ein Profi, und genau so würde er sich auch verhalten.
»Aber du kannst den Jungen doch nicht für meine Fehler büßen lassen«, flehte Albert schluchzend.
Tränen rannen ihm über das erhitzte Gesicht, er war kurz vor einem Zusammenbruch.
»Nicht ich lasse ihn für deine Taten büßen, sondern du!«, konterte Charles.
Er war nun wieder vollkommen beherrscht und seine Stimme war kalt wie Eis.
In ihm jedoch loderte noch immer ein Feuer. Er hatte Albert damals, obwohl er knapp fünfzehn Jahre älter gewesen war als seine Schwester, mit offenen Armen in die Familie aufgenommen.
Mehr noch: Seit dem Tod seines eigenen Vaters hatte er ihn sogar als Vaterersatz gesehen. Umso mehr war er nun von ihm enttäuscht.
Natürlich hatte er von den finanziellen Schwierigkeiten seines Schwagers gewusst und er hatte Albert immer wieder seine Hilfe angeboten, doch dieser war stets zu stolz gewesen, sie anzunehmen.
Nun würde also Luke für den Stolz seines Vaters bezahlen.
Luke, den er selbst liebte wie einen Sohn. Aber zu Gefühlen wie Liebe oder Zuneigung war Charles im Moment nicht fähig. Er war erfüllt von Hass und Verachtung für seinen verstockten Schwager.
Seit er gestern Abend die Vollstreckungslisten der Bank auf den Tisch bekommen hatte brannte ein Feuer in ihm, das er nur mit Mühe im Zaum halten konnte.
Wie hatte Albert nur so etwas tun können? Warum zum Teufel hatte er ihn in solch eine prekäre Situation gebracht?
Was sollte er denn tun? Die Hände in den Schoß legen, so dass Luke in die Hände eines anderen Masters fiel? Niemals.
Sollte er etwa Alberts Kredit bei der Bank auslösen? Sicherlich nicht. Albert hatte vorher sein Geld nicht haben wollen, also musste er jetzt dafür büßen. Oder besser Luke musste dafür büßen. Verdammt. Charles schnaubte innerlich.
In diesem Moment kamen seine beiden Supervisoren zurück.
Sie hatten Luke an beiden Armen gepackt und zerrten den zappelnden Jungen durch den Flur.
»Was zum Henker?«, schrie Luke aufgebracht, unterbrach sich aber, als er Charles in der Tür erkannte.
»Onkel Charly, was ist hier los?«, fragte er, während er weiter versuchte, sich aus dem Griff seiner Häscher zu befreien.
»Luke Williams«, sagte Charles steif, ohne seinen Neffen dabei anzusehen.
Luke gab seine Gegenwehr bei dieser ungewohnt förmlichen Anrede abrupt auf und starrte seinen Onkel verwirrt an.
»Der Kredit Ihres Vaters vom 1. Juli 2110 wurde wegen Gefahr der Nichtzahlung an die Dumare Corporation überschrieben. Bezugnehmend auf das ‚Leibeigenschaft-Dekret‘ aus dem Jahre 2042 gehört Ihr Leben nun der Dumare Sergia Corporation«, fuhr Charles emotionslos fort. »Sie werden augenblicklich an Ihren neuen Master überstellt. Ihr ganzes Sein wird ab heute, bis zu Ihrem Tod, in seinen Diensten stehen. Ein Widerspruch ist nicht möglich.«
»NEIN! DAD! Ich verstehe das nicht«, rief Luke verstört.
»Erklär es ihm«, wandte Charles sich an seinen Schwager.
Albert schüttelte nur den Kopf. Seine Augen waren feucht, doch sein Mund war so trocken, dass er kein einziges Wort heraus brachte.
»Erklär es ihm«, forderte Charles.
Er hatte kein Mitleid mit Albert. Er wollte dass sein Schwager litt, so wie er gelitten hatte, als er die Listen mit Lukes Namen bekommen hatte.
Albert schluchzte.
»Sie haben meine Kredite gekündigt«, sagte er schließlich kaum hörbar.
»Und weiter«, forderte Charles.
»Ich hätte niemals damit gerechnet, dass es so weit kommen würde«, jammerte Albert.
Tränen liefen ihm die Wange hinab, doch er bemerkte es kaum.
»Ja, aber, ich verstehe das nicht«, stammelte Luke und starrte seinen Vater verwirrt an.
»Ich hatte nicht mich, sondern dich als Pfand angegeben«, flüsterte Albert mit tränenerstickter Stimme.
Luke starrte seinen Vater entsetzt an. Er verstand sofort, was sein Vater ihm damit sagen wollte, und schnappte nach Luft.
Kaum hatte Albert geendet, drehte Charles sich abrupt um, und ging, so schnell es ihm ohne zu rennen möglich war, zu seinem Wagen. Er hätte es keine Sekunde länger ertragen, das Gesicht seines Neffen anzusehen.
»Dad!«, rief Luke erneut.
Aber sein Vater konnte ihm nicht mehr antworten. Albert war in sich zusammengebrochen und lag schluchzend auf dem Fußboden.
Charles eilte weiter. Er atmete erst auf, als er in seinem Wagen saß, und die verzweifelten Rufe und das Schluchzen seiner Familie, die er soeben auseinander gerissen hatte, nicht mehr hören musste.
Tränen glitzerten nun auch in seinen Augen und er hasste sich in diesem Augenblick mehr als jeden Anderen auf dieser Erde.
Zeige niemals Schwäche, weder anderen noch dir selbst gegenüber. Regiere deine Untergebenen stets mit eiserner Hand. In einem Imperium wie dem unseren ist für Mitgefühl kein Platz. Nur durch unsere Stärke wird alles zusammen gehalten. Zeigst du auch nur einmal Schwäche, wird unser Reich unweigerlich zerbrechen.
Das hatte sein Vater ihm immer gepredigt. Und er hatte Recht. Für Mitgefühl war kein Platz. Schon gar nicht mit seinem verstockten Schwager. Er war schließlich selbst Schuld an seiner Situation, also musste er nun auch die Konsequenzen tragen. Warum sollte Charles also Mitleid mit ihm haben?
Er blickte kurz aus der getönten Seitenscheibe seines Wagens und beobachtete, wie seine Supervisoren den sich verzweifelt wehrenden Luke zu einem kleinen Transporter schleiften.
Verdammt. Wenn nur der Junge nicht mit drin hängen würde.
Charles schloss die Augen, und atmete tief durch.
Keine Schwäche, predigte er sich noch einmal. Luke ist nicht mehr mein Neffe, er ist ein Sergia. Kein Individuum mit freiem Willen mehr, sondern Eigentum.
Als er seine Augen wieder öffnete, waren die drei Personen im Transporter verschwunden, nur Albert kauerte schluchzend in der Tür. Dieser Anblick half Charles, sein Mitgefühl für den Jungen zu verdrängen und Hass ergriff wieder Besitz von ihm. Er würde keine Unterschiede zwischen Luke und den anderen Sergia machen, nahm er sich vor. Dies wäre der erste Schritt zur Untergrabung seiner Autorität und das durfte er nicht zulassen.
Keine Schwäche, kein Mitgefühl. Regiere mit eiserner Hand.
Luke lag zitternd im Laderaum des kleinen, weißen Transporters. Die Supervisoren hatten seine Hände und Füße gefesselt, so dass er sich kaum noch rühren konnte. Weil er sich aus Leibeskräften gewehrt hatte, hatten sie ihm mit einem Schlagstock in die Magengrube geschlagen, bis er seine Gegenwehr aufgegeben hatte.
Luke hatte Angst und konnte nicht verstehen, was soeben geschehen war. Er hatte seinen geliebten Onkel kaum wieder erkannt. Er war so kalt gewesen, so unnahbar. Wie konnte er seinem eigenen Neffen nur so etwas antun?
War das etwa sein wahres Ich? Hatte er ihm und seinem Vater jahrelang den freundlichen Onkel Charly nur vorgespielt?
Tränen traten Luke in die Augen und er gab sich schluchzend seinem Kummer hin.
Der Transporter fuhr unterdessen weiter seinem unbekannten Ziel entgegen. Das monotone Rauschen der Räder auf dem Asphalt hatte etwas Beruhigendes. Langsam ließ Lukes Schluchzen nach und sein Atem wurde regelmäßiger.
Was würde nun wohl mit ihm geschehen?
Er hatte seinen Onkel oft gebeten, ihm von seinem Geschäftsimperium zu erzählen, ihm vielleicht sogar einmal eine seiner Farmen zu zeigen, aber Onkel Charly hatte sich stets geweigert, Luke mit dorthin zu nehmen.
So hatte Luke nur eine wage Vorstellung davon, wie es in einem Sergia-Lager wohl aussah.
In der ‚freien Welt‘ wurden die Sergia stets totgeschwiegen.
Es war ein Tabu-Thema, über das man nicht gerne sprach. So gab es auch keine Bilder vom Inneren der Lager und nur sehr lückenhafte Berichte.
Luke wusste nicht, wie lange sie unterwegs gewesen waren, es mochte wohl eine halbe Stunde gewesen sein, als der Transporter stoppte und der Motor erstarb. Er hatte kaum Zeit sich zu sammeln, als auch schon die Türen zum Laderaum aufgerissen wurden. Luke musste die Augen zusammen kneifen, als das grelle Sonnenlicht in sein dunkles Gefängnis fiel und er kauerte sich ängstlich in die hintere Ecke des Wagens.
Einer der beiden Supervisoren kletterte zu ihm, und löste die Fesseln an seinen Füßen.
»Aufstehen«, blaffte er Luke u an, und trat ihm gleichzeitig in die Seite.
Luke stöhnte vor Schmerz.
»Ich sagte: aufstehen«, wiederholte der Supervisor.
Bevor er noch einen weiteren Tritt ab bekam, rappelte Luke sich auf, und stieg ungelenk aus dem Transporter. Halb neugierig, halb ängstlich blickte er sich um.
Der Transporter stand in der Mitte eines großen, gepflasterten Hofs, der von hohen Mauern umgeben war. Die glatten Steinmauern waren gut fünf Meter hoch und auf ihrer Spitze war engmaschiger Stacheldraht gespannt. Zusätzlich waren in regelmäßigen Abständen Schilder mit der Aufschrift ‚Achtung Strom‘ angebracht.
Der Hof selbst war vollkommen kahl, es gab keinen einzigen Baum, nicht mal ein Grashalm lugte zwischen den Pflastersteinen hervor. Alles wirkte sehr bedrückend und Luke hatte das Gefühl, klein und schutzlos zu sein.
Hinter ihnen befand sich ein großes eisernes Tor. Luke nahm an, dass der Transporter dadurch in den Hof gefahren war.
Vor ihnen war ein dunkles Betongebäude mit vergitterten Fenstern. Alles wirkte wie ein Hochsicherheitsgefängnis.
In diesem Moment versetzte einer der Supervisoren Luke einen erneuten Stoß in den Rücken und Luke stolperte vorwärts.
»Na los«, knurrte er, »schlaf nicht ein.«
Sie führten, beziehungsweise stießen, Luke quer über den Hof, bis sie schließlich das Gebäude erreicht hatten. Neben der Eingangstür hing ein kleines Metallschild mit der Aufschrift ‚Integrations-Center I – hier nur Chuvai‘.
Der Supervisor zu Lukes Linken trat an eine in der Wand eingelassene Kamera und blickte mit dem rechten Auge direkt in die Linse. Ein roter Laserstrahl tastete seine Iris ab. Nur wenige Sekunden später leuchtete ein grünes Lämpchen auf und die Tür glitt zur Seite. Sie betraten das Gebäude und die Tür schlug geräuschvoll wieder ins Schloss, kaum dass sie alle drei die Schwelle überschritten hatten. Luke zuckte bei dem Knall vor Schreck zusammen.
Sie standen im Erdgeschoss eines großen Gefängnis-Komplexes. Die dunklen Wände waren gesäumt von unzähligen Zellentüren, in der Mitte führte eine Eisentreppe nach oben in das nächste Stockwerk.
Luke war sich sicher, dass auch die oberen Stockwerke nicht anders aussahen. Das einzige Licht fiel durch trübe Oberlichter, fünfzehn Meter über ihnen, in den Komplex.
Trotz der fast sterilen Sauberkeit war die Luft stickig. Sie wirkte verbraucht und es roch nach Schweiß – dem Angstschweiß der Insassen, die hinter den undurchdringlichen Zellentüren auf ihr weiteres Schicksal warteten. Er konnte ihre Angst fast schmecken, sie schien auf ihn einzustürzen und drohte ihn in die Knie zu zwingen. Zitternd stand Luke in dem bedrückenden Korridor, nicht fähig, sich zu bewegen.
Er schloss für einen Augenblick die Augen. Vielleicht war das alles nur ein böser Alptraum. Vielleicht war er wieder zu Hause in seinem Zimmer, wenn er die Augen öffnete. Doch es war kein Alptraum, und Luke wusste es. Zu real waren seine eigene Angst und die Eindrücke, die auf ihn einstürzten.
Wortlos stießen die Supervisoren ihn tiefer in den Raum hinein, an der Treppe vorbei, und in den hinteren Teil des Gebäudes. Hier war die Luft noch stickiger und Luke atmete instinktiv etwas flacher.
Als sie seine Zelle erreicht hatten, stoppten sie erneut. Der Supervisor drückte seinen Daumen auf eine kleine Metallplatte neben der Tür, die sich prompt öffnete, während der andere Lukes Fesseln löste.
Bevor die beiden Männer ihn in die Zelle stießen, erhaschte er noch einen kurzen Blick auf ein kleines Display neben der Zellentür. Dort stand in leicht flackernden Buchstaben: »Luke 74 – Chuvai«.
Noch bevor Luke sich umdrehen konnte, fiel die Tür mit einem lauten Knall hinter ihm ins Schloss. Einen Moment herrschte eine bedrückende Stille, dann hörte er, wie sich die Schritte der Supervisoren langsam entfernten.
Als ihre Schritte endgültig verklungen waren, stieg erneut Panik in Luke auf. Er war alleine und hatte nicht die leiseste Ahnung, was als Nächstes geschehen würde. Er atmete mehrmals tief durch und versuchte, seine Angst in den Griff zu bekommen. Es hatte keinen Sinn jetzt in Panik zu verfallen, sagte er sich selbst. Das Wichtigste war jetzt einen klaren Kopf zu bewahren, wenn er diesen Alptraum heil überstehen wollte.
Nur langsam nahm er seine Umgebung richtig wahr. Er stand in einer kleinen, steril wirkenden Zelle. Gegenüber der Tür war ein vergittertes Fenster, von dem aus er auf den gepflasterten Hof des benachbarten Integrations-Centers blicken konnte. Hätte seine Zelle sich in einem der oberen Stockwerke befunden, hätte er vielleicht über die hohen Mauern sehen können, so aber war der kahle Hof das einzige, was ihm das Fenster zeigte.
Luke wandte sich von dem beklemmenden Ausblick ab und betrachtete seine Zelle genauer. Doch gab es da nicht viel zu sehen. In der Ecke links neben dem Fenster befand sich eine Toilette und an der rechten Wand stand eine Metall-Pritsche mit einer schäbigen Fleecedecke. Das war alles, was sich in dem großen Raum befand.
Luke setzte sich auf das harte Bett, lehnte sich an die Wand und schlang seine Arme um die angezogenen Beine. So zusammen gekauert starrte er an die gegenüberliegende Wand. Dabei versuchte er nicht zu denken. Denn sobald sein Gehirn anfing über seine momentane Situation nachzudenken, stiegen ihm erneut Tränen in die Augen. Aber er wollte nicht schon wieder weinen. Er war schließlich kein kleines Kind mehr, das bei jeder Kleinigkeit los greinte. Er war zwar vielleicht auch noch kein Mann, aber er fühlte sich den Kinderschuhen doch deutlich entwachsen.
Luke musste wohl eingeschlafen sein, denn als plötzlich ein gedämpfter Schrei durch das Fenster zu ihm herein gellte, wäre er fast von der Pritsche gefallen. Alarmiert sprang er auf und blickte durch die Gitterstäbe nach draußen, auf den Hof.
Dort bot sich ihm ein erschreckender Anblick.
In der Mitte des Hofs, etwa 30 Meter von seinem Fenster entfernt, befanden sich drei Männer. Zwei trugen die Uniform der Supervisoren, der dritte Mann krümmte sich, vor Schmerz schreiend, zu ihren Füßen.
Luke konnte die Schreie trotz der Fensterscheibe noch deutlich hören, und ein Schauer lief ihm über den Rücken.
Der Gepeinigte hatte mit beiden Händen einen schmalen Ring um seinen Hals umklammert und zerrte aus Leibeskräften daran. Dabei zuckten seine Arme und Beine unkontrolliert.
Die Schreie auf dem Hof waren inzwischen verstummt und der Gefolterte lag reglos auf dem Boden. Die Supervisoren schienen ihn anzubrüllen, aber Luke konnte nicht verstehen, was sie sagten. Dann traten sie dem Mann zu ihren Füßen in den Bauch und in die Seite, bis dieser sich schließlich halb aufraffte, so dass er auf den Knien vor den Supervisoren kauerte.
Luke wandte erschüttert den Blick von dem Schauspiel ab. Er konnte den Anblick des gequälten Mannes nicht länger ertragen. Sein Magen zog sich schmerzhaft zusammen als er darüber nachdachte, ob er wohl der Nächste war.
Als er nach ein paar Minuten erneut aus dem Fenster blickte, war der Hof wieder leer. Nichts erinnerte mehr an das grausame Schauspiel, das noch vor ein paar Minuten dort stattgefunden hatte.
Luke setzte sich auf seine Pritsche und atmete tief durch.
Seine Hände zitterten noch immer, aber sein Magen beruhigte sich allmählich wieder. Zumindest hatte er nicht mehr das Gefühl, sich jeden Moment übergeben zu müssen.
Charles hatte sich direkt nach seiner Rückkehr in sein Arbeitszimmer begeben und widmete sich den Wochenberichten. Er hatte während der Fahrt seinen Fokus wiedergefunden und hatte sich nun wieder vollkommen unter Kontrolle. Der Gedanke an seinen verstorbenen Vater hatte ihm dabei geholfen. Sein Vater war stets sein Vorbild gewesen. Viele Jahre hatte er das Familienunternehmen, das wiederum sein Vater nach der Weltwirtschaftskrise Anfang des 21. Jahrhunderts aufgebaut hatte, wie ein Captain sicher durch die raue See befehligt. Er hatte nie sein Ziel aus den Augen verloren und niemals Schwäche gezeigt.
Charles schnaubte leise bei dem Gedanken an diese peinliche Entgleisung. Jetzt, wo er wieder er selbst war, musste er fast lächeln.
Warum bloß war er so weich geworden? Er hatte schon einige seiner Bekannten und Freunde in die Sklaverei gehen sehen und bei keinem hatte er auch nur einen Anflug von Mitgefühl empfunden. Warum auch? Alle waren selbst an ihrem Schicksal schuld gewesen und sie alle erwiesen nun einen guten Dienst, indem sie den Reichtum ihrer Master mehrten.
Er legte das Datapad mit den Wochenberichten der Supervisoren zur Seite. Er hatte keine Lust, sich mit den kleineren und größeren Vergehen seiner Sergia zu befassen. Im Prinzip war es auch nicht so wichtig. Schließlich hatten seine Supervisoren sich schon der Probleme angenommen und die betreffenden Delinquenten entsprechend bestraft.
In diesem Punkt hatten seine höherrangigen Mitarbeiter freie Hand. Nach etwa zehn Dienstjahren wurde ein Wachmann in den Rang eines Supervisors erhoben. Nach dieser Zeit hatte er genug Erfahrung um die Sergia selbständig zu führen. Und dieses System funktionierte gut. Es kam nur selten vor, dass einer der Grand-Supervisoren oder gar Charles selbst, ein Urteil abändern mussten.
So überflog Charles meist nur die Wochenberichte, denn es war ja nur eine nachträgliche Information. Und manchmal war das für seine Sergia gar nicht von Nachteil, denn der ein oder andere Supervisor war doch eher milde in der Wahl des Strafmaßes.
Aber solange das Geschäft lief, wollte Charles sie dafür nicht zurechtweisen. Erst wenn gehäuft Ungehorsam auftrat, so dass man annehmen musste, dass die Sergia ihre Führung nicht mehr ernst nahmen, griff Charles ein. Dies war jedoch erst einmal vorgekommen.
Damals hatte sich ein Supervisor mit einer jungen Sergia eingelassen. Charles tolerierte es, wenn seine Supervisoren sich mit den Mädchen ein wenig vergnügten, schließlich waren sie Männer, und irgendwo mussten sie ihre Triebe ausleben. Aber bei diesen Beiden war es anders gewesen. Der Supervisor hatte sich in das Mädchen verliebt, und darüber vollkommen seine Pflichten vergessen. Während sie gemeinsam ihre Flucht planten, lief auf der Farm, die er beaufsichtigen sollte, alles aus dem Ruder.
Die Sergia merkten schnell, dass ihr Aufseher nicht mehr bei der Sache war. Sie schluderten bei der Arbeit, stellten seine Anweisungen in Frage und wurden aufmüpfig.
Verblendet durch die Liebe zu seinem Mädchen, merkte der Supervisor dies allerdings viel zu spät, als dass er noch eine Chance gehabt hätte, die Situation alleine wieder in den Griff zu bekommen.
Als einige Sergia schließlich eine Revolte anzettelten, blieb ihm nichts anderes übrig, als Hilfe anzufordern. Der Aufstand wurde blutig niedergeschlagen und der Supervisor verlor seine Anstellung.
Damals hatte Charles ernsthaft sein System in Frage gestellt, aber der Vorfall war ein Einzelfall geblieben. So überließ er das tägliche Geschäft auch weiterhin seinen Angestellten, und widmete sich selbst mehr administratorischen und repräsentativen Aufgaben.
Während er sich an diesen ärgerlichen Vorfall erinnerte, hatte Charles gedankenverloren auf das Bild seines Vaters gestarrt, das gegenüber an der Wand hing. Hätte er die Anzeichen vielleicht früher bemerkt? Hätte er schon reagiert, bevor es zum Aufstand gekommen wäre?
Hunderte Sergia hatten an diesem Tag ihr Leben verloren, als die Supervisoren die Revolte niederschlugen. So viele gute Arbeiter. Es hatte fast ein Jahr gedauert, bis die Verluste auf der Farm wieder aufgefüllt waren, und noch ein weiteres, bis die Farm endlich wieder einen Gewinn abgeworfen hatte.
Charles griff erneut nach dem Datapad, und nahm sich vor, die Wochenberichte wieder sorgfältiger zu studieren, um einen weiteren Vorfall dieser Art zu verhindern.
Doch noch bevor er die nächste Datei aufgerufen hatte, klingelte sein Mobiltelefon. Charles blickte auf das Display.
Der Name ‚Jones‘ leuchtete auf. Er griff eilig nach dem kleinen, silbernen Gerät und nahm das Gespräch an.
»Ja, Mr. Jones«, sagte er.
»Entschuldigen Sie die Störung, Mr. Dumare«, meldete sich Jones am anderen Ende der Leitung. »Aber Sie baten mich Ihnen Bescheid zu geben, wenn wir soweit sind.«
»Danke Mr. Jones. Ich bin in etwa 15 Minuten da.«
»Ja, Sir«.
Dann legte Charles auf.
Er hatte beschlossen, bei Lukes Integration persönlich anwesend zu sein.
Bereits sein Vater hatte die Erfahrung gemacht, dass es den allgemeinen Betriebsablauf zu sehr störte, wenn man versuchte, neue Sergia direkt einzugliedern. Vor allem bei den in Freiheit geborenen Chuvai war dies fast unmöglich, ohne einen Aufruhr unter den anderen Sergia zu provozieren.
So hatte sein Vater sogenannte Integrations-Center erbauen lassen, in welchen die betriebsfremden Sergia zuerst einmal ‚angepasst‘ wurden.
Vor allem bei den Chuvai war es wichtig, dass sie gefügig gemacht wurden und die Autorität ihres Masters sowie die der Supervisoren, bedingungslos akzeptierten. Je nach Individuum konnte dies Tage, manchmal aber auch Wochen dauern. Aber bis jetzt hatten seine Supervisoren jeden noch so störrischen Neuzugang unterworfen.
Und auch bei Luke würde dies nicht anders sein. Der Junge war in behüteten Verhältnissen aufgewachsen und hatte nie gelernt zu kämpfen. Es war davon auszugehen, dass er sich unter dem Druck recht schnell beugen würde.
Als er sein Büro verließ, griff Charles nach seinem Mantel, der an einem Haken direkt neben der Tür hing. Er ging in die Tiefgarage unter seinem Haus, stieg in seinen Wagen und fuhr in Richtung Integrations-Center.
Charles wollte bei Lukes Einweisung nicht etwa dabei sein, um den Jungen vor allzu harten Maßnahmen der Supervisoren zu schützen. Vielmehr wollte er sich selbst auf die Probe stellen, ob er sich tatsächlich wieder so unter Kontrolle hatte, wie er es annahm. Der Aussetzer von heute Morgen ließ ihm einfach keine Ruhe und er hatte beschlossen, sich selbst zu beweisen, dass Luke für ihn genauso ein Sergia war wie all die Anderen.
Das Integrations-Center war nur wenige Kilometer von Charles Wohnhaus entfernt, und so dauerte es nur wenige Minuten, bis er den Parkplatz erreicht hatte. Er stellte seinen Wagen ab und ging zum Eingang. Er nickte den Wachen, die das große Eisentor bewachten, kurz zu und sie ließen ihn ein.
Der Hof war noch leer, aber Charles musste nicht lange warten.
Kaum hatte sich das Tor hinter ihm wieder geschlossen, öffnete sich die Tür des gegenüberliegenden Gebäudes.
Heraus traten vier Personen: zwei Wachleute, der Supervisor Robert Jones, mit dem er zuvor telefoniert hatte, und Luke.
Luke wurde von den beiden Wachen flankiert, Jones folgte ihnen in kurzem Abstand. Der Junge wirkte zwischen den beiden kräftigen Männern klein, und eher wie ein Kind, als wie ein junger Mann.
Einen kurzen Moment fürchtete Charles, dass er Mitgefühl mit Luke haben könnte, aber als er seine Gefühle prüfte war da nur die Wut, die er heute Morgen schon empfunden hatte.
Gut, so und nicht anders sollte es sein.
Als Luke seinen Onkel erkannte, rannte er los.
»Onkel Charly«, rief er.
Doch noch bevor er seinen Onkel erreicht hatte, hatten die Wachen ihn eingeholt und zu Boden gestreckt. Einer der Beiden packte Lukes rechten Arm und drehte ihn auf den Rücken, so dass der Junge vor Schmerz aufstöhnte.
»Onkel Charly, bitte«, keuchte er.
Charles trat langsam an seinen Neffen heran und blickte auf ihn herab.
»Für jedes ‚Onkel Charly‘ erhält er drei Hiebe mit der Peitsche«, sagte er kalt. »Das wären bis jetzt sechs.«
»Onkel Charly, BITTE«, keuchte Luke erneut und blickte seinen Onkel flehend an.
»Neun«, sagte Charles.
In der Zwischenzeit war Jones um Luke und die beiden Wachen herum gegangen, und baute sich nun vor dem Jungen auf.
»Stellt ihn auf«, befahl er den beiden Männern.
Augenblicklich zerrten sie Luke auf die Füße, aber ihren Griff lockerten sie nicht.
»Ab dem heutigen Tag wirst du den Namen ‚Luke 74‘ tragen. 74, weil du der vierundsiebzigste Sergia mit dem Namen Luke bist, der sich im Besitz deines Masters befindet. Du wirst deinen neuen Herrn ausschließlich mit ‚Master‘ anreden«, fuhr Jones fort. »Du wirst in seiner Gegenwart stets den Blick gesenkt halten. Nur wenn dein Master es dir gestattet darfst du ihn anblicken.«
Wie um diese Worte noch zu verdeutlichen versetzte eine der Wachen Luke einen harten Schlag gegen den Hinterkopf, so dass sein Kopf nach vorne sackte.
»Wenn du deinem Master entgegen trittst zeigst du ihm deine Demut, indem du vor ihm auf die Knie gehst.«
Luke war nicht darauf gefasst und stöhnte erneut, als der andere Wachmann ihm kurz hintereinander zuerst einen harten Schlag in den Magen und dann in die Kniekehlen versetzte. Gleichzeitig entließ der erste ihn endlich aus seinem Klammergriff. Luke krümmte sich vor Schmerz und hielt sich den Magen, beim zweiten Schlag fiel er hart auf die Knie.
»Onkel Char…«, stöhnte Luke, der Rest des Namens blieb ihm im Halse stecken, denn der Wachmann zu seiner Linken hatte ihm in den Magen getreten, so dass ihm die Luft weg blieb.
»Zwölf«, sagte Charles und blickte weiterhin auf seinen ehemaligen Neffen und zukünftigen Sergia herab, ohne eine Miene zu verziehen.
Während Luke noch immer stöhnend auf dem Boden kauerte, packte ihn der andere Wachmann an den Haaren und riss seinen Kopf so nach vorne, dass sein Kinn auf die Brust schlug. Fast im gleichen Moment spürte Luke einen schmerzhaften Stich im Nacken und schrie kurz auf.
»Dies ist ein GPS-Sender mit integriertem Personalisierungs-Chip. Der Chip wird sich in den nächsten Minuten mit deinem Rückenmark verbinden, eine Entfernung ist danach unmöglich. Mit einem Lesegerät ist es nun immer möglich, dich zu identifizieren. Außerdem wird der GPS-Sender aktiv, sobald du dich der Gebietsgrenze deines Masters näherst. Ein Fluchtversuch ist also sinnlos.«
Der erste Wachmann hielt Luke noch immer an den Haaren fest, während der andere ihm einen etwa zwei Zentimeter breiten, eng anliegenden Reif um den Hals legte. Es zischte kurz, der Reif wurde einen Moment fast unerträglich heiß, dann waren die beiden Enden miteinander verschmolzen.
Nun endlich entließ der Wachmann Luke aus seinem Griff.
»Dies ist ein Elektroschock-Halsband. Solltest du ungehorsam sein, ist dies eine weitere Möglichkeit deines Masters, dich zu maßregeln. Damit du seine Wirkung zukünftig richtig einschätzen kannst, werde ich es dir demonstrieren.«
Jones streckte die Hand aus, und deutete mit einer kleinen Fernbedienung auf Luke.
»Ich weiß, wie es wirkt«, keuchte Luke.
Der Wachmann zu seiner Linken trat ihm erneut in den Magen. Luke stöhnte und krümmte sich vor Schmerz zusammen.
»Ich weiß, wie es wirkt, SIR«, korrigierte Jones ihn scharf.
Er ließ Luke jedoch keine Chance seinen Fehler zu berichtigen. Stattdessen drückte er den kleinen Knopf in seiner Hand.
Fast augenblicklich fuhr ein heftiger Stromstoß durch Lukes Körper. Luke schrie vor Schmerz laut auf und griff mit beiden Händen panisch an den Ring um seinen Hals. Dies war jedoch ein Fehler. Sobald er ihn berührte, fuhr ein erneuter Stromstoß durch seinen Körper. Luke schrie erneut vor Schmerz. Nur unter höchster Selbstbeherrschung schaffte er es, seine Hände von dem Ring zu nehmen. Sofort hörte der Strom auf zu fließen.
»Versuchst du das Halsband zu entfernen, bestrafst du dich selbst«, fuhr Jones ungerührt fort.
Luke lag keuchend am Boden und rang nach Luft. Es dauerte einen langen Moment, bis der Schmerz seinen Körper endlich wieder verlassen hatte.
»Ich hoffe, du hast unsere Regeln soweit verstanden?«, fragte Jones als er sicher war, dass Luke wieder aufnahmefähig war.
Luke rührte sich nicht. Einer der Männer versetzte ihm einen harten Schlag gegen den Hinterkopf.
»Wenn man dir eine Frage stellt, wirst du sie beantworten. Ich hoffe, du hast unsere Regeln verstanden?«, sagte Jones.
»Ja«, keuchte Luke.
»Ja, SIR«, korrigierte Jones ihn sofort, während der Wachmann zu Lukes Linken ihm einen erneuten Schlag versetzte.
»Ja, Sir«, presste Luke hervor.
»Sehr schön. Ich denke, das ist genug für heute«, sagte Jones zufrieden.
»Haben Sie nicht noch etwas vergessen, Mr. Jones?«, schaltete Charles sich ein.
Jones blickte ihn fragend an.
»Sir?«
»Wenn ich richtig gezählt habe, stehen noch 12 Hiebe aus.«
»Oh ja, Sir. Wie konnte ich das nur vergessen«, antwortete Jones und gab seinen Wachen ein kurzes Zeichen.
Die beiden Männer zogen Luke auf die Füße und zerrten ihn zu der Mauer, die zu ihrer Linken war. Dort rissen sie ihm das Shirt vom Leib, so dass sein Oberkörper nackt war. Mit letzter Kraft riss Luke sich halb von ihnen los, drehte sich um, und starrte seinen Onkel verzweifelt an.
»Warum tust du mir das an, Onkel Charly?«, fragte er.
Seine Stimme zitterte und er kämpfte mit den Tränen.
»Fünfzehn«, sagte Charles kalt.
Luke rann eine Träne über die Wange.
Die beiden Wachen packten ihn erneut und stießen ihn hart gegen die Mauer. Etwa eine Armlänge über ihren Köpfen waren, im Abstand von etwa einem Meter, zwei Ketten mit Handschellen in die Wand eingelassen. Sie ketteten Luke an die Wand, so dass er mit über dem Kopf ausgebreiteten Armen und dem Gesicht zur Mauer, vor ihnen stand.
»Bitte, Mr. Jones«, sagte Charles, und deutete mit ausgestreckter Hand auf Lukes entblößten Rücken.
Jones nickte und löste die aufgerollte Peitsche von seinem Gürtel.
»Laut mitzählen, Junge«, sagte er.
Dann holte er aus und ließ die Peitsche mit einem Knall auf Luke herab sausen. Luke schrie vor Schmerz laut auf, als das Leder seinen blanken Rücken traf.
»Mitzählen, habe ich gesagt«, blaffte Jones.
»Eins«, keuchte Luke.
Kaum hatte er das gesagt, traf ihn auch schon der nächste Peitschenhieb. Luke biss die Zähne zusammen, konnte aber den Schmerzensschrei nicht unterdrücken.
»Zwei«, keuchte er.
Und wieder sauste die Peitsche auf ihn herab.
»DREI«, schrie Luke vor Schmerz laut auf.
Luke schrie eine Zahl nach der anderen wie im Wahn für jedes Mal, das die Peitsche auf seinen Rücken knallte.
Als er schließlich seinen letzten Hieb erhalten hatte, lösten die Wachen seine Fesseln und Luke sackte benommen auf den Boden.
»Bringt ihn in seine Zelle und legt ihn auf die Pritsche«, wies Jones sie an.
Die Wachen gehorchten und schleppten Luke zurück ins Gebäude. Als sie außer Sicht waren, wandte Jones sich an Charles.
»Sir, meinen Sie nicht, das war ein bisschen viel für’s erste Mal?«
»Mir ist nicht entgangen, Mr. Jones, dass Sie die Peitschenhiebe nicht versehentlich vergessen haben«, antwortete Charles scharf.
Jones schwieg einen Moment und senkte betreten den Blick.
»Nein, Sir.«
»Zumindest lügen Sie mich nicht an«, sagte Charles nun etwas milder.
»Niemals, Sir«, antwortete Jones sofort.
»Aber Sie sind doch mit mir einer Meinung, dass wir Strafen, die wir ankündigen, auch vollstrecken müssen, Mr. Jones.
Ansonsten werden wir unglaubwürdig.«
Jones nickte.
»Der Junge soll schnell lernen, wie es hier zugeht. Und er soll noch schneller kapieren, dass es keine Familienbande mehr gibt. Dass ein familiäres Verhältnis zwischen uns bestanden hat, muss innerhalb dieser Mauern bleiben, Mr. Jones. Bitte sorgen Sie auch dafür, dass Ihre Wachleute entsprechend instruiert werden.«
»Natürlich, Sir«, antwortete Jones.
Luke lag auf dem Bauch und versuchte, sich nicht zu bewegen. Sein ganzer Körper schmerzte und sein Rücken brannte wie Feuer. An ein paar Stellen war die Haut von den Schlägen aufgeplatzt und Blut tropfte auf die Matratze.
Aber noch schlimmer als der körperliche Schmerz waren seine seelischen Qualen. Das Gesicht seines Onkels ging ihm nicht mehr aus dem Kopf. Das Gesicht, das ihn so kalt und erbarmungslos angestarrt hatte.
Luke verstand noch immer nicht, welche Veränderung in dem Mann, den er so liebte, vorgegangen war. Luke schloss die Augen und versuchte zu schlafen, aber er war einfach zu aufgewühlt, um Ruhe zu finden.
Er drehte den Kopf in Richtung Fenster und stöhnte sofort leise auf. Sogar diese Bewegung schmerzte. Außerdem brannte sein Nacken, wo man ihm den Sender unter die Haut gespritzt hatte, und der enge Reif um seinen Hals reizte die Stelle noch zusätzlich.
Luke hob vorsichtig den Arm und berührte den Reif behutsam. Er war nur ein paar Millimeter dick und bestand aus glattem Metall. Die Kanten waren abgerundet, so dass sie nicht all zu schmerzhaft in sein Fleisch schneiden konnten, aber durch die Enge spürte Luke ständig einen leichten Druck auf seinem Adamsapfel. Dies war ein unangenehmes Gefühl und er befürchtete, dass er eine ganze Weile brauchen würde, um sich daran zu gewöhnen.
Er folgte mit den Fingern dem Verlauf des Reifs und suchte die Stelle, an der er zusammen geschmolzen war, fand sie jedoch nicht. Die beiden Enden hatten sich nahtlos miteinander verbunden, es gab keine Kante, nichts, das darauf hingedeutet hätte, dass sich der Reif jemals wieder öffnen ließ.
Würde er ihn jetzt tragen, bis er eines Tages starb?
Durch das Fenster schien das rötliche Licht der untergehenden Sonne. Das warme Licht hatte etwas Tröstliches und Luke konnte nur mit Mühe die Tränen zurückhalten. Warum war dies alles geschehen? Wie würde sein weiteres Schicksal wohl aussehen?
Luke beobachtete, wie die Schatten der Gitterstäbe immer länger und länger wurden. Als sie fast die Tür erreicht hatten, öffnete diese sich plötzlich. Luke drehte sich blitzartig um und erkannte den Supervisor Jones. Ängstlich kroch Luke in die hinterste Ecke.
»Bitte nicht«, flüsterte er mit rauer Stimme.
»Hat die Lektion von vorhin so wenig Eindruck hinterlassen?«, fragte Jones barsch.
»Sir«, flüsterte Luke noch leiser.
Jones schien zufrieden.
»Na also. Ich bin nicht gekommen, um dir die nächste Lektion zu erteilen. Leg dich wieder hin und zeig mir deinen Rücken.«
Seine Stimme klang plötzlich nicht mehr so kalt wie zuvor.
Luke zögerte einen Moment, gehorchte dann aber. Was blieb ihm auch anderes übrig?
Jones schloss die Tür hinter sich und trat an Lukes Pritsche.
Er seufzte leise, als er den geschundenen Rücken des Jungen näher betrachtete. Dann zog er eine kleine Flasche mit Desinfektionsmittel aus der Tasche und betupfte die Wunden vorsichtig. Luke zischte leise, als Jones die offenen Stellen berührte.
»Ja, das brennt ein bisschen. Aber das geht gleich vorbei.
Dafür wird sich nichts entzünden.«
Jones Stimme klang nun fast freundlich und erinnerte kaum noch an den Mann, der Luke vor nicht einmal einer Stunde so gefoltert hatte. Schweigend verarztete er eine Wunde nach der anderen, während Luke immer wieder zusammenzuckte.
»So, das war’s«, sagte Jones als er fertig war. »Versuch’ heute Nacht auf dem Bauch zu schlafen, damit die Wunden heilen können.«
»Ja, Sir«, antwortete Luke gehorsam.
Jones nickte zufrieden und ging in Richtig Zellentür. Kurz bevor er sie erreicht hatte, hielt er jedoch inne. Einen Moment stand er reglos da. Er schien zu überlegen, führte einen inneren Kampf mit sich selbst.
Schließlich drehte er sich wieder um und ging zurück zu Lukes Pritsche. Vor Luke blieb er stehen und verschränkte die Hände auf dem Rücken. Er blickte in Richtig Decke und atmete tief durch. Dann sah er Luke direkt an.
»Ich gebe dir einen guten Rat, Junge. Tu was man dir sagt und vergiss, dass er dein Onkel ist. Du bist doch nicht dumm, Kleiner, und du bist auch keiner von diesen aufsässigen Rebellen, die meinen, sie könnten etwas mit ihrer Halsstarrigkeit erreichen. Dieses Center haben schon Sergia verlassen, denen die Haut in Fetzen herunter hing. Und es hat ihnen nichts gebracht – auch sie haben schließlich aufgegeben.«
Luke blickte den Supervisor stumm an. Er fühlte sich elend.
Er hatte an einem einzigen Tag nicht nur seinen Vater, sondern auch noch seinen geliebten Onkel verloren.
»Füge dich in dein Schicksal, erweise ihm und den Supervisoren den gebührenden Respekt, und dein Leben wird gar nicht mal so schrecklich sein«, unterbrach Jones Lukes trübe Gedanken.
»Aber warum tut er das … Sir?«, fragte Luke vorsichtig.
»Warum?«, wiederholte Jones fast belustigt. »Das liegt doch auf der Hand. Er ist ein Master. Du bist ein Sergia.«
»Aber …«
»Kein Aber, Junge. So funktioniert dieses System nun mal.
Mr. Dumare ist der Inhaber eines riesigen Geschäftsimperiums. Barmherzigkeit ist da nicht vorgesehen.«
Er machte eine kurze Pause.
»Er hat dich geliebt, Luke. Bringe ihn nicht dazu, dass er dich hasst.«
»Aber er hasst mich«, entgegnete Luke verzweifelt.
»Nein, das glaube ich nicht. Ich denke er weiß noch nicht, was er empfinden soll.«
Jones betrachtete Luke noch einen kurzen Moment, dann drehte er sich um und ging erneut zur Tür.
»Danke, Sir«, sagte Luke leise.
Jones antwortete nicht. Er öffnete die Tür, und verließ den Raum. Bevor er sie hinter sich schloss, drehte er sich noch einmal kurz um.
»Morgen werden wir sehen, ob du die Lektion verstanden hast, Sergia«, sagte er barsch.
Dann fiel die Tür mit einem lauten Knall ins Schloss und Luke war mit seinem Kummer wieder alleine.
Luke schlief in dieser Nacht sehr schlecht. Zu viele Dinge gingen ihm durch den Kopf, zu viel war in den letzten Stunden geschehen. Er dachte an seinen Vater, der nun alleine in ihrem kleinen Häuschen saß und sich sicherlich große Sorgen um ihn machte. Er dachte daran, dass er ihn vielleicht niemals wiedersehen würde und bei diesem Gedanken wurde ihm noch schwerer ums Herz.
Und nicht zuletzt dachte er daran, wie wohl sein weiteres Schicksal aussehen würde. Ihm graute bereits vor dem nächsten Tag, an dem die nächsten Demütigungen und Schläge auf ihn warteten. War das nun sein Leben? Erniedrigung und Gewalt?
Trotz der vielen Sorgen, der Zukunftsangst und des Kummers musste Luke wohl doch eingeschlafen sein, denn als er erwachte, war es in seiner Zelle bereits taghell. Luke erhob sich und stellte erleichtert fest, dass ein Großteil seiner Schmerzen abgeklungen waren. Nur die Wunden auf seinem Rücken spannten unangenehm.
Gerne hätte er sich die Zähne geputzt, denn er hatte ein unangenehmes, pelziges Gefühl im Mund. Aber es gab in seiner Zelle nicht einmal ein Waschbecken, geschweige denn irgendwelche Hygiene-Artikel.
Er setzte sich auf den Rand seiner Pritsche und wartete.
Wartete, dass irgendetwas passierte. Mehr konnte er nicht tun.
Dabei versuchte er an nichts zu denken, doch die Angst, die ihn schon die ganze Nacht begleitet hatte, ließ sich nicht so einfach abschütteln.
Luke hatte noch nicht lange so dagesessen, als seine Zellentür sich öffnete und ein Wachmann ihm ein Tablett entgegen hielt. Luke erhob sich und nahm das Tablett in Empfang.
»Na?«, sagte der Wachmann fordernd.
»Danke, Sir«, sagte Luke mit trockener Stimme.
Erst jetzt, als er sprach, merkte er, wie ausgetrocknet sein Hals war. Seit gestern Mittag hatte er nichts mehr getrunken und seine Kehle brannte vor Durst. Luke betrachtete den Inhalt des Tabletts und rümpfte angewidert die Nase. Neben dem Becher mit Wasser stand eine Schale mit einer undefinierbaren, schleimigen Masse.
»Wenn du schlau bist, isst du das auf«, brummte der Wachmann, dem Lukes Reaktion nicht entgangen war. »Du wärst nicht der Erste, dem wir das Zeug in den Rachen stopfen.«
Bei diesen Worten grinste er, als könne er dies gar nicht erwarten. Erneut stieg Panik in Luke auf, denn er zweifelte nicht daran, dass der Mann es ernst meinte.
»Ja, Sir«, antwortete er schnell, um dem Wachmann keinen Grund zu geben, sein Versprechen wahr zu machen.
Dann ging er zurück zu seiner Pritsche und stellte das Tablett ab. Der Wachmann schlug die Tür hinter sich zu und Luke war wieder alleine.
Gierig leerte er den Becher, dann musterte er die Schale mit ihrem undefinierbaren Inhalt. Sein Magen knurrte, trotzdem kostete es ihn einiges an Überwindung, den Zeigefinger in die Schüssel zu stecken, um etwas von der Masse zu probieren.
Der Brei fühlte sich tatsächlich noch schleimiger an, als er aussah. Luke unterdrückte ein Würgen. Langsam führte er seinen Finger zum Mund und probierte etwas davon. Angeekelt verzog er das Gesicht und spuckte den Brei sofort wieder aus. Wie konnte man so etwas nur Essen nennen.
Kurzerhand ging er mit der Schale zur Toilette und ließ den Inhalt mit einem ekelerregenden ‚gulp‘ ins Wasser gleiten.
Dann setzte er sich wieder auf seine Pritsche und wartete.
Dabei versuchte er, seinen knurrenden Magen zu ignorieren.
Es musste wohl später Vormittag sein, Luke wusste es nicht genau, da er keine Uhr hatte, als die beiden Wachleute von gestern seine Zelle öffneten.
»Mitkommen«, blaffte einer der Beiden ihn an.
Gehorsam erhob Luke sich und ging mit den beiden Männern nach draußen auf den kahlen Hof. Dort wartete bereits Jones, der ihn mit versteinerter Miene fixierte. Neben ihm stand sein Onkel. Luke verspürte einen schmerzhaften Stich, als er das Gesicht seines Onkels sah. Seine Augen betrachteten Luke, als wäre er ein Fremder, und Lukes letzte Hoffnung starb, dass Onkel Charly seine Meinung vielleicht geändert hatte.
Auf dem Weg zu ihnen atmete Luke tief durch. Er würde gehorsam sein. Seinen Willen hatten sie deswegen noch lange nicht gebrochen, aber ihm war klar, dass seine neuen Herren mit ihren Peitschen, Knüppeln und Elektroschocks Argumente hatten, denen man sich fügen musste. Vielleicht würde er diesen Tag dann ohne weitere Schmerzen überstehen.
Ein paar Meter bevor sie die beiden Wartenden erreicht hatten, zog einer der Wachen seinen Schlagstock aus dem Gürtel und hielt ihn ausgestreckt vor Lukes Brust, als Zeichen, stehen zu bleiben. Luke gehorchte.
Einen Moment stand er reglos da. Er wusste, was jetzt von ihm erwartet wurde. Es kostete ihn unglaubliche Überwindung, doch dann senkte er den Kopf und sank vor den beiden Männern auf die Knie. Seine Hände waren schweißnass. Er spürte den bohrenden Blick der beiden Männer und musste sich zwingen, nicht nach oben zu blicken.
Charles hob überrascht eine Augenbraue. Diese schnelle Unterwerfung hatte er nicht erwartet.
»Mr. Jones.«
»Ja, Sir?«
»Haben Sie ihm gestern Abend ohne mein Wissen noch eine zweite Lektion erteilt?«, fragte er.
»Eine Lektion, Sir? Nein, ganz sicher nicht. Sie hatten schließlich ausdrücklich angeordnet, dass Sie dabei sein wollten.«
»So ist es.«
»Luke 74«, sagte Charles nun an seinen Neffen gewandt.
Luke zuckte bei dieser Anrede zusammen, blieb aber in seiner knienden Position, den Kopf weiterhin demütig gesenkt, so wie man es ihm beigebracht hatte.
»Wie ich sehe, hast du dich dazu entschlossen gehorsam zu sein.«
»Ja, Master«, antwortete Luke.
Seine Stimme zitterte.
»Gute Arbeit, Mr. Jones«, sagte Charles nun wieder an seinen Supervisor gewandt. Luke beachtete er nicht mehr. »Sie haben ein außerordentliches Geschick mit den Sergia umzugehen«, fuhr Charles fort.
»Danke, Sir.«
»Aus diesem Grund würde ich mich freuen, wenn ich Ihre Dienste zukünftig auf meinem Anwesen in Anspruch nehmen könnte. Diese grobschlächtige Arbeit im Integrations-Center kann wahrlich auch ein weniger qualifizierter Supervisor übernehmen.«
»Ich fühle mich geehrt, Sir«, antwortete Jones überrascht.
»Bitte sorgen Sie dafür, dass Luke 74 auf die Double Oaks Ranch überstellt wird. Dort soll seine Arbeitkraft zukünftig eingesetzt werden.«
»Ja, Sir, ich werde mich persönlich darum kümmern.«
Charles nickte, dann drehte er sich um und verließ den Hof.
Als das Tor sich wieder hinter ihm geschlossen hatte, wandte Jones sich an seine Wachen.
»Danke meine Herren, ich brauche Sie nicht mehr. Ich bringe diesen Sergia selbst zum Transporter.«
Die beiden Männer nickten und verschwanden im Gebäude.
»Steh auf«, sagte Jones, als sie endlich alleine auf dem Hof waren.
Luke erhob sich augenblicklich.
»Wie ich sehe, hast du dir meine Worte zu Herzen genommen.«
»Ja, Sir«, antwortete Luke.
Seine Stimme war ihm völlig fremd. Sie klang hohl, genauso hohl, wie er sich selbst fühlte.
Beide schwiegen einen Moment, dann nahm Luke sich ein Herz. Was hatte er schon zu verlieren.
»Sir?«, fragte er vorsichtig.
Jones blickte Luke erwartungsvoll an.
»Sir, weiß mein … er nicht, dass Sie gestern Abend noch mal bei mir waren?«
»Doch, er weiß es«, antwortete Jones.
»Aber wenn er es nicht wollte?«
»Wenn es nicht in seinem Sinne gewesen wäre, hätte er mich bereits strafversetzt oder entlassen«, sagte Jones etwas barscher, als er eigentlich wollte.
Luke zuckte bei der schroffen Antwort des Supervisors zusammen. War er vielleicht zu weit gegangen? Würde Jones ihn für seine vorlaute Frage jetzt zurechtweisen? Ihn gar schlagen?
Doch nichts dergleichen geschah. Wortlos bedeutete Jones ihm, sich in Bewegung zu setzen und Luke gehorchte, erleichtert, dass Jones ganz offensichtlich von einer Strafe absah.
Schweigend gingen sie nebeneinander her.
»Sir, darf ich noch eine Frage stellen?«, nahm Luke nach einigen Minuten erneut all seinen Mut zusammen.
»Hast du das nicht bereits getan?«, konterte Jones brüsk, aber der Anflug eines Lächelns umspielte seine Lippen.
»Was ist Double Oaks?”
»Double Oaks ist eine kleine Ranch, etwa 200 Kilometer von hier. Dort wird hauptsächlich Mais und Weizen angebaut. Der Supervisor Edward Barnes ist in Ordnung. Solange du dich an seine Regeln hältst, wird es dir nicht schlecht ergehen. Jetzt komm mit, der Transporter wartet.«
Luke saß im hinteren Teil eines alten VW-Busses, und beobachtete durch die Seitenscheibe die eintönige Landschaft, die an ihm vorbei flog. Es handelte sich hauptsächlich um weitläufige Felder, die nur selten von kleineren Ansiedlungen unterbrochen wurden.
Ohio wurde nicht umsonst die Kornkammer der Vereinigten Staaten genannt, und nun verstand Luke auch warum. Nach dem großen Börsenkrach vor etwa 80 Jahren, hatten sich hier die ersten, großen Landwirtschaftsbetriebe niedergelassen und so wurde das Landschaftsbild heute hauptsächlich von Mais- und Getreidefeldern geprägt.
Lukes Hände und Füße waren mit Handschellen gefesselt und wie zur Warnung, nicht auf dumme Gedanken zu kommen, kribbelte sein Halsband unangenehm.
Seit ihrer Abfahrt vom Integrations-Center verspürte er ein flaues Gefühl im Magen, das sich mit jedem Kilometer, den sie ihrem Ziel näher kamen, noch verstärkte.
Obwohl Supervisor Jones ihm versichert hatte, dass der Leiter der Double-Oaks Ranch ein fairer Mann war, fühlte Luke sich elend. Was konnte für einen Mann wie Jones schon ‚fair‘ bedeuten, der so selbstverständlich von seiner Peitsche Gebrauch machte?
Oder durfte Luke tatsächlich darauf hoffen, in die Obhut eines gnädigen Herrn übergeben zu werden?
Als sie nach einer zweieinhalbstündigen Fahrt durch einen schäbigen Torbogen fuhren, steigerte sich Lukes Nervosität ins Unermessliche.
Sie ließen den hohen Elektrozaun, der das gesamte Farmgelände umgab, hinter sich, und folgten einer holprigen Schotterstraße. Nach ein paar Minuten konnte Luke am Horizont einige Gebäude erkennen. Das musste wohl die Farm sein.
Als die Gebäude näher kamen, rümpfte Luke angewidert die Nase. Alles wirkte sehr heruntergekommen, fast baufällig.
Der Putz bröckelte an einigen Stellen bereits von den Wänden, das Holz hatte einen neuen Anstrich bitter nötig und überall lag Unrat, der vor sich hin rostete.
Der Wagen hielt neben dem kleineren der beiden Gebäude.
Der Fahrer stieg aus, ging um das Fahrzeug herum und öffnete Lukes Tür. Dann befreite er ihn von seinen Fesseln und bedeutete ihm, auszusteigen. Luke gehorchte.
In diesem Moment kam auch schon ein Mann aus dem Gebäude. Er wirkte gedrungen, hatte einen ausgeprägten Bierbauch und schütteres, dunkelbraunes Haar. Luke nahm an, dass er etwa so alt war, wie sein Vater.
»Guten Tag, Mr. Barnes«, begrüßte der Fahrer den näherkommenden Mann.
»Mr. Pockets, schön Sie mal wieder auf Double Oaks zu sehen«, begrüßte Barnes den Fahrer herzlich.
Doch die Freude über das Wiedersehen schien recht einseitig zu sein. Der Fahrer nickte nur kurz.
»Wie ich sehe, hat man endlich mein Gesuch um neue Arbeitskräfte erhört«, fuhr Barnes fort. »Aber haben Sie nur den Einen für mich?«
Sein Blick wanderte suchend zu dem nun leeren VW Bus.
»Mehr können wir zur Zeit in Medikon-City nicht entbehren«, brummte Pockets.
Barnes verzog das Gesicht.
»Wie soll ich mit so wenigen Leuten meine Quote erfüllen?
Wie stellt Dumare sich das vor?«, fragte er sein Gegenüber.
»Das dürfen Sie mich nicht fragen, Mr. Barnes, ich befolge lediglich meine Anweisungen«, antwortete Pockets.
»Jaja, schon gut«, seufzte Barnes. »Und was haben Sie mir hier mitgebracht?«
Er musterte Luke neugierig.
»Einen Chuvai. Wir haben ihn erst gestern rein bekommen«, antwortete Pockets.
Barnes seufzte enttäuscht.
»Gestern? Und ich dachte, Medikon-City schickt mir endlich mal wieder vernünftige Arbeitskräfte. Wir sind mitten in der Weizenernte und mir fehlen die Leute an allen Ecken und Enden.«
»Dann sollten Ihre Aufseher die Sergia dazu anspornen, härter zu arbeiten«, konterte Pockets.
Barnes verzog erneut das Gesicht.
»Meine Sergia arbeiten hart genug, das können Sie mir glauben.«
Dann zuckte er die Achseln.
»Nun gut, es ist, wie es ist. Haben Sie den Chip mit den Überführungsdaten dabei?«
»Selbstverständlich«, antwortete Pockets.
Ihm war anzumerken, dass Barnes ihm durch und durch unsympathisch war.
»Dann lassen Sie uns in mein Büro gehen, um die Formalitäten zu erledigen«, sagte Barnes, der die Abneigung des Fahrers nicht zu bemerken schien oder sie schlichtweg ignorierte.
»Wollen Sie den Sergia nicht zuerst sichern?«, fragte Pockets und warf einen kurzen Blick auf Luke.
»Ach ja, natürlich, der Sergia«, antwortete Barnes.
Er blickte sich suchend um, bis er gefunden hatte, nach was er Ausschau hielt.
»Ben!«, rief er laut.
Nur einen Augenblick später kam ein älterer Mann angerannt.
Er hatte schulterlanges, weißes Haar, das ihm wirr vom Kopf abstand, und einen dichten, ebenso weißen Bart. Seine Haut war von der Sonne gegerbt und Luke schien es unmöglich zu sagen, wie alt er tatsächlich war.
»Sie haben gerufen, Sir«, sagte er, als er die drei Männer erreicht hatte.
»Ja, Ben. Das hier ist«, er blickte Luke fragend an.
»Luke 74«, antwortete Pockets, bevor Luke auch nur den Mund öffnen konnte, um etwas zu sagen.
»Das hier ist Luke«, fuhr Barnes fort. »Er wird uns ab sofort unterstützen. Bitte zeig ihm die Unterkünfte, geh mit ihm in die Kleiderkammer und dann erkläre ihm die Arbeit.«
»Natürlich, Sir«, antwortete Ben und nickte eifrig.
Pockets starrte Barnes an.
»Halten Sie das für eine gute Idee?«, fragte er.
»Was meinen Sie?«, fragte Barnes und blickte sein Gegenüber irritiert an.
»Ich sagte Ihnen doch, dass der Junge ein Frischling ist. Ich an Ihrer Stelle würde ihn für die nächsten Wochen in Ketten legen um sicher zu gehen, dass er nicht auf dumme Gedanken kommt.«
Luke starrte Pockets mit aufgerissenen Augen an.
Doch Barnes zuckte nur mit den Schultern. Er musterte Luke noch einmal eingehend, dann sagte er: »Ich glaube nicht, dass das nötig sein wird. Der Junge sieht mir sehr verständig aus.«
Dann wandte er sich zum ersten Mal an Luke.
»Glaubst du es ist notwendig, dass wir dir Ketten anlegen?«, fragte er ihn.
Luke starrte den Supervisor überrascht an.
»Nein, Sir«, stammelte er.
Barnes lachte.
»Sehen Sie«, sagte er an Pockets gewandt, »nicht nötig.«
Pockets verzog das Gesicht.
»Können wir uns nun um die Formalitäten kümmern? Ich will heute noch zurück nach Medikon-City.«
Barnes nickte.
»Natürlich. Folgen Sie mir.«
Gemeinsam gingen sie zu dem zweistöckigen Verwaltungsgebäude, aus dem Barnes zuvor gekommen war, und ließen die Sergia alleine.
Luke blickte den beiden Männern nach, bis sie die Tür hinter sich geschlossen hatten.
»Komm«, sagte Ben.
Luke fuhr vor Schreck zusammen. Er hatte Ben völlig vergessen. Ben lächelte.
»Du bist also ein Chuvai?«, fragte Ben neugierig.
Luke nickte stumm.
»Na, gesprächig bist du ja nicht gerade«, sagte Ben grinsend.
»Ich … ich weiß nicht«, antwortete Luke unsicher.
Ben lachte.
»Na, komm erst mal mit. Du wirst dich hier im Handumdrehen einleben. Barnes und die Aufseher sind in Ordnung.
Wenn du dich an ihre Regeln hältst, hast du nichts zu befürchten.«
Luke nickte, und langsam fiel ein Teil seiner Anspannung von ihm ab. Auf Double Oaks schien es offensichtlich deutlich entspannter zuzugehen, als im Integrations-Center.
Ben führte ihn zu dem zweiten, größeren Gebäude.
»Das hier sind die Sergia-Unterkünfte«, erklärte er.
Es handelte sich um einen schmucklosen Betonbau mit vergitterten Fenstern und einer schweren Eisentür. Luke blieb stehen und starrte auf die massiven Gitter.
Ben schien seine Gedanken zu erraten.
»Alles halb so schlimm«, versicherte er ihm. »Wir leben hier zwar nicht gerade im Luxus, aber die Quartiere sind sauber und die Betten bequem.«
Er schob Luke durch die eiserne Tür in das überraschend helle Innere des Gebäudes. Genau wie im Integrations-Center waren die Wände gesäumt von unzähligen Zellentüren, doch die meisten standen offen und es herrschte geschäftiges Treiben.
»Nachts wird die Haupttür abgeschlossen, doch die Zellentüren bleiben immer offen«, erklärte Ben seinem Schützling.
Er führte Luke weiter in das Gebäude hinein, bis zu einer leeren Zelle im ersten Stock. Luke blickte sich neugierig um und musste Ben recht geben.
Die kleine Zelle wirkte sehr sauber. Es gab ein großes Bett, einen Kleiderschrank, sowie in der hinteren Ecke ein kleines Waschbecken.
Luke ging zum Fenster und blickte durch die Gitterstäbe nach draußen. Vor ihm erstreckten sich endlose Weizenfelder. Die goldgelben Ähren wiegten sich sanft im Wind, Vögel zwitscherten und die Bienen summten. Luke schloss für einen Moment die Augen und atmete tief ein. Mit allem hatte er gerechnet, aber nicht mit so einer Idylle. Doch er durfte sich nicht täuschen lassen, immerhin versperrten ihm eiserne Gitter den Weg in dieses vermeintliche Paradies.
»Schön, nicht?«, sagte Ben hinter ihm.
Luke nickte.
»Komm, ich zeige dir den Rest«, sagte Ben und Luke folgte ihm nach draußen.
Zuerst gingen sie in die Kleiderkammer. Dort bekam Luke einen Satz dunkelblauer Overalls, so wie auch die anderen Sergia auf der Farm sie trugen. Danach zeigte Ben ihm die Erntemaschinen. Sie alle wirkten, genau wie der Rest der Farm, schon etwas betagter und Luke fragte sich, ob sie die kommende Ernte wohl noch überstehen würden.
In den nächsten Tagen und Wochen weihte Ben Luke in die Abläufe auf der Farm ein. Es stellte sich heraus, dass vieles, was eigentlich Maschinen hätten erledigen können, in Handarbeit verrichtet wurde, denn Treibstoff war teuer und durfte nur sparsam eingesetzt werden. Die Muskelkraft der Sergia hingegen kostete nur drei Mahlzeiten am Tag. So war die Ernte harte Knochenarbeit.
Doch Luke beschwerte sich nicht. Schon nach kurzer Zeit hatte er sich an den harten Alltag auf der Farm gewöhnt und Supervisor Barnes war sehr zufrieden mit ihm.
Manchmal, wenn er abends im Bett lag, dachte er an seinen Vater, überlegte, wie es ihm wohl ging und ob er ihn ebenso vermisste. Doch meistens war Luke von dem anstrengenden Tag so erschöpft, dass er an gar nichts mehr dachte, sondern sofort einschlief.
So kam zuerst die Weizenernte, und im Anschluss war auch schon der Mais reif. Danach wurden die Felder für die kommende Aussaat vorbereitet und notwendige Reparaturarbeiten wurden erledigt, die über den Sommer liegen geblieben waren.
Bevor Luke es sich versah, war er bereits sechs Monate auf der Farm, ohne dass er überhaupt bemerkt hatte, wie die Zeit vergangen war.