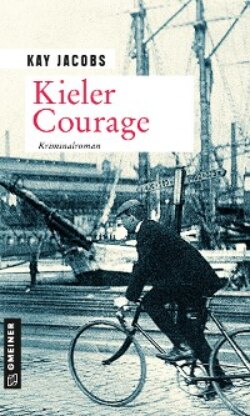Читать книгу Kieler Courage - Kay Jacobs - Страница 8
III
Оглавление»Was heißt ›verschwunden‹?«
»Also … nicht mehr da.«
»Sie veralbern mich gerade.«
»Nein.«
»Sie ist weg?«
»Ja … verschwunden eben.«
Es war Freitagvormittag, der 12. März 1920. Es war nicht etwa Freitag, der 13., auch nicht der 1. April, sondern nur irgendein Freitagvormittag in der Blume. Rosenbaum setzte sich auf den Stuhl an seinem Schreibtisch. Eigentlich sank er eher auf den zufällig hinter ihm stehenden Stuhl und wirkte dabei wie ein Schlachtschiff, das einen schweren Treffer abbekommen hatte, dann sank und auf einer Sandbank aufsetzte, bevor es auseinanderbrach und vollständig unterging. Schon einmal war Rosenbaum in dieser Weise auf seinen Stuhl gesunken, als vor elf Jahren ein Polizeibote verschwunden war. Doch jetzt überbrachte Gerlach keine Information über einen verschwundenen Lebenden, sondern über eine abhandengekommene Tote, eine ganz bestimmte auch noch: Der Leichnam von Katharina von Lettow-Vorbeck war verschwunden.
Gerlach schloss die Tür und setzte sich vor Rosenbaums Schreibtisch. Er war erkennbar aufgebracht gewesen, hatte sich allerdings wieder ein wenig beruhigt.
»Ich habe in der Gerichtsmedizin angerufen, um zu fragen, wann wir den Obduktionsbericht bekommen können. Professor Ziemke sagte, er sei gerade erst in die Klinik gekommen, habe sich vorgenommen, mit der Obduktion zu beginnen, und der Bericht würde gegen Mittag fertig sein. Fünf Minuten später rief er an und sagte, die Leiche sei weg, sein Sektionshelfer habe sie schon am frühen Morgen dem Militär übergeben.«
»Wie? ›Dem Militär übergeben?‹«
»Er sagt, vor der Tür stand plötzlich ein Sanitätswagen des Heeres und die Fahrer hatten eine Übernahmeanordnung der Reichswehr-Brigade 9 dabei. Der Sektionshelfer soll sich noch aufgeregt haben, weil eine Leiche nicht in einen Sanitätswagen gehöre. Aber er fügte sich, als der Fahrer sagte, dass in seinem Wagen schon fast so viele Tote wie Verletzte transportiert worden seien und dass darin auch oft ein Verletzter erst zu einem Toten wurde.«
Rosenbaum schaute in seine Kaffeetasse, die noch vom Vortag halb leer auf seinem Schreibtisch gestanden hatte. Wäre Hedi noch da gewesen, wäre das nicht passiert.
»Ich habe nachgeschaut«, fuhr Gerlach fort. »Die Reichswehr-Brigade 9 des Übergangsheeres ist in Schwerin stationiert. Der Kommandant ist zugleich der Militärgouverneur von Mecklenburg und Holstein: Generalmajor Paul von Lettow-Vorbeck.«
Das ergab Sinn. Der Kommissar klopfte die Taschen seines Sakkos und der Hose nach Zigaretten ab, wurde bei der Brusttasche fündig und steckte sich eine an. Er war zu Massary Delft gewechselt, die gute Massary, edel wie der Name, ein stilvoller Ersatz für die Zigarren, die er früher geraucht hatte, und derzeit das Einzige, was man ohne größere Mühe bekommen konnte. Dann griff er zum Telefonhörer, ließ sich eine Verbindung mit der Reichswehr-Brigade 9 herstellen, und nach einer Minute hatte sich ein temperamentvoller Gedankenaustausch mit dem Adjutanten des Brigadekommandanten entwickelt.
»Sie stellen mich jetzt sofort zu Herrn Lettow-Vorbeck durch!«
»Generalmajor von«, rhetorische Pause, »Lettow-Vorbeck ist nicht zu sprechen.«
»Wenn Sie mich nicht augenblicklich verbinden, lasse ich Herrn Lettow-Vorbeck zur Vernehmung vorführen!«
»Ja, machen Sie das.«
Rosenbaum war kurz davor, Wörter zu benutzen, für die er durchaus belangt werden könnte. Natürlich hatte er nicht die Befugnis, den Militärbefehlshaber von Mecklenburg und Holstein vorführen zu lassen, aber die Chuzpe dieses Vorzimmer-Leutnants brachte ihn aus der Fassung. Um zu vermeiden, was er später bereuen würde, reichte er den Hörer an Gerlach weiter, dessen Bemühungen zwar wesentlich diplomatischer, aber genauso erfolglos waren. Seine Versuche zu erklären, dass die Leiche dringend untersucht werden müsse – das liege doch auch im Interesse des Herrn Generalmajor – und dann so schnell wie möglich zur Bestattung freigegeben werde – Ehrenwort –, halfen nicht weiter als der Hinweis, dass sich die Leiche im Gewahrsam der Strafverfolgungsbehörden befunden habe, als sie bei der Gerichtsmedizin gelegen hatte, und ihr Abtransport einen rechtswidrigen Gewahrsamsbruch darstelle. All das führte nicht weiter als zu der Empfehlung, eine schriftliche Eingabe zu verfassen, man werde sich zu gegebener Zeit damit befassen.
Im Hintergrund tobte der Kommissar und presste Wörter, die er nicht benutzen sollte, durch gefletschte, zusammengebissene Zähne. Gerlach zog es vor, das Telefonat zu beenden.
»Der hängt noch in seinem preußischen Militärstaat fest«, schimpfte Rosenbaum, ohne sich zügeln zu müssen. »Wir sind jetzt Bürger und keine Untertanen mehr, das hätten Sie diesem Betonkopf mal sagen sollen!«
Seine Zigarette war unbeachtet im Aschenbecher runtergebrannt, der halb voll noch vom Vortag auf dem Schreibtisch stand. Das wäre früher auch nicht passiert.
»Ich fahr da jetzt hin und sage dem das – und hol die Leiche zurück.«
»Ne, besser ich fahre, Chef. Sie würden nur eine Schlägerei auslösen.«
Rosenbaum ließ Gerlach fahren, zuerst widerwillig, sich der Einsicht in das Erforderliche fügend, dann war er ganz zufrieden mit dieser Entscheidung. Er besorgte sich eine Tasse Kaffee, schwarz und ohne Zucker, den er sich mühsam aus der Kantine im Souterrain holen musste, seit er mit Hedis Abgang nicht mehr frisch im Vorzimmer gebrüht wurde. Eine neue Packung Zigaretten nahm er gleich mit und wechselte mit dem Kollegen Dumrath am Tresen einige belanglose Worte über das Wetter und dass es jetzt in Deutschland bestimmt bald wieder aufwärtsgehen werde; mit Dumrath konnte man sowieso nur Belanglosigkeiten austauschen. In seinem Vorzimmer schaute er sich die Eingangspost an, ein paar Berichte und Protokolle, neue Akten von der blauen Polizei mit Strafanzeigen, alte Akten von der Staatsanwaltschaft mit Einstellungsverfügungen und Vernehmungsanordnungen, nichts Dringliches. Er schob alles zur Seite, für die kommende Woche war eine neue Sekretärin angekündigt.
Zurück in seinem Büro setzte er sich in den Schreibtischsessel, lehnte sich zurück, nahm einen Schluck Kaffee. An der Wand gegenüber hing eine Schiefertafel. Sie hatte dort vor einiger Zeit ein Porträt des Kaisers abgelöst. Seit Unterzeichnung des Friedensvertrages war Wilhelm II. offiziell ein Kriegsverbrecher, gesiegelt und gestempelt, anerkannt von der Reichsregierung, nach Rosenbaums Überzeugung ein schwerer strategischer Fehler. Seither gab es in deutschen Amtsstuben kein Porträt des Kaisers mehr, sie hingen jetzt nur noch in Wohnzimmern. Rosenbaum hatte den Kaiser freilich schon Jahre zuvor abgehängt. Einige Zeit hing allein die Schiefertafel an der Wand. Dann kam ein Porträt vom Reichspräsidenten Ebert hinzu, aber nur kurz. Jetzt war die Tafel wieder allein, und Ebert stand in der Ecke, mit dem Gesicht zur Wand, er musste sich schämen.
Auf die Tafel hatte Rosenbaum mit weißer Kreide »Katharina« geschrieben und rechts daneben »Mona«. Er stand auf, fügte »PvLV« hinzu und setzte sich wieder.
»Ach, Sie sind da?« Die Stimme von Iago Schulz ertönte im selben Moment, in dem sich die Tür öffnete.
»Ja, natürlich.«
»Hm.«
Wie Rosenbaum war Schulz einer von derzeit sechs Kommissaren der Kieler Blume. Ein Kollege, aber kein Freund. Und er würde auch niemals ein Freund werden. Zu deutlich hatte Schulz von Anfang an klargemacht, dass er Rosenbaum für einen jüdischen Kommunisten, also einen Volksschädling hielt. Und zu eindeutig war es für Rosenbaum, dass er Menschen verachtete, die in solchen Kategorien überhaupt dachten. Schulz hatte sich zur PP, der Politischen Polizei, gemeldet, einer größtenteils geheim agierenden Sondereinheit der Berliner Polizei, deren hiesiger Ableger zunächst nur organisatorisch dem Kieler Polizeipräsidenten, im Übrigen aber Berlin unterstellt war. Nach dem Krieg waren die Kompetenzen der Berliner Polizei beschnitten worden, und seither unterstand die Kieler PP dem Kieler Polizeichef. Doch ob das eine endgültige Regelung war, durfte bezweifelt werden, in diesen Zeiten war kaum etwas endgültig. Der Ruf der PP ließ das Schlimmste vermuten, entsprach aber nach Rosenbaums Überzeugung der Realität, auch wenn niemand es wegen deren Geheimniskrämerei so genau wissen konnte. Für Rosenbaum war klar, dass Schulz mit seiner völkischen Gesinnung und seinem intriganten, miesen Charakter bestens in diese Truppe hineinpasste. Sie waren anfangs erbitterte Feinde gewesen, und doch waren sie Kollegen. Ein wenig hatte sich ihr Verhältnis gebessert, als Schulz Rosenbaum einmal das Leben gerettet hatte. Aber Freunde würden sie nie werden. Und Rosenbaum würde Schulz nie über den Weg trauen. Und dass er ihm das Leben gerettet hatte, war kein Akt des Mitgefühls gewesen, sondern hatte mit Sicherheit einen eigennützigen Beweggrund gehabt. Rosenbaum wusste nur noch nicht, welchen.
Letztmalig waren sie aneinandergeraten, als vor einem halben Jahr Kriminaldirektor Freibier in den Ruhestand gegangen war. Schulz hatte sich als dessen Nachfolger beworben, und Rosenbaum hatte dasselbe getan, allein damit Schulz nicht sein Vorgesetzter werden würde. Natürlich hatte Rosenbaum als SPD-Mitglied hervorragende Aussichten gehabt, während Schulz als bekanntermaßen rechtskonservativer Revanchist – und mutmaßlich Schlimmeres – kaum eine Chance besaß, zum Direktor befördert zu werden. Bekommen hatten sie den Posten am Ende beide nicht. Er war von auswärts besetzt worden. Ihr neuer Chef war jetzt Kriminaldirektor Friedrich Klemp aus Lübeck, natürlich SPD-Mann. Mehr hatte Rosenbaum im Grunde nicht gewollt.
»Ich habe ein Vernehmungsprotokoll für Sie«, sagte er und legte einige sauber in Maschinenschrift getippte Blätter vor ihm auf den Tisch.
»Was für ein Vernehmungsprotokoll?«
»Ein Zeuge hat sich gemeldet. In Ihrem Mordfall. Peter Harald Bäcker heißt der Mann«, erklärte Schulz, während Rosenbaum durch das Protokoll blätterte. »Er hat heute Morgen in der Zeitung von dem Mord gelesen und sich sofort bei uns gemeldet. Er sagt, er habe am Tattag gegen vier Uhr nachmittags ein Fräulein mit einem jungen Mann vor dem Holzsteg am Kleinen Kiel gesehen. Sie hätten gestritten. Der Zeuge habe sich aber nichts weiter dabei gedacht und sei seines Weges gegangen.«
»›Ohrfeige gegeben‹, ›an den Armen gefasst und geschüttelt‹, ›Hurensohn gerufen‹«, zitierte Rosenbaum aus dem Protokoll. »Und dabei hat er sich nichts gedacht?«
»Tja«, kommentierte Schulz.
Das letzte Blatt des Protokolls enthielt eine Phantomzeichnung.
»Was ist denn das?«, fragte Rosenbaum.
Auf der Zeichnung war die rechte Gesichtshälfte eingefallen – es schien, als fehlte der Wangenknochen –, Narben zogen sich vom Auge bis zum Unterkiefer und klebten Hautfetzen aneinander.
»Eine Kriegsverletzung, würde ich sagen«, antwortete Schulz in einem Tonfall, der sagte: Das sieht man doch.
Rosenbaum legte die Blätter auf den Tisch und schaute Schulz mit einem Blick an, der verriet, dass ihm das alles nicht passte. »Wieso haben Sie ihn nicht an mich verwiesen?«
»Sie waren nicht da. Hätte ich den Mann wieder gehen lassen sollen?«
»Natürlich war ich da.« Natürlich war er da, er war nur eine halbe Stunde in der Kantine gewesen. »Ich war nur ein paar Minuten in der Kantine.«
Schulz nickte.
Rosenbaum bedankte sich in einem Tonfall, der keinen Zweifel daran ließ, dass er nicht dankbar war, sondern Schulz auffordern wollte zu gehen.
Die Zeichnung musste in die Zeitungen. Mit der Kriegsverletzung war sie charakteristisch genug, um auf zweckdienliche Hinweise hoffen zu lassen. Rosenbaum setzte sich an die Schreibmaschine im Vorzimmer, eine Adler No. 7, ein Gerät, mit dem er sich nie anfreunden würde. Es gab fünf Tageszeitungen in Kiel, er konnte sich aber auf die drei größten beschränken, die konservativen Kieler Neuesten Nachrichten, die liberale Kieler Zeitung und die linksgerichtete Schleswig-Holsteinische Volkszeitung, mehr als zwei Durchschriften mit Kohlepapier wären sowieso kaum zu entziffern gewesen. Als das Papier eingespannt war und Rosenbaum seine schwarzen Fingerspitzen in seinem Taschentuch wieder einigermaßen sauber bekommen hatte, musste er sich mit den vollkommen sinnlos angeordneten Tasten auseinandersetzen, mit dem Q oben links, dem H in der Mitte und dem M unten rechts. Er wollte es demütig als gegeben hinnehmen und darüber nicht nachdenken, er wollte einen Wutausbruch vermeiden. Schon bei »An die Schriftleitungen der Kieler Neuesten« hat er sich zweimal verschrieben. Beim zweiten Papiersatz kam er etwas weiter, beim dritten beschloss er, bis zu drei Tippfehler hinzunehmen und handschriftlich zu korrigieren, beim vierten Tippfehler beschloss er, vier hinzunehmen. Der Papiervorrat war fast aufgebraucht, als er nach einer Stunde das Anschreiben fertiggestellt hatte, versehen mit etlichen handschriftlichen Korrekturen. Seine Ansprüche waren immer weiter gesunken. Wäre nur Hedi da gewesen.
Er unterzeichnete, übergab die Schreiben in der Wachtmeisterei dem Polizeiboten und zog sich wieder in sein Zimmer zurück, wo er staunend feststellte, dass er eine Stunde nicht geraucht hatte. Dann steckte er sich eine an. Auf seinem Schreibtisch rückte er die Fotografie von Albert, seinem Sohn, zurecht. Aus den letzten Jahren besaß er von ihm nur zwei Porträts. Eines, das ihn als stolzen Notabiturienten zeigte, und eines, auf dem er kurz danach eine Infanterieuniform trug. Das als Abiturient stand auf dem Schreibtisch. Es war ursprünglich koloriert gewesen, Rosenbaum hatte sich aber ein neues Exemplar in schwarz-weiß anfertigen lassen. Das mit der Uniform war in der Schublade verschwunden, neben dem Foto von Alberts Grab.
*
Auch wenn man es kaum glauben mochte, Mecklenburg-Schwerin war ein selbstständiger deutscher Bundesstaat, zuerst Herzogtum, seit einem Jahr Freistaat, doch stets widerstand es wie ein kleines gallisches Dorf wacker fremden Annexionsbestrebungen. Die Schleswig-Holsteiner hätten es nie zugegeben, aber es schwang eine bedeutende Portion Neid mit, wenn sie auf Mecklenburg schauten. Nach dem gewonnenen Deutsch-Dänischen Krieg von 1864 hatten sie auf eine Schleswig-Holsteinische Selbstständigkeit gehofft, waren aber zwei Jahre später von Preußen geschluckt und zu einer bloßen Provinz degradiert worden, während Mecklenburg-Schwerin selbstständig geblieben war.
Und das hatte Auswirkungen, wenn man von Kiel nach Schwerin reisen wollte. Hier herrschte die Preußische Staatsbahn, dort noch immer die Mecklenburgische Landeseisenbahn; die von der neuen Staatsverfassung vorgeschriebene Gründung der Reichsbahn, die alle Landesbahnen in sich vereinigen sollte, war erst für den 1. April vorgesehen. Also gab es noch keine direkte Zugverbindung, nicht einmal aufeinander abgestimmte Fahrpläne. Im Kieler Hauptbahnhof wartete eine Preußische S5 mit modernen Durchgangswaggons, um die Reisenden mit hundert Stundenkilometern zum Grenzbahnhof in Lübeck zu bringen, wo sie – manchmal unabsehbar lange – auf eine Mecklenburgische T4 warten mussten, um in alten Abteilwagen mit fünfzig Stundenkilometern nach einem weiteren Umstieg in Bad Kleinen irgendwann Schwerin zu erreichen.
Und genau diese Strapaze musste Klaus Gerlach jetzt auf sich nehmen. Den längsten Aufenthalt hatte er in Bad Kleinen, wo das Empfangsgebäude unbeheizt und die Bahnhofsgaststätte geschlossen waren. Darüber hinaus hatte der Kiosk keine belegten Brote mehr anzubieten. Der Kriminalassistent wartete auf einer Bank, schaute in kurzen Abständen auf seine Uhr und hatte nicht einmal mehr die Ablenkung einer am Fenster vorbeiziehenden Vorfrühlings-Landschaft. Erst diese Zeit der Muße brachte ihn auf die Frage, wie er eigentlich die Leiche nach Kiel zurückbringen sollte, falls ihm diese mitgegeben werden würde.
Als er endlich Schwerin erreichte, war es bereits dunkel. Gegenüber vom Bahnhof betrat er ein Hotel, wo er sich ein Zimmer nahm und eine Kleinigkeit essen konnte. Dann wurde er vom Portier mit einer Wegbeschreibung ausgestattet und eilte zu Fuß zum Arsenal am Pfaffenteich, in dem die Reichswehr-Brigade 9 Quartier bezogen hatte. Der Portier hatte ihn telefonisch angekündigt, so wurde er bereits erwartet und ohne größere Umstände ins Vorzimmer des Kommandanten geführt. Dort allerdings musste er wieder warten, dieser Raum war allerdings geheizt und der Ausblick auf den Pfaffenteich war idyllisch. Doch gleich würde er dem »Löwen von Afrika« gegenüberstehen, dem Mann, der zu wichtig oder zu beschäftigt war, um mit der Polizei über die Leiche seiner Tochter zu telefonieren. Gerlach würde ihn nicht nur um Rückführung bitten, sondern auch sachdienliche Fragen klären wollen. Ob dieser Generalmajor sich dazu bewegen lassen würde, die Leiche zurückzugeben, war für den Kriminalassistenten kaum abzuschätzen, aber die Chance, an einige aufschlussreiche Informationen zu gelangen, sollte groß sein. Natürlich gehörte es zur Taktik des Kommandeurs, Gerlach warten zu lassen, er sollte nervös werden. Das war ihm bewusst, aber darauf würde er nicht hereinfallen. Im Krieg war er Meldegänger, später Meldeoffizier gewesen, er war den Umgang mit Generälen gewohnt, deren Taktik war ihm bekannt. Aber blümerant wurde ihm trotzdem.
Nach einer halben Stunde ließ man ihn vor. Er betrat ein üppiges, barockes Arbeitszimmer. Schreibtisch, Bücherschrank, eine kleine und eine große Kommode waren aufeinander abgestimmt in Kirsche und Wurzelnuss gefertigt und aufwendig mit matt goldenen und schwarzen Applikationen und verspielten Bronzebeschlägen versehen. In der einen Zimmerecke thronten stolze Regimentsfahnen, in der anderen hing die alte Reichskriegsflagge an einer Fahnenstange und verdeckte die neue schwarz-rot-goldene Nationalflagge. Dazwischen hing ein Porträt von Friedrich Ebert, dem Reichspräsidenten, nicht sehr groß und im Stil der neuen Zeit in einem schlichten, schmalen, fast schäbigen Rahmen. – Ebert war Handwerkersohn, ein solcher Rahmen musste nach überwiegender Ansicht bürgerlicher Kreise für ihn reichen. – Ein heller Streifen in der Holzvertäfelung hinter dem Bild bezeugte, dass bis vor Kurzem noch ein größeres, sicherlich prunkvolleres Porträt des Kaisers oder Bismarcks, vielleicht Hindenburgs hier gehangen haben mag. Darunter saß Generalmajor Paul von Lettow-Vorbeck hinter seinem Schreibtisch in einer Uniform, die nicht wagte, Falten zu werfen. Der Schädel war glatt rasiert, der Bartwuchs zu einem dichten Schnurrbart vereint. Sein Gesicht brachte es fertig, zugleich rundlich zu sein und asketisch zu wirken. Seine strengen Augen verrieten, dass er sich die Einrichtung seines Zimmers nicht ausgesucht hatte und mit einem Schreibtisch aus Sperrholz zufrieden gewesen wäre.
Gerlach stellte sich vor. Lettow-Vorbeck gab seinem Bedauern Ausdruck, dass, wie ihm zu Ohren gekommen sei, Gerlach telefonisch nicht zu ihm habe durchdringen können. Dann bot er ihm den Besucherstuhl vor seinem Schreibtisch an, und der Kriminalassistent kam gleich zur Sache.
»Mord?« Ein verblüffter Ausdruck legte sich über das Gesicht des Generalmajors. Es war, als hätte Gerlach einen Kollegen mit einer gewagten These konfrontiert, als sei vielleicht nicht undenkbar, aber ziemlich weit hergeholt, was gerade erklärt worden war. »Nach meiner Kenntnis ist sie ins Wasser gefallen und ertrunken.«
»Es gibt da ein paar Ungereimtheiten, die die Annahme eines Fremdverschuldens nahelegen.«
»Nämlich?«
Gerlach zögerte kurz. Die Polizei teilte Zeugen ihren Ermittlungsstand normalerweise nicht mit. Doch die Situation war besonders. Also schilderte er schließlich im Detail, was die Polizei von dem Vorfall wusste.
»Haben Sie Ihrer Tochter kürzlich hundert Mark geschickt?«, fragte er.
»Meine Frau vielleicht. Ich kümmere mich um so etwas nicht.«
»Sie oder Ihre Frau sollen Katharina regelmäßig jeden Monat hundert Mark Taschengeld zugeschickt haben.«
»Das ist möglich. Wenn man von einer Regelmäßigkeit überhaupt sprechen kann, immerhin ist sie erst vor ein paar Wochen von zu Hause ausgezogen.«
»Konnte Ihre Tochter schwimmen?«
»Ja, natürlich.«
»Noch eine Ungereimtheit.«
»Und welche Schlüsse ziehen Sie daraus?«
»Zunächst nur, dass die Leiche obduziert werden muss.«
»Etwas Tee?«
»Wie bitte?«, fragte Gerlach nach, obwohl er verstanden hatte, dass ihm Tee angeboten wurde. Er war nicht schwerhörig, und Lettow-Vorbeck artikulierte sich militärisch-preußisch deutlich, das Angebot aber war in dieser Situation derart unpassend, dass der Kriminalassistent Zeit brauchte, um angemessen reagieren zu können.
»Möchten Sie eine Tasse Tee?«
»Ja. Gern.«
Lettow-Vorbeck orderte eine Kanne mit zwei Tassen über das Haustelefon.
»Ich möchte Sie bitten, mir den Leichnam zum Zwecke der notwendigen forensischen Untersuchungen mitzugeben.«
Gedankenverloren drehte der Generalmajor an seinem Bart. »Es ist meine Tochter, das müssen Sie verstehen. Ich schätze es nicht, wenn irgendwelche thanatologischen Riten an ihr vollzogen werden sollen.«
Gerlach konnte es gut nachvollziehen, wenn Menschen sich eine Obduktion von Angehörigen vor Augen führten und Schwierigkeiten hatten, ihr Einverständnis damit zu erklären. Zwar hatte er noch nie darum bitten müssen – eine Obduktion wurde einfach angeordnet und kein Angehöriger hatte die Möglichkeit, etwas dagegen zu tun –, aber seit Rosenbaum sein Chef war, wurden die Angehörigen immer darauf hingewiesen, wenn eine Obduktion nötig war, und manchmal gab es Widerstand. Einem alten Haudegen wie Lettow-Vorbeck hätte Gerlach eine solche Empfindsamkeit allerdings nicht zugetraut. Und er nahm sie ihm auch nicht ab. Also sagte er: »Es ist erforderlich. Und es liegt, denke ich, auch in Ihrem Interesse, dass die Tat aufgeklärt und der Täter gefasst wird. Vielleicht kann eine Obduktion Fremdverschulden ausschließen und wir können dann feststellen, dass es ein Unfall war. Das wäre doch auch in Ihrem Interesse.«
Lettow-Vorbeck lehnte sich zurück, die Ellenbogen stützten sich auf die Armlehnen, die Hände rieben sich unentschlossen vor der Brust.
»Warum haben Sie Ihre Tochter eigentlich nach Kiel geschickt? Sind die Schweriner Lehranstalten nicht gut genug?«
»Ich habe sie nicht nach Kiel geschickt. Ich habe sie auf ein Oberlyzeum nach Kassel geschickt. In Kassel ist auch unser Kaiser zur Schule gegangen.«
»Ist nicht Scheidemann jetzt Oberbürgermeister von Kassel?«, fragte Gerlach.
Erst Lettow-Vorbecks erstarrter Blick führte ihn vor Augen, dass diese Frage eine Provokation sein musste. Philipp Scheidemann hatte im November 18 vom Westbalkon des Reichstagsgebäudes spontan die Republik ausgerufen, ohne dazu in irgendeiner Weise autorisiert gewesen zu sein. Ihm hatte nicht gereicht, die Abdankung des Kaisers zu verkünden, er hatte gleich noch eine neue Staatsform gewählt und damit endgültig die Weichen für die Zukunft des Reiches gestellt. Für jemanden wie Lettow-Vorbeck musste er der schlimmste aller Novemberverbrecher gewesen sein.
»Trotzdem«, presste der Generalmajor durch seine Zähne.
»Sie haben sie nach Kassel geschickt, aber trotzdem war sie in Kiel.«
»Offensichtlich.«
»Und wieso?«
»Das weiß ich nicht. Ich habe es selbst erst gestern erfahren.«
»Aber sie hielt sich mindestens einen Monat in Kiel auf und war offiziell am Oberlyzeum als Schülerin aufgenommen. Wie konnte sie das denn anstellen? Sie war doch gar nicht volljährig.«
»Mithilfe meiner Gattin.«
»Dann wird Ihre Gattin die Gründe kennen.«
»Vermutlich.«
»Sie haben sie nicht gefragt?«
»Nein.«
»Dann würde ich sie gerne befragen.«
»Meine Gattin steht für eine Befragung nicht zur Verfügung.«
Das war noch keine Kriegserklärung, aber eine Provokation, eine Gegenprovokation. Gerlach musste jetzt standhalten, energisch genug, um sich Respekt zu verschaffen, aber nicht so stark, dass eine gütliche Regelung unmöglich werden würde.
»Ich könnte sie vorladen lassen.« Das konnte er genauso wenig, wie Rosenbaum den Generalmajor hätte vorführen lassen können. Denn er und Rosenbaum waren preußische Polizeibeamte, und sie befanden sich in Mecklenburg-Schwerin. Hier fuhren nicht nur keine preußischen Züge, hier hatten auch preußische Beamte nichts zu sagen.
»Sie ist gestern nach Wien verreist.«
Gerlach schüttelte ungläubig den Kopf. In Österreich war es noch schwieriger, Ermittlungen anzustellen, als in Mecklenburg. Der Weltkrieg war ausgebrochen, weil Österreich zur Aufklärung des Attentats an seinem Thronfolger Franz Ferdinand Kriminalbeamte nach Serbien hatte schicken wollen und Serbien damit nicht einverstanden gewesen war.
»Aber sie wird doch bestimmt zur Beerdigung zurückkehren.«
»Vermutlich.«
»Wieso nur vermutlich? Ist das zweifelhaft?«
»Nicht, dass ich wüsste.«
Das Gespräch entwickelte sich zu einer Farce. Nicht nur, dass Gerlach hier keine Polizeigewalt ausüben konnte, auch jedes Ersuchen um Amtshilfe durch die Mecklenburgische Polizei würde von Lettow-Vorbeck ohne Schwierigkeiten torpediert werden können. Er war nahezu sakrosankt und das nutzte er aus.
Gerlach räusperte sich, lehnte sich zurück, schaute aus dem Fenster, ließ ein wenig Zeit vergehen, Zeit, die er brauchte, um sich für einen neuen Anlauf zu sammeln.
»Wie haben Sie eigentlich vom Tod Ihrer Tochter erfahren?«
»Auf dem Dienstweg.«
»So schnell?«
»Das Militär ist gut organisiert.«
»Aber nicht so gut, dass Sie den Aufenthaltsort Ihrer Tochter kannten?«
Jetzt ließ Lettow-Vorbeck eine Pause. »Haben Sie noch Fragen?«
Die sich allmählich zuspitzende Situation entspannte sich wieder, als der Offiziersbursche des Generalmajors hereinkam. Er jonglierte ein silbernes Tablett in der Hand, darauf standen eine dampfende chinesische Teekanne, zwei Tassen, eine Zuckerdose und ein Milchkännchen. Der Bursche versuchte reichlich ungeschickt, mit dem Ellenbogen die Tür hinter sich zu schließen. Mehrere Anläufe scheiterten, nie rastete die Falle im Schließblech ein, bis er sein Vorhaben schließlich aufgab und sich auf den Schreibtisch zubewegte. Mit der rechten Hand versuchte er, das Telefon zur Seite zu schieben, während er mit der linken weiter das Tablett jonglierte. Auch hierbei stellte er sich reichlich ungeschickt an. Gerlach wollte behilflich sein, fand aber keine Gelegenheit dazu, seine Bewegungsfreiheit war durch das schräg über ihm bedrohlich schwankende Tablett entscheidend eingeschränkt. So blieb ihm nichts anderes übrig, als für den Notfall in Bereitschaft zu bleiben. Der dann auch flugs eintrat. Aus dem Hals der Kanne schwappte etwas Tee, was den Burschen dazu verleitete, das Tablett wegzuziehen, vermutlich, um Schaden vom Kriminalassistenten abzuwenden. Dabei bedachte er die träge Masse der vollen Kanne nicht hinreichend, die Tassen klirrten, die Kanne kippte, ihr Deckel fiel zu Boden, der Inhalt ergoss sich zum größten Teil über einen wertvollen Orientteppich, zu einem kleinen Anteil über Gerlachs Oberhemd, Zucker rieselte hinterher und bildete auf dem Teppich ein Häufchen, das sich augenblicklich in eine zähe, bräunliche Masse verwandelte. Gerlach sprang auf, dabei schlug er dem Burschen das Tablett aus der Hand, sodass auch das Milchkännchen seinen Inhalt verlor und die bräunliche Masse auf dem Teppich isabellfarben aufhellte.
»Du Tölpel!«, entfuhr es dem Generalmajor. »Pass doch auf!«
Der Bursche stand breitbeinig über dem Malheur, das er angerichtet hatte, und stammelte mehrmals »Entschuldigung«. Er griff hektisch nach Gerlach, als wollte er den Flecken auf seinem Hemd wieder entfernen, zog die Hand aber auf halbem Weg zurück, kniete beschwörend vor der Zuckermasse nieder, als könnte er sie dadurch in Luft auflösen, sammelte dann den Deckel der Teekanne auf und legte ihn auf das Tablett, ließ den Rest jedoch liegen, wandte sich dann wieder Gerlach zu, dann wieder der Zuckermasse, dann dem Deckel der Zuckerdose. Schließlich fand er eine saubere Serviette, die er Gerlach reichte, und immer wieder ertönte sein »Entschuldigung«.
»Danke«, sagte Gerlach und rieb sich das Hemd trocken. »Nicht so schlimm.«
Lettow-Vorbeck schäumte vor Wut. »Geh! Und schick mir Oberleutnant Behrendt rein!«
Mit dem Burschen verließ auch die Aufregung das Zimmer. Gerlach wischte ein paar Tropfen Tee von seinem Stuhl und setzte sich wieder.
»Diese tumben Bauernlümmel, zum Dienst an der Waffe für zu blöd befunden. Oft bleibt dann nur der Aufwartungsdienst, und dabei terrorisieren sie einen bis ins Mark«, sagte der Generalmajor halb empört, halb belustigt. »Aber was soll man mit ihnen machen? Wenn Sie denen ein Gewehr in die Hand drücken, wird es wirklich gefährlich.« Dann entschuldigte er sich für die Ungeschicklichkeit seines Burschen. »Vorher hatte ich einen Neger, einen ehemaligen Askari. Der war sehr begabt und sehr intelligent. Ich habe ihn jetzt mit anspruchsvolleren Aufgaben betraut, und das war wohl ein Fehler.«
»Ein Askari?«
»Ja, ein Neger-Soldat. Ein treuer Kerl, er hat tapfer in Afrika gekämpft und ist nach dem Krieg mit mir nach Deutschland gekommen. Sie wissen doch, dass ich viele Jahre in Afrika Dienst getan habe?«
»Natürlich, das weiß ich. Sie waren als Kompaniechef an der Niederschlagung des Herero-Aufstandes beteiligt und haben später als Kommandeur der Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika gegen die Alliierten gekämpft.«
»Wir waren sehr erfolgreich, sehr erfolgreich. Bis zum letzten Tag haben wir gegen eine vielfache Übermacht der Briten, Belgier und Südafrikaner standgehalten, und wir hätten bis heute weitergemacht, wenn nicht der Frieden dazwischengekommen wäre. Das haben wir aber nicht allein den wenigen deutschen Offizieren zu verdanken, sondern in erster Linie den tapferen Askaris. Da waren ganz außergewöhnlich fähige Leute darunter, hochintelligent, mutig und mit einer besonderen strategischen Begabung ausgestattet. Ohne sie hätten wir niemals dauerhaft der feindlichen Übermacht standhalten können.«
Ein Offizier kam herein und unterbrach Lettow-Vorbecks Schwärmereien. Er trug einen Meldeanzug mit Adjutantenschnur, offenbar der Oberleutnant, nach dem Lettow-Vorbeck geschickt hatte. Als er sprach, erkannte Gerlach die Stimme des Mannes wieder, mit dem er gestern telefoniert hatte. Gerlach würdigte ihn keines Wortes.
»Machen Sie das hier mal weg«, wies der Generalmajor ihn an. »Und beschaffen Sie mir einen anderen Burschen.«
Der Adjutant kniete vor dem Kriminalassistenten nieder und sammelte das Geschirr auf. Dann verschwand er, kam mit Schmutzschaufel und Handfeger zurück und kehrte so gut es ging die Zuckermasse auf. Gerlach machte keine Anstalten, ihm zu helfen.
Auch Lettow-Vorbeck beachtete seinen Oberleutnant nicht weiter und wandte sich wieder Gerlach zu. »Leider sind nur sehr wenige Askaris mit nach Deutschland gekommen. Ich habe es allen angeboten, aber kaum einer wollte.«
»Vielleicht wollten erprobte Soldaten nicht allzu gerne als Burschen arbeiten.«
»Aber der Krieg ist vorbei. Was sollten sie sonst tun?«
»Welchen Dienstgrad hatten sie denn bei der Schutztruppe?«
»Sie gehörten meist zu den Mannschaften. Einige waren Effendis.«
»Effendi? Ist das nicht ein osmanischer Titel?«
»Ja. Aber bei uns war es ein Offiziersrang, den wir extra für verdiente Askaris eingerichtet haben. Es gab nicht sehr viele von ihnen, nur wenn mal Beförderungen als Anerkennung für besondere Tapferkeit und Treue notwendig wurden. Drei Sterne auf die Schulterklappen, ein etwas höherer Sold und fertig. Sie waren stolz wie Bolle, und die anderen Neger hat es motiviert.«
»Und in Deutschland haben sie keine Aussichten auf einen Offiziersrang?«
»Wo denken Sie hin, junger Mann? Ein Neger kann doch niemals einen Deutschen befehligen.«
»Wenn der Neger so begabt ist, wie Sie sagen, und der Deutsche ein Trottel ist …«
»Unsinn! Was reden Sie denn da? Ihre Gehirne sind kleiner als die der weißen Rassen. Der weiße Mann entwickelt Kultur und betreibt Wissenschaft, der schwarze kann all das von uns nur lernen. Deshalb können die Neger nur dienen, niemals herrschen. Das ist die natürliche Ordnung.«
»Sagten Sie nicht, dass einige Ihrer Askaris außergewöhnlich intelligent waren und dass Sie ohne ihre Talente der feindlichen Übermacht nicht dauerhaft hätten standhalten können?«
»Es sind aber trotzdem Neger!« Mit der flachen Hand schlug Lettow-Vorbeck einen Schlussstrich auf die Tischplatte.
Für einen kurzen Moment dachte Gerlach daran zu fragen, ob die weiße Frau nach der natürlichen Ordnung denn im Range über oder unter dem schwarzen Mann stehe. Es wäre eine neue Provokation, die ihn sein Verhandlungsziel vielleicht endgültig verfehlen lassen könnte. Er sollte es nicht sagen, aber ihm war sehr danach, und vielleicht hätte er es getan, wenn nicht in diesem Moment der Adjutant des Generalmajors in höchster Erregung ins Zimmer geplatzt wäre.
»Herr General«, sagte er und seine Stimme überschlug sich vor Erregung. »Das ist gerade eben eingegangen.«
Er legte seinem Chef ein Telegramm vor, das dieser mit zunehmendem Entsetzen las.
»Die Brigade Ehrhardt soll heute Nacht auf Berlin marschieren?« Lettow-Vorbeck schaute seinen Oberleutnant an, wie vor sechs Jahren viele Menschen einander angeschaut hatten, als die Nachricht vom Ausbruch des Weltkrieges bekannt geworden war.
In den letzten Wochen hatten Gerüchte über einen bevorstehenden Militärputsch die Runde gemacht. Spätestens seit im Januar der Friedensvertrag mit den Alliierten unterzeichnet worden war, empörte sich die Republik über den »Schandfrieden von Versailles«. Die Bedingungen waren überaus hart. Deutschland musste die alleinige Kriegsschuld anerkennen, Hindenburg, Ludendorff, Tirpitz und etliche weitere hochrangige Militärs als Kriegsverbrecher ausliefern, Annexionen dulden, horrende Reparationsleistungen erbringen und das Militär auf ein Zwergenheer reduzieren – schwer zu sagen, was davon die deutsche Seele am meisten belastete. Nicht nur reaktionäre, auch viele gemäßigte, sogar linke Politiker und Intellektuelle hatten sich gegen die Unterzeichnung des Vertrages ausgesprochen. Dennoch setzte sich allmählich die Überzeugung durch, dass in diesem Fall die Besetzung und anschließende Zerschlagung des Deutschen Reichs die unausweichliche Folge wäre.
Hinzu kam die Legende, dass irgendwer irgendwem einen Dolch in den Rücken gerammt habe. Wer wem? Die Juden den im Felde unbesiegten Soldaten, die vaterlandslosen Gesellen dem Vaterland? Ebert Hindenburg? Darauf wollte man sich in letzter Konsequenz nicht einigen, schließlich war es wesentliches Element einer Legendenbildung, dass es nicht zu konkret werden durfte. Die Dolchstoßlegende war bereits ein Jahr durch Deutschlands reaktionäre Köpfe gewabert, als sie auf das Narrativ des Schandfriedens von Versailles traf und mit ihm wie zwei Atomkerne in zerstörerischer Gewalt verschmolz.
Der Aufprallzünder war scharf. Republikfeindliche Kräfte verbündeten sich unter der Leitung von General Walther von Lüttwitz, dem Befehlshaber des Reichswehrgruppenkommandos 1 in Berlin, und schmiedeten Umsturzpläne, bei denen sie sich insbesondere auf die vor Berlin stationierte Marine-Brigade Ehrhardt stützen wollten. Noch hielten sie den Zeitpunkt für nicht passend, noch hatten sie ihre Vorbereitungen nicht gänzlich abgeschlossen. Doch als Reichswehrminister Noske vor ein paar Tagen entschied, dass mehrere Freikorps, darunter die Brigade Ehrhardt, in Erfüllung des Friedensvertrages umgehend aufzulösen seien, raste die Bombe zu Boden. Lüttwitz forderte die Reichsregierung auf, den Auflösungsbefehl zu widerrufen, und wurde dafür von Noske seines Postens enthoben. Jetzt blieb ihm nur, das Feld zu räumen oder den Putsch auszulösen. Offenbar hatte er Letzteres gewählt.
»Was soll denn das?«, echauffierte sich Lettow-Vorbeck. »Ist Lüttwitz noch bei Trost? Das ist doch viel zu früh!«
»Soll ich die Truppe in Alarmbereitschaft versetzen, Herr General?«, fragte der Oberleutnant.
Fast schien der Brigadegeneral seinen Gast vergessen zu haben, so groß war die Aufregung. Jetzt schaute er ihn an, und es war klar, dass die Besuchszeit zu Ende war. Ohne dass es eines Wortes bedurfte, war Gerlach schon durch die Situation aufgefordert worden, sich von seinem Stuhl zu erheben.
»Ich brauche den Leichnam, Herr General, anderenfalls muss eine gerichtliche Beschlagnahme angeordnet werden«, sagte er und kam sich nach der Putsch-Nachricht mit seinem Anliegen reichlich unbedeutend vor.
»Sie bekommen morgen früh Nachricht in Ihr Hotel.« Das war das Letzte, was Lettow-Vorbeck zu ihm sagte.
*
Ob er es verabscheute? Darüber dachte Hashim nicht nach. Er machte es, weil er es musste. Er war ein Askari, er lebte, um zu gehorchen. Schon sein Vater war Askari gewesen, ein Tutsi aus Ruanda, ein großer Mann und ein stolzer Krieger, ein Effendi.
»Du musst gehorchen«, hatte er zu ihm gesagt, als er gerade vier Jahre alt geworden war. Nur wenige Tage später hatte er nicht gehorcht. Der Vater rief nach ihm, dass er zum Essen kommen sollte, aber er kam nicht. Er blieb draußen bei den Tieren. Die Ziege hatte in der Nacht zwei Kitze geworfen, die noch kein Fell besaßen und seinen Schutz brauchten. Der Vater rief noch einmal und noch einmal. Dann rannte er donnernd aus dem Haus, der große, starke Mann, während der kleine Hashim sich im Stall versteckte. Der Vater brüllte, warf mit Eimern und Knüppeln um sich, der Junge kauerte in einer Kiste und kämpfte gegen einen Panikanfall. Würde der Vater ihn jetzt finden, schlüge er ihn zu Tode. Selbst lange nachdem der Vater wieder weg war, traute sich der Sohn nicht aus der Kiste. Erst spät in der Nacht wagte er es, und nur, weil er vor Durst fast umkam. Er öffnete behutsam den Deckel und stieg hinaus, so langsam, dass er es selbst nicht hören konnte. Er schlich zur Wassertonne und hob den Deckel an, ohne jedes Geräusch. Dann spürte er jemanden hinter sich. Es war der Vater mit einem Stock aus Bambusrohr.
»Du hast die Wahl«, sagte er. »Wüste oder Schläge.«
Der Junge wählte die Schläge.
»Das nächste Mal, wenn du nicht gehorchst, musst du in die Wüste. Wie die Herero, drüben in Deutsch-Südwestafrika. Die haben auch nicht gehorcht.«
Die Herero seien Buschneger, hatte der Vater gesagt. Den Ausdruck hatte er sich nicht ausgedacht. So nannten alle Askaris und alle weißen Soldaten voller Verachtung die Schwarzen, die nicht Askaris waren. In dieser Nacht starben die beiden Kitze.
Sergeant Hashim marschierte durch den leeren Korridor im ersten Stock der Alten Station, seine Schritte hallten wie in einem Konzertsaal. Der Generalmajor hatte ihn angerufen und angekündigt, dass es heute Nacht losgehen werde. Er solle sich jetzt um Kapitän Looff kümmern. Der sei ein wankelmütiger Geselle, auf den müsse man achtgeben.
Max Looff war Stadtkommandant von Kiel und in dieser Funktion Mitglied im Kommandostab der Marinestation. Möglicherweise hatte er Einfluss auf den Stationschef, er musste unter Kontrolle gebracht werden.
Lettow-Vorbeck kannte ihn gut und traute ihm deswegen nicht über den Weg. Auch Hashim kannte ihn. Vor Ausbruch des Weltkrieges hatte Looff das Kommando über den Kleinen Kreuzer SMS Königsberg erhalten und war damit nach Deutsch-Ostafrika gefahren. Kurz darauf hatte er sein Schiff im Indischen Ozean verloren und sich anschließend mit seiner Mannschaft nach Deutsch-Ostafrika durchgeschlagen, um sich der Schutztruppe unter Lettow-Vorbeck anzuschließen. Zwischen diesen beiden Alphatieren war es immer wieder zu Rivalitäten gekommen. Ständig hatte Looff von Rücksicht und Zumutbarkeit und all dem humanistischen Humbug geredet und damit notwendige Anordnungen infrage gestellt, bis er ein Jahr vor Kriegsende in britische Kriegsgefangenschaft geraten war. Er musste unter Kontrolle gebracht werden.
Hashim klopfte an Looffs Tür und wurde hereingerufen. Ein letztes Mal tief durchatmen und dann in den Kampf. Es war seine Pflicht, und es half beim Vergessen.
»Sergeant Mahjub bin Hashim«, sagte er stramm und grüßte ordnungsgemäß. »Zu Ihrer Verfügung gestellt, Herr Kapitän.«
Looff schaute von seinem Schreibtisch auf und runzelte nachdenklich die Stirn. »Hashim? Ich kenne Sie doch …«
»Von der Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika, Herr Kapitän.«
»Stimmt.« Ein sanftes Lächeln zog sich um Looffs Mund. »Und jetzt sind Sie in Deutschland?«
»Ich hatte nur die Alternativen, Buschneger zu werden oder in die britischen Kolonialtruppen einzutreten. Da bin ich lieber mit der Truppe nach Deutschland gekommen.«
»Sehr gut, sehr gut, löblich, löblich.« Looff schaute den Sergeanten jovial an. Wohlwollend, gönnerhaft, etwas von oben herab, so hatte Hashim ihn in Erinnerung. »Und jetzt wollen Sie sich mir zur Verfügung stellen?«
»Ich unterstehe dem Verbindungsoffizier der Reichswehr-Brigade 9 und bin zur vertraulichen Kommunikation mit der Stadtkommandantur abgestellt.«
»Vertrauliche Kommunikation mit der Brigade von Lettow-Vorbeck?« Looff lehnte sich erwartungsvoll in seinen Sessel zurück. »Das hört sich ja verwegen an.«
Vertraulichkeit war nach Hashims gefestigter Einschätzung nie die Stärke von Kapitän Looff gewesen. Er hatte einmal zu Lettow-Vorbeck gesagt, dass jedes Handeln erhaben sein müsse, sodass es besonderer Verschwiegenheit nicht bedürfe. Für Hashim war Looffs Erhabenheit nichts anderes als Geschwätzigkeit.
»Herr Kapitän, wir sind darüber informiert worden, dass der Reichspräsident beabsichtigt, noch heute Nacht das Kabinett umzubilden. Reichskanzler Bauer soll abgesetzt und Generallandschaftsdirektor Kapp zum neuen Kanzler berufen werden.«
»Kapp? Ist das nicht dieser Kerl von den Deutschnationalen?«
»Nationale Vereinigung, soweit ich weiß, Herr Kapitän.«
»Und der SPD-Mann Ebert setzt den SPD-Mann Bauer ab, um statt seiner einen Antirepublikaner zu berufen? Hat der getrunken?«
»Es scheint ein politischer Kompromiss ausgearbeitet worden zu sein.«
»Und jetzt?«
»Das Truppenamt und die Heeresleitung weisen die örtlichen Militärbefehlshaber an, ihre Einheiten ab morgen Früh in Bereitschaft zu halten. Es wird befürchtet, dass die Rotfront die Kabinettsumbildung zum Anlass nimmt, einen kommunistischen Aufstand anzuzetteln.«
»Und das erfahre ich jetzt von Ihnen? Von einem Sergeanten?«
»Für die frühen Morgenstunden ist eine fernmündliche Bestätigung aus Berlin avisiert. Ich soll dies nur vorab ankündigen. Und mich zu Ihrer Verfügung halten.«
Alles gelogen.
Warum Hashim das tat? Weil es seine Pflicht war. Ob er es gerne tat? Natürlich.