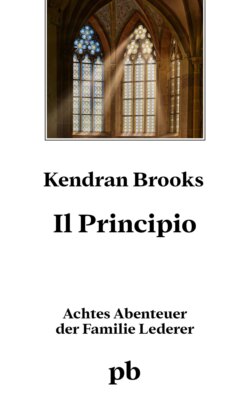Читать книгу Il Principio - Kendran Brooks - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Heimat
ОглавлениеEs war einer der letzten schönen Herbsttage am Lac Léman. Die Sonne hatte den Morgennebel vertrieben, glitzernd breitete sich das dunkelblaue Wasser unter ihren Strahlen aus, verschmolz in der Ferne mit dem Ufer und den schattigen Höhen der Alpenkette.
Jules Lederer spielte ausgelassen mit seiner Tochter Alina im Garten. Er war der Torwart, sie die Artistin im Penaltyschießen. Das Tor bestand aus der Gartenbank und der Schubkarre als Torpfosten, dazwischen lag ein Abstand von gut drei Metern. Und selbst die regelkonformen elf Meter waren zu mickrigen vier zusammengeschrumpft. Der noch feuchte Rasen hinderte die beiden allerdings am hohen, körperlichen Einsatz. Alina holte kaum Anlauf und Jules hütete sich, nach einem zu gut platzierten Plastikball zu hechten, ließ sich lieber das eine oder andere Mal von seiner Tochter schlagen. Höhere sportliche Ambitionen von Vater und Tochter wurden zudem auch noch von ihren anhaltenden Lachanfällen behindert. Alina wie Jules konnten hinterher kaum erklären, was eigentlich der Anlass für ihre ausgelassene Fröhlichkeit gewesen war. Gut, der eine Ball, hart getreten von Alina, spritzte von der Ecke der Gartenbank direkt an die Stirn von Jules, hinterließ auf ihr einen dreckigen Schmier und in seinem Gesicht einen äußerst verblüfften Ausdruck. Alina hatte losgeprustet und Jules stimmte wenig später ein.
»Du … wolltest dich … doch … nicht … im Schlamm … wälzen, ... Papa ...«, stieß die Kleine zwischen ihren Lachattacken hervor. Ihr Gelächter drang durch das offene Fenster in die Küche, wo Alabima Vorbereitungen fürs Mittagessen traf, die frischen Scampi vom Markt in Lausanne am Küchentisch sitzend ausnahm, sie dazu aufschnitt und den Darm umsichtig entfernte. Den Kohlrabi hatte sie zuvor schon geschält und in kleine Würfel geschnitten. Er köchelte munter in einer Pfanne auf dem Herd vor sich hin. Weich gekochter Kohlrabi an einer würzigen Frischkäse-Kräuter-Soße, dazu gegrillte Scampi, nur mit einer Prise Meersalz und ein wenig schwarzem Pfeffer abgeschmeckt. Einfach und schmackhaft, leicht und bekömmlich.
Alabima stand auf und warf einen Blick hinaus in den Garten, sah Jules direkt ins Gesicht und wie er gespielt grimmig den nächsten Torschuss seiner Tochter einforderte. Und sie betrachtete Alina von hinten, wie sie vor lauter Lachen neben den Ball in die Luft trat und vom Schwung getrieben ausglitt und auf ihrem Hosenboden landete, mitten in den Match hinein, den ihre Sportschuhe durch das Treten auf nassem Rasen zuvor angerichtet hatten.
»He, ihr beiden«, rief sie ihnen laut zu, »Laurel und Hardy sind wohl auferstanden? In einer halben Stunde gibt’s Mittagessen. Kommt rechtzeitig rein, ihr Schmutzfinken, und wascht euch gründlich.«
Beide winkten ihr fröhlich zu, Jules lächelnd, Alina sich immer noch vor Lachen kugelnd.
Alabima setzte sich wieder und nahm die letzten beiden Scampi aus, legte sie neben die anderen aufs Tablett, betrachtete ihre Hände mit den feingliedrigen Fingern und den nur halblangen Nägeln, die nach einer Maniküre verlangten. Die Äthiopierin sandte ein stilles Dankgebet gen Himmel. Wie hatte sich Jules doch in den letzten Wochen verändert, war aus seiner Erstarrung erwacht, erschien ihr wieder lockerer, gelöster, hatte auch seine über viele Monate anhaltenden nächtlichen Angstattacken abgelegt, lag meistens ruhig neben ihr im Bett, war auch so zärtlich zu ihr wie kaum je zuvor. Sie liebten sich fast jeden Tag, inniger und vertrauter als früher, sanfter und einfühlsamer. Ja, Alabima war eine überaus glückliche Ehefrau und Mutter. All die dunklen Wolken der letzten beiden Jahre schienen endgültig verflogen, hatten sich wie der Regenschauer von letzter Nacht gelegt, ließen die Zukunft in einem strahlenden Licht erscheinen. Vergessen war auch ihr Abenteuer in Hongkong und all die Gefahren, in der sie mit ihrer Tochter damals schwebte. Oder zumindest hatte sie die Gedanken daran erfolgreich verdrängen können.
Auch Dr. Grey, die Psychologin aus Lausanne, zu der Jules seit mehr als einem Jahr jede Woche für eine Stunde zum Gespräch hinging, hatte die Fortschritte ihres Klienten zufrieden festgestellt, hatte ihn darin bestärkt, auf dem eingeschlagenen Weg mutig weiter zu gehen und nicht zurückzublicken, sondern nur vorwärts zu schauen. Selbst Jules gestand sich ein, dass all das Böse in ihm, das ihn seit Mexiko verfolgt und beständig gequält hatte, seit seiner Aussprache mit Alabima verschwunden schien, ihn zumindest nicht mehr in der Nacht überfiel, ihn nicht länger drangsalierte und vom Leben abschnitt. Und so glaubte auch der Schweizer mittlerweile an eine vollständige Heilung seiner Seele.
Die Äthiopierin stand vom Küchentisch auf und trug das Tablett mit den Scampi hinüber zum Spülbecken, wusch sie gründlich aus und tupfte sie mit Küchenpapier trocken, ging mit ihnen zum Herd, zog eine Bratpfanne aus dem Schrank, stellte sie auf die Platte, drehte am Regler, worauf sich die Gasflamme mit einem »Plopp« entzündete und blaue Flammen nach dem Metallboden zu lechzen begannen. Sie holte die Flasche mit Rapsöl hervor und stellte sie neben dem Herd bereit.
Die Türklingel ging und Alabima warf einen kurzen, prüfenden Blick zur Pfanne mit dem köchelnden Kohlrabi, drehte die Gasflamme etwas niedriger, ging aus dem Küche und auf den Flur und hinüber zum Bildschirm der Überwachungskamera, drückte den Verbindungsknopf, schaute erwartungsvoll auf die Scheibe. Doch als die Aufnahme vom Torbereich an der Hauptstraße angezeigt wurde, stockte ihr das Herz für einen Moment und sie trat erschrocken einen Schritt zurück, hob ihre Arme, hatte ihre Hände zu Fäusten geballt, drückte sie gegen ihre Kehle, konnte kaum glauben, wen sie dort längst erkannt hatte. Ein chinesisches Vollmondgesicht starrte in die Kamera, versuchte ein Lächeln, lieferte jedoch nur ein schräges, verunsichertes Grinsen.
»Hallo?«, meldete sich die Stimme des Mannes klar über den Lautsprecher, »mein Name ist Fu Lingpo. Ist Misses Lederer zu Hause?«
*
Eine neue Flüchtlingsgruppe aus Syrien traf an diesem Nachmittag in Mor Gabriel ein. Das orthodoxe Kloster, im 3. Jahrhundert nach Christus gegründet, war um einige hundert Jahre älter als der heute hier alles beherrschende Islam. Das Kloster leitete aus diesem Umstand heraus auch besondere Rechte für sich ab, sehr zum Missfallen der örtlichen Behörden und der Mehrheit der Bevölkerung. Mor Gabriel gehörte zu den letzten Bastionen des Christentums im tiefsten Süden der Türkei, wurde noch von zwei Dutzend Nonnen und einer Handvoll Mönche bewohnt.
Timotheus, der Erzbischof und Metropolit, empfing die Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem Nachbarland persönlich, blickte in viele erwartungsvolle, aber auch in verängstigte oder leere Gesichter, in glücklich angekommene und ratlose vertriebene. Er breitete seine Arme weit aus, empfing die Menschen mit einem warmen »as-salāmu ʿalaikum«, worauf mehrheitlich ein eher schüchtern ausgesprochenes » wa-ʿalaikum us-salām« oder auch nur ernstes Kopfnicken zurückkamen.
Menschen stiegen von den beiden Lastwagen herunter, trugen Bündel und Koffer mit sich, Taschen und auch zusammengeknüllte Plastiksäcke unter ihren Armen. Das war das Wenige, das ihnen der Bürgerkrieg gelassen hatte, ihre letzte Habe, den Rest ihrer Heimat und womöglich ihrer Würde.
Die riesige Klosteranlage beherbergte bereits mehr als einhundert syrische Flüchtlinge. Doch der Platz war längst noch nicht erschöpft, eher noch die Arme und Hände der wenigen Mönche und Nonnen, die hier noch lebten, beteten und arbeiteten, ihre Seele und ihre Jahre ihrem Gott weihten und dereinst glücklich, weil erfüllt, sterben durften. Selbstverständlich packten die geflüchteten Syrer auch mit an, halfen bei der Ernte auf den Gemüsefeldern, in der Küche oder bei der Wäsche. Doch alles musste erst organisiert und überwacht sein, angeleitet und entschieden. Und so übernahmen sich vor allem die älteren Brüder und Schwestern regelmäßig, kämpften bis zu ihrer völligen Erschöpfung, sanken mehr tot als lebendig und oft erst tief in der Nacht auf ihre Matratzen, schliefen den kurzen Schlaf der Gerechten, wurden viel zu früh wieder geweckt, wuschen sich behände und warfen sich die Kleider über, stürzten erneut in die Schlacht, in die sie ihr Gott von einem Tag auf den anderen geführt hatte.
Viele der ankommenden jüngeren Kinder wirkten sehr verschüchtert, ja ängstlich, hatten das Knallen der Schüsse, das Donnern der Bomben, das Schreien der Menschen immer noch in ihren Ohren, sahen Bilder der Zerstörung in ihrem Kopf, wurden vom Anblick toter Menschen auf den Straßen gequält. Sie bedurften der besonderen Fürsorge und viele der Klosterfrauen verbrachten die meisten Stunden mit den Allerjüngsten, trugen sie im Garten herum, zeigten ihnen die Schönheiten der Natur, lenkten sie mit kindlichem Spiel von der schrecklichen Welt der Erwachsenen ab.
Die syrischen Flüchtlinge waren größtenteils Schiiten, fast ebenso viele jedoch Sunniten. Die wenigen Alawiten unter ihnen fühlten sich von den beiden anderen Gruppen eher bedroht, hielten sich deshalb weitgehend zurück, mieden jeden unnötigen Kontakt zu ihnen und blieben meist unter sich. Timotheus ließ das alles zu. Denn die Zeit der Verständigung lag in weiter Ferne. Und die Zeit der Versöhnung noch sehr viel weiter.
Ein junges und hübsches Mädchen fiel dem Abt von Mor Gabriel besonders auf. Sie ging mit einem alten Mann, der vorsichtig von der Ladefläche des Lasters geklettert war und nun hinkend und aufgestützt auf das halbwüchsige Kind langsam näherkam. Viele der anderen Flüchtlinge warfen dem Paar recht böse Blicke zu, drängten sich an ihnen vorbei, schienen sogar böse Worte gegen sie auszustoßen, leise zwar, so dass sie nicht bis an die Ohren des Abtes drangen. Doch die hässlichen und bitteren Fratzen, die sie dabei zogen, waren ihm Beweis genug. So trat der Abt den beiden verfluchten Ankömmlingen ein paar Schritte entgegen. Diese hatten ihn längst zwischen den anderen Mönchen und dem Dutzend Nonnen als Hausherrn erahnt, wirkten unter seinem freundlichen Blick ein wenig verlegen.
»Salām«, begrüßte Timotheus die beiden freundlich und erhielt vom Mann ein kurzes, forschend fragendes »Salām« zurück, während das Mädchen ihn mit »wa-ʿalaikumu s-salām wa-rahmatu´ʾllāhi wa-barakātuhu« grüßte. (und auf euch sei Frieden und Gottes Erbarmen und sein Segen).
Doch ihre Worte erklangen nicht etwa stolz und frei, sondern flüsternd und darum recht unterwürfig. Das Mädchen hielt auch ihren Blick gesenkt, behielt die Augen auf den Boden gerichtet, vielleicht auch auf die staubigen Schuhe des Metropoliten von Mor Gabriel. Ihr alter Begleiter dagegen schaute den Erzbischof und Abt nun offen an, hatte erkannt, dass von ihm nichts Böses ausging, sondern Güte und Verständnis.
»Ihr seid Alawiten?«
Das war Frage und Antwort zugleich und so nickte der Alte bloß.
»Herzlich willkommen im Kloster Mor Gabriel. Ihr seid hier nicht allein. Gut zwei Dutzend eurer Glaubensbrüder und Schwestern leben bereits unter uns. Sie haben sich im Ostflügel niedergelassen. Kommt, ich bring euch zu ihnen.«
Timotheus wartete auf keine Frage oder eine Antwort der beiden, ging gemessenen Schrittes in Richtung des bezeichneten Gebäudeteiles davon, jedoch so gemächlich, dass der hinkende Alte mit dem ihn stützenden Mädchen aufzuschließen vermochte.
»Woher kommt ihr?«, fragte der Metropolit wie beiläufig.
Der Alte musste sich erst räuspern.
»Wir sind aus al-Busayrah. Das ist ein kleiner Provinzort…«
»Oh, ich kenne al-Busayrah. Liegt es nicht am Zusammenfluss des Chabur mit dem Euphrat? Nicht weit der Provinzhauptstadt Deir ez-Zor?«
»Ja, mein Herr«, antwortete der Alte und schien irgendwie erleichtert, vielleicht, weil hier ein Mensch zu ihm sprach, der nicht nur Anteil nahm, sondern sich auszukennen schien.
»Dann ist der Krieg schon bis dorthin gelangt?«
Der Alte nickte.
»Ja, Herr. Gestern Morgen überfielen Dschihadisten unsere Gemeinde. Sie waren wohl von den Sunniten herbeigerufen worden, weil sie sich davor fürchteten, die Schiiten und Alawiten könnten die libanesische Hisbollah um Unterstützung bitten.«
Der Abt war stehen geblieben, ebenso die beiden Flüchtlinge.
»Und dann?«
Der alte Mann schluckte leer und die Bitterkeit nahm von seinem Mund und seinen Augen Besitz.
»Diese Ungeheuer stürzten sich grundlos auf alle Alawiten und auch auf die Christen. Ich war mit Sheliza mit dem Jeep unterwegs gewesen. Wir hatten nach unserem Vieh außerhalb der Ortschaft gesehen und den Rindern ein wenig Kraftfutter gebracht. Doch als wir zurück kamen…«, die Worte des Alten stockten und erneut musste er trocken schlucken und seine Augen wurden ihm feucht, »…sie waren bereits in den Hof eingedrungen und wir hörten viele Schüsse. Und schreckliche Schreie. Dann kam einer der Soldaten durch das Tor gerannt, sah uns draußen verstört im Wagen sitzen und legte sein Gewehr auf uns an. Da habe ich Gas gegeben und bin davongebraust. Er hat noch ein paar Mal hinter uns her geschossen, doch wir entkamen unverletzt. Wir wagten uns nicht mehr zurück in die Stadt, sondern flohen nach Norden. Als der Tank leer war, gingen wir zu Fuß weiter, wurden von anderen Flüchtlingen eingeholt und mitgenommen. In Nusaybin gelangten wir glücklich über die Grenze in die Türkei. Die Soldaten dort befahlen uns dann auf die Lastwagen, die uns hierherbrachten.«
Timotheus sah auf das Mädchen hinunter, das bei den Erklärungen des Alten aufgeblickt hatte und unsicher aber neugierig den hoch gewachsenen Mann in der Kutte anstarrte, der sie vielleicht mit seinem mächtigen Kinnbart, in dem sich bereits zahlreiche Silberfäden zeigten, aber wohl vor allem durch seine freundliche und besonnene Art beeindruckte. Der Erzbischof blickte sie aus gütigen Augen und voller Verständnis an, worauf sie ihre Augen wieder zu Boden schlug.
»Hier seid ihr in Sicherheit«, erklärte ihnen der Abt von Mor Gabriel, »hier seid ihr außer Gefahr. Sucht euch ein Quartier aus. Einer meiner Brüder wird sich später um euch kümmern. Du bist der Vater des Mädchens?«
Der Alte schüttelte verneinend seinen Kopf.
»Nein, ihr Onkel. Ihr Großonkel.«
»Dann solltet ihr euch zwei getrennte Zellen nebeneinander aussuchen. Macht euch mit den anderen Bekannt. Wie heißt ihr eigentlich?«
»Ich bin Jussuf bin-Elik und sie heißt Sheliza bin-Elik.«
»Es ist gut.«
Der Metropolit legte seine flache Hand auf die Schulter des Alten, drückte sie sanft und ermutigend. Der packte sein Bündel und Onkel und Nichten gingen weiter auf die kleine Gruppe von Menschen zu, die sich vor dem Hauptzugang des Seitenflügels angesammelt hatte und zu den Neuankömmlingen starrte. Je näher sie kamen, umso deutlicher konnten sie die Mienen in den Gesichtern unterscheiden. Sheliza sah in ernst blickende, leere Augen, in denen keine Hoffnung lag, die immer noch das Entsetzen des Bürgerkriegs zeigten. Manche der Frauen trugen ein Kind auf ihren Armen. Sie pressten sie an sich, als ob die Kleinen sie beschützen müssten. Keiner der mehrheitlich älteren Männer schien zu ihnen zu gehören. Das hier war keine Gemeinschaft, denn es fehlte die Vertrautheit untereinander. In ihren Gemeinden in Syrien waren Nachbarn zu erbitterten Feinden geworden, der Staat zu einem menschenfressenden Ungeheuer, die Religion zur alles verschlingenden Python. Diese menschlichen Splitter des Bürgerkrieges waren auf Mor Gabriel zwar in Sicherheit vor den fallenden Bomben und den fliegenden Kugeln, vor dem Durst und dem Hunger. Doch ihr Leben, wie sie es gekannt hatten, war vor vielen Tagen oder gar Wochen endgültig zu Ende gegangen, würde nie mehr so sein, wie es einmal gewesen war.
Ja, Sheliza wurde sich, je näher sie diesen Menschen kamen, umso sicherer. Die hier Gestrandeten waren im Moment zwar in einem sicheren Hafen angelangt, jedoch noch lange nicht zurück in ihrem Leben. Die Vierzehnjährige schluckte trocken, unterdrückte einen Seufzer und wischte sich tapfer über die feucht gewordenen Augen.
Ihre Eltern waren mit Sicherheit erschossen worden. Auch ihre Brüder und Schwestern und die übrige Verwandtschaft, womöglich sogar sämtliche Menschen auf ihrem Hofgut. Doch warum war der Tod über sie alle gekommen?
Sie sah ihren Lehrer Mohammed al-Barani vor sich, wie er sie drohend anstarrte und von ihr Demut verlangte.
War all das tatsächlich das Werk Allahs? Hatte er die Alawiten endgültig verlassen? Trug vielleicht gar sie allein die Schuld am Untergang? Durch ihren Trotz, durch ihre Dickköpfigkeit?
Ihr Großonkel begrüßte die Männer vor dem Eingang, stellte sich und Sheliza vor. Das Mädchen blieb dabei stumm, schaute nur die Frauen und Kinder an, hielt ihren Blick vor den Augen der Männer gesenkt.
Sure 24, Vers 31 dachte die Vierzehnjährige in diesem Moment bitter, schämte sich auf einmal für ihre Demut, hob trotzig ihr Kinn, schaute die fremden Männer offen und direkt an. Sie alle waren Alawiten, wie dieser Abt ihnen erklärt hatte. Deshalb erwiderten sie ihren Stolz nicht etwa mit Ungeduld oder gar mit Ablehnung, sondern mit einem verständnisvollen Lächeln. Ja, dieses Lächeln steckte einen nach dem anderen von ihnen plötzlich an, so als würden sie sich gegenseitig die Hände reichen, sprang sogar auf die Frauen über, die einander prüfenden Blicke voller Erstaunen zuwarfen. Und Sheliza? Sie fühlte sich auf einmal inmitten von Freunden und Vertrauten, erkannte auch in den Gesichtern der anderen große Verwunderung über das, was soeben mit ihnen allen geschehen war.
Timotheus stand drei Dutzend Schritte entfernt, hatte innegehalten und abgewartet, hatte die Begrüßungsszene beobachtet, erkannte auch das Erstaunen und dann die Erkenntnis in den Gesichtern all der Flüchtlinge. Er drehte sich zufrieden von ihnen ab, ging langsam zurück zum Verwaltungsgebäude.
»Ein stolzes Mädchen«, murmelte der Erz-Bischof so leise, dass nur er es vernahm, »ein sehr stolzes Mädchen.«
*
Die Erinnerungen stürzten wie eine Lawine auf Alabima nieder. Die Tage der Angst während der Gefangenschaft in Hongkong. Die Ungewissheit vor der nächsten Stunde, ja der kommende Minute. Die Drohung ihrer Ermordung. Ihre grenzenlose Furcht vor dem weiteren Schicksal ihrer Tochter Alina. Der Äthiopierin schossen die Tränen in die Augen und sie blieb fassungslos vor dem Bildschirm neben der Eingangstüre stehen, starrte auf ihren Entführer, blickte in das Gesicht des Mannes, dem sie ihr Leben verdankte. Sie atmete so heftig ein und aus, dass sich ihre Brust hob und senkte, hob und senkte, spürte nicht ihre Aufregung, das Zittern ihrer Hände, konnte keinen klaren Gedanken fassen, denn alles stürmte zugleich in ihrem Kopf durcheinander, Gefühle und Gedanken, Bilder und Worte.
»Hallo?«, rief erneut die Stimme aus dem Lautsprecher, »hören Sie mich? Ist jemand zu Hause?«
Vielleicht waren es die Worte zu Hause, die Alabima aus ihrer Erstarrung lösten. Jedenfalls trat sie näher an den Bildschirm heran und drückte nach einem kurzen Zögern den Verbindungsknopf, versuchte zu sprechen, musste sich jedoch erst räuspern.
»Ja, hier ist Alabima Lederer.«
Ihre Stimme klang wie aus einer tiefen Gruft. Oder eher wie die einer Toten, die eben zu neuem Leben erweckt worden war, brüchig und ihr selbst fremd.
»Misses Lederer?«
Erneut versuchte sich der Chinese an einem Lächeln und auch diesmal misslang es ihm.
»Bitte verzeihen Sie meinen überraschenden Besuch…«, erklärte Fu Lingpo der immer noch fassungslosen Frau, »…aber ich muss dringend mit Ihnen sprechen.«
Die Worte schienen nicht in Alabima zu dringen. Doch nach ein paar weiteren Sekunden der Erstarrung meinte sie ebenso tot wie zuvor: »Und worüber wollen Sie mit mir reden?«
Alles Feuer schien aus der Äthiopierin gewichen, so monoton flüsterte sie die Worte, mehr zu sich selbst als zum Chinesen vor dem Eingangstor. Im Bildschirm sah sie, wie er sich kurz am Kopf kratzte und sich seine nächsten Worte zu Recht legte.
»Es ist möglich, dass Sie immer noch bedroht werden. Bitte, Misses Lederer. Können Sie mich hereinlassen? Nur für eine Minute.«
Das Vollmondgesicht versuchte es diesmal mit einer Vertrauen erweckenden Miene, die jedoch höchstens als treuherzig durchging. Ihr nächster Gedanke galt jedoch nicht ihm und seinem Wunsch, sondern ihrem Ehemann. Wenn Jules auf ihren Entführer traf, würde er versuchen, diesen umzubringen. Zu viel Hass hatte ihr Ehemann in den Wochen zuvor gegen die Gangster dieser Triade aus Hongkong ausgesprochen und zu oft von Vergeltung geredet.
»Nicht hier«, beeilte sie sich deshalb zu sagen, »und nicht jetzt.«
Der Chinese wartete geduldig auf ihre Entscheidung.
»Wir treffen uns im Café des Avenues in Lausanne, um vier Uhr, heute Nachmittag. Okay?«
»Ja, Misses Lederer, ich werde dort sein.«
Er nickte zum Abschied in die Kameralinse und wandte sich dann vom Tor ab, schlug die Richtung zur Bushaltestelle ein. Alabima stand immer noch vor der Eingangstüre, brachte ihre schwirrenden Gedanken in Ordnung. Das Zittern in ihren Fingern verschwand nach einer Weile. Sie hörte die Türe zum Garten, straffte sich und wischte zur Sicherheit noch einmal über ihre Augen, versuchte ein Lächeln. Alina stürzte aus dem Wohnzimmer in den Flur und gleich in Richtung Bad, rief ihrer Mutter ein fröhliches »ich hab gewonnen«, zu und verschwand auch schon hinter der Türe. Jules folgte der Kleinen, lächelte verschmitzt und um Verzeihung bittend.
»Sie ist nun mal ein Wildfang.«
»Wascht euch bitte«, meinte die Äthiopierin milde, »ich muss nur noch die Scampi anbraten. Dann können wir essen.«
»Ist was?«
Jules war stehen geblieben und schaute seine Frau fragend an.
»Nein, es ist nichts«, log Alabima.
»Hast du etwa geweint?«
Tapfer lächelte die Frau und meinte beruhigend: »Zwiebelschneiden.«
»Ach so.«
Endlich wandte sich Jules ab, ging seiner Tochter ins Bad nach, um sich zumindest Hände und Gesicht zu waschen. Alabima kehrte in die Küche zurück, sah nach dem Topf mit den Kohlrabi, streute eine Prise Salz über sie, schob den Deckel wieder darüber, schaltete die zweite Herdplatte mit der Bratpfanne etwas höher, ging zum Kühlschrank und holte dort den Frischkäse heraus, legte ihn neben dem köchelnden Topf hin, holte ein Brettchen und ein Messer, zupfte ein paar Blätter und Knospen von den Stängeln der Küchenkräuter im Topf am Fenster, schnitt sie auf dem Brett klein. Sie goss Öl in die Bratpfanne und es begann sogleich zu brutzeln und so schob sie die erste Ladung Scampi zischend hinein, zog eine der Holzkellen aus dem blechernen Milchtopf neben dem Herd, begann auch schon die Meerestiere zu wenden.
Die erste Portion landete auf einem frischen Teller, den sie in die Warmhaltebox unter dem Backofen stellte, etwas Öl in die Bratpfanne nachgoss und die zweiten acht Scampi hineinhob, die wenig später ebenfalls warm gestellt wurden. Sie löschte beide Herdplatten und hob den Deckel der Pfanne weg, schälte mit einem Suppenlöffel vom Frischkäse in den Topf, streifte die Kräuter vom Brettchen darüber, verband alles mit etwas Sahne und Butter aus dem Kühlschrank, würzte noch mit Muskat und weißem Pfeffer nach, schmeckte kurz ab, gab noch mehr Muskat hinzu, zupfte zuletzt noch von einem Stängel Kerbel ein paar der Astrispen ab und verteilte sie über den Kohlrabi.
Jules trat in die Küche und begann wortlos den Tisch zu decken, holte danach eine Flasche Mineralwasser aus dem Keller, füllte die Gläser.
»War jemand an der Tür?«
Seine Frage ließ Alabima zusammenzucken. Einen Moment lang blieb sie erstarrt und wie ertappt stehen, dann wandte sie sich lächelnd ihrem Ehemann zu.
»Wie kommst du darauf?«
»Der Überwachungsbildschirm war eingeschaltet.«
Die Äthiopierin versuchte, sich nichts anmerken zu lassen.
»Ach ja. Hab ich vergessen auszuschalten. Es war bloß ein Hausierer.«
»Ein Hausierer? Was wollte er den verkaufen?«
»Es war einer vom Blindenheim. Hatte alle möglichen Bürsten bei sich. Ich hab ihm gesagt, wir bräuchten keine und hätten dieses Jahr bereits gespendet.«
Jules nickte und gab sich zufrieden, begann in einer Zeitschrift mit mäßigem Interesse zu blättern. Beide hörten, wie Alina aus dem Bad kam, denn sie zog die Türe recht unsanft hinter sich ins Schloss.
»Kommst du zum Essen, Liebling?«, rief die Mutter hinaus auf den Flur.
»Eine Minute, Maman«, antwortete diese, »ich muss mich erst noch anziehen.«
Dann waren ihre patschenden Fußsohlen auf der Marmortreppe nach oben zu hören.
»Das kann dauern«, murmelte Jules über die Zeitschrift gebeugt, während Alabima das Gemüse in einer Schüssel anrichtete, noch eine Butterflocke auf die Kohlrabi legte und mit einem Deckel verschloss, sie auf den Tisch stellte, danach die warm gestellten Scampi hervorholte, sie mit etwas Meersalz und schwarzem Pfeffer aus der Mühle bestreute.
Alina kam überraschend schnell aus ihrem Zimmer herunter, setzte sich an den Tisch, zog sofort das Glas mit dem Mineralwasser zu sich hin und sog die Hälfte davon durstig und in langen Schlucken hinunter, kam dabei außer Atem.
»Das war großartig, Papa«, kommentierte sie danach den Vormittag, »wir sollten öfters Fußball spielen. Vielleicht wirst du dann auch noch etwas besser?«
Jules blickte von seiner Zeitschrift auf und legte sie dann zur Seite, schaute seine Tochter lächelnd an.
»Ich denke, wir sollten mit dem Boxunterricht beginnen«, scherzte er, »denn darin wirst du mich nicht so rasch übertrumpfen können, Alina.«
Es wurde ein richtig schönes, entspanntes Mittagessen, vor allem, weil Alina nun doch eine zunehmende Müdigkeit verspürte und auch Jules das Recken und Strecken nach den fliegenden Bällen schmerzhaft in seinen Gliedern fühlte. Vielleicht wäre ihm sonst eher aufgefallen, wie wortkarg Alabima während des gesamten Essens blieb, dass sie kaum an ihrem Gespräch teilnahm und eigentlich bloß auf Fragen antwortete.
*
Jussuf und Sheliza hatten sich auf Mor Gabriel nach wenigen Tagen eingelebt. Mit den anderen Alawiten verstanden sie sich ausgezeichnet, zu den Schiiten und Sunniten pflegten sie kaum Kontakt. Jede der moslemischen Kirchen blieb im Grunde genommen unter sich. Die christlichen Mönche und Nonnen sorgten für die notwendige Kommunikation zwischen ihnen, spielten Puffer und Schaltstelle zugleich. Sogar drei Gebetsräume waren für die Flüchtlinge eingerichtet worden. Die Sunniten hatten allerdings darauf bestanden, ihre Andachtsstätte außerhalb der geweihten Klostergebäude einzurichten, weshalb man ihnen die ehemalige Schreinerei zuwies, die etwas abseits lag. Dort hatten sie die Werkbänke und Maschinen entfernt und den Boden mit Teppichen und Matten ausgelegt. Nur auf einen Muezzin mussten die geflohenen Syrer verzichten. Denn der Ruf des Propheten zum Gebet auf dem Gelände eines christlichen Klosters wäre den Mönchen und Nonnen wohl doch unerträglich gewesen. Da halfen auch die lautstarken Proteste der Schiiten nichts. Erzbischof und Abt Timotheus blieb zumindest in diesem Punkt hart.
Sheliza war für Arbeiten in der Wäscherei und in der Klosterküche eingeteilt. Daneben konnte sie jeden Tag für wenigstens drei Stunden am Schulunterricht teilnehmen, den vor allem die Nonnen für alle Flüchtlingskinder organisiert hatten. Von den Sunniten nahm allerdings niemand daran teil. Denn dort hatte ein selbst ernannter Imam das Zepter an sich gerissen, lehrte die Kinder ausschließlich den Koran, verbat sich jede Einmischung in die Erziehung und Erbauung der moslemischen Jugendlichen durch Vertreter des Klosters, wiegelte auch die Eltern gegen den Schulunterricht der Christen auf, machte ihnen Angst vor falschen Lehren, mit denen ihre Kinder gefüttert würden.
Sheliza allerdings genoss die Schulstunden sehr. Denn Mohammed al-Barani hatte ihnen vor allem Lesen, Schreiben, Rechnen und den Koran vermittelt, später kam noch islamische Geschichte hinzu, jedoch kein einziges naturwissenschaftliches Fach. Hier auf Mor Gabriel dagegen gab es für sie Unterricht in Biologie und Physik, auch ein wenig Chemie und in Rhetorik. Eine neue, aufregende Welt tat sich für die Vierzehnjährige auf, eine Welt, für die sie noch zu jung war, als sie noch in Damaskus lebte und dort zur Schule ging und die im religiös geprägten Unterricht des Provinzortes nicht vorkam. Von der ersten Stunde an wunderte sich die junge Muslimin über die offenen Worte der Nonnen, vor allem wenn es um Biologie und damit auch um den Glauben ging, aber auch in Physik und den Glauben, ja in Rhetorik und den Glauben. Die Christen trennten diese Dinge voneinander, stellten zwar Abhängigkeiten her, zeigten gleichzeitig aber auch gerne die Grenzen der Wissenschaft auf und benannten die Vorteile des Glaubens und damit der Religionen, blieben jedoch ohne jeden Fanatismus, beharrten nicht auf ihre heilige Schrift als einzig gültige Antwort auf sämtliche Fragen des Lebens. Nein, sie abstrahierten die Worte ihres Gottes und damit im Grunde genommen die Worte aller Gottheiten, versuchten sie in einen Kontext zu den Beobachtungen und Forschungsergebnissen in der Wissenschaft zu bringen. Sie interpretierten auch die Aussagen in ihrer Bibel für sich persönlich und für sie als Schulklasse. Die Kernaussagen der christlichen Religion schienen sich allerdings nicht großartig von den zentralen Forderungen im Koran zu unterscheiden, was Sheliza anfangs sehr erstaunte.
Vor allem wenn ihnen die noch recht junge Schwester Helene, eine hagere, blauäugige, blonde und recht groß gewachsene Nonne, in Biologie ein weiteres Wunder der Erde mit klaren Worten und ohne jede religiöse Anspielung erklärte, vermisste Sheliza ihren Vater ganz besonders. Denn auch der hatte sie stets aufgefordert, selbst zu denken und so hinter die Fassade von Tradition, Geschichte und Religion zu blicken. Immer wieder mal musste sie darum Tränen der Sehnsucht nach ihren Eltern unterdrücken. Ihr Großonkel Jussuf sprach sehr einfühlsam mit ihr darüber, sagte auch ganz klar, dass sie sich keine Hoffnung machen durfte, dass ihre Eltern und ihre Geschwister ohne jeden Zweifel Opfer des unsäglichen Bürgerkriegs geworden waren. Das machte Sheliza zwar traurig. Doch hinterher hatte sie sich auch stets gestärkt gefühlt, so als würde ihr Klarheit auch Kraft verleihen. Vielleicht war es aber auch nur ihr Trotz.
In der Küche machte sich die Vierzehnjährige ebenso rasch beliebt, wie in der Wäscherei. Unermüdlich schnitt sie Kartoffeln, wrang Kleidungsstücke durch die Mangel, zerpflückte Salat und bügelte Hemden und Hosen. Die Nonnen bewunderten ihren Einsatz, lobten sie immer wieder dafür. Doch Sheliza winkte stets bescheiden ab, sprach von einer Selbstverständlichkeit, wusste längst, dass nur ein müder Körper in einen erholsamen Schlaf finden konnte und plagende Albträume abhielt. Auch Onkel Jussuf hatte ihr am dritten Tag nach ihrer Ankunft auf Mor Gabriel geraten, sich mit aller Kraft überall einzusetzen, nachdem sie in den beiden Nächten zuvor mehrmals laut schreiend aufgewacht war.
Ihre freien Stunden verbrachte Sheliza oft auf der niedrigen Mauer vor dem Torbogen, unter dem die Zufahrtsstraße zum Kloster hindurchführte. Vor dort aus hatte sie einen weiten Blick über das Land, bis fast zur Grenze nach Syrien, wie sie sich zumindest vorstellte. Die Hügel und Senken, Berge und Täler luden zum Träumen ein, weckten Sehnsüchte, nach Freiheit und nach Weite, aber auch nach der Fremde. Was band sie noch an die Stätten ihrer Heimat? Wenn sie an Damaskus dachte, erinnerte sie sich noch an ihre Wohnung und an verschiedene Nachbarn, auch an Klassenkameradinnen und einige Lehrer. Doch all das lag bereits zu weit in ihrer Kindheit zurück, als dass sie sich noch mit ihnen verbunden fühlte. Und al-Busayrah? In dieser Stadt starben ihre Eltern, ihre Brüder und Schwestern und weitere Verwandte und Freunde. Nichts konnte sie jemals zurück zu diesen Barbaren bringen, zu diesen Fanatikern, wo die Schiiten wohl zuerst nach der Hisbollah riefen und die Sunniten darum die Dschihadisten und damit den Tod in ihre Gemeinschaft brachten. So jedenfalls hatte es Onkel Jussuf ihr erklärt.
Die Vierzehnjährige spürte, dass nicht nur das erlebte Schreckliche, sondern auch die Umgebung des christlichen Klosters, die Offenheit der Nonnen und Mönche, ihr großes Wissen um die Welt und ihr tiefer Glaube ohne jeden Fanatismus, einen immer stärkeren Einfluss auf sie ausübte. Das spürte sie vor allem in ihren Gesprächen mit ihrem Großonkel, denn der sah sie immer öfters überrascht und auch ein wenig misstrauisch an, fühlte wohl auch die starke Wandlung in seiner Großnichte, wusste wohl noch nicht, wie er darauf reagieren sollte.
»Ziemlich schräg, was die alte Schachtel uns heute vorgeschwindelt hat.«
Die Stimme ließ Sheliza erschrocken herumwirbeln. Sherif stand hinter ihr, kaum vier Schritte entfernt, musste sich leise an sie herangeschlichen haben. Sie blickte in ein grinsendes, hübsches Jungengesicht, das ein wenig wild auf sie wirkte. Sherif war zwei Jahre älter als sie, besuchte trotzdem dieselben Schulstunden, kam mit dem Stoff nicht wirklich zurecht. Der junge Sunnit kümmerte sich jedoch kaum um Fortschritte, machte selten die Hausaufgaben mit der notwendigen Ernsthaftigkeit, glaubte wohl, sich durch sein weiteres Leben schummeln zu können. Gestern hatte er damit geprahlt, dass sein Vater ein reicher Kaufmann aus Aleppo wäre, keiner dieser armen Seifenkocher, sondern ein Großhändler, der mit Europa und den USA Geschäfte machte, im ganz großen Stil. Er erzählte auch von ihrer Villa, von dem halben Dutzend Bediensteten, vom Luxus, den er gewohnt wäre. Was davon Wahrheit und was Lüge war, wusste Sheliza nicht zu sagen. Doch dieser Sherif hatte von Anfang an einen seltsam neuen Reiz auf die Vierzehnjährige ausgeübt. Vielleicht lag es an seinem selbstsicheren, ja prahlerischen Auftreten? Oder doch an seinem überaus hübschen Gesicht mit den dunklen Locken und den beinahe schwarzen, tiefgründigen Augen? Er war einen ganzen Kopf größer als sie, überragte auch alle anderen Schüler in ihrer Klasse, war schlank und wirkte drahtig, war bestimmt ein guter Sportler.
Sheliza senkte ihre Augen nicht, blickte Sherif direkt in die seinen, als müsste sie sich mit ihm messen, als wollte sie seiner Willenskraft entgegentreten und standhalten.
»Was schaust du mich so deppert an?«, maulte der sunnitische Junge, »und warum beantwortest du meine Frage nicht?«
Ungeduld war aus seiner Stimme zu vernehmen, Ungeduld und eine gewisse Herablassung. Doch Sherif war zu ihr gekommen, hatte sie wohl auf der Mauer sitzen sehen, hatte sich herangeschlichen, um sich mit ihr zu unterhalten. Er war der Suchende, nicht sie. Sheliza fühlte, wie ihre Selbstsicherheit anwuchs, trotz des Jungen, trotz dem vielen Geld seiner Eltern.
»Ich finde, Bruder Cornelius hat uns das mit den schiefen Ebenen sehr klar und verständlich erklärt.«
Das Grinsen von Sherif wurde impertinent.
»Du hast die Pointe wohl nicht mitbekommen? Schiefe Ebene und ziemlich schräg. Kapiert?«
»Ach so«, antwortete ihm Sheliza gleichgültig, »das hast du gemeint.«
Beide schwiegen, sahen einander an, der sunnitische Junge mit zunehmendem Unbehagen, das er keinesfalls nach außen zeigen wollte, das alawitische Mädchen mit der Gewissheit, die Fäden ihrer Unterhaltung fest in ihren Händen zu halten. Darum drehte sie sich auch recht gleichgültig von ihm ab, blickte wieder in die Ferne, zum Horizont hinüber, in dessen Nähe die Sonne an diesem späten Nachmittag immer rascher hin kroch.
»Ich hab dich in der Küche gesehen. Du bist ziemlich geschickt«, nahm Sherif ihre Unterhaltung erneut auf. Sheliza schaute weiterhin geradeaus, hob bloß stumm ihre schmalen Schultern an, ließ sie wieder sinken.
»Ich mein mit dem Messer«, ergänzte der Junge ein wenig unbeholfen.
Sie schwiegen beide, sahen hinüber zum blendenden Ball der Sonne, der das Land in ein zunehmend warmes Licht tauchte und die Abenddämmerung einläutete.
»Darf ich mich zu dir hinsetzen?«
Das Herz von Sheliza machte einen Hüpfer, ob vor Freude oder bloß vor Aufregung, konnte die Vierzehnjährige auch hinterher nicht sagen. Doch sie nickte stumm und der Junge setzte sich neben sie hin, schwang dann seine Beine über die niedrige Mauer, stieß dabei mit seinem Rücken unsanft an ihre linke Schulter.
»’tschuldigung«, murmelte er, aber sie winkte ab, »is’ nix.«
Beide starrten auf den Hügelzug vor ihnen, hinter dem sich dunkle Berghänge erhoben, deren Flanken bereits im Schatten der untergehenden Sonne standen. Was Sherif dabei fühlte, konnte Sheliza nicht wissen. Ihr Herz dagegen pochte hart und laut und sie hatte Angst, dass dieser Junge das wilde Klopfen womöglich hören konnte. Sie wollte sich zur Ruhe zwingen, doch das funktionierte nicht, ganz im Gegenteil. Die Hände wurden ihr feucht und sie wischte sie rasch an ihrem Rock ab.
»Schon Scheiße, das mit dem Krieg«, warf Sherif ein neues Thema auf.
»Ja, große Scheiße«, meinte Sheliza und blickte kurz zu ihm hinüber, sah in sein Gesicht, lächelte ein wenig verschämt und drehte ihren Kopf rasch wieder weg.
»Du bist mit deinem Vater hier?«
»Mein Großonkel.«
»Und deine Eltern?«
Die Vierzehnjährige antwortete nicht, fühlte, wie sich ihre Augen mit Tränen füllen wollten, schniefte kurz, kniff die Augen zusammen, unterdrückte die Regung.
»Wahrscheinlich sind sie tot.«
Ihre Worte klangen so schlicht, so klar und ohne Emotionen. Sie sollten den wahren Sturm ihrer Gefühle verbergen, ihrem Drang nicht nachgeben, laut aufzuschreien und diese Welt mit all ihrer Bösartigkeit zu verurteilen, ja, den Tod selbst anzuklagen und die Ungerechtigkeit des Lebens zu verfluchen.
»Das tut mir leid.«
Ihr aufgewühlter Trotz verflog mit seinen Worten, machte ihren Tränen nun endgültig Platz. Sie schluchzte laut auf und schlug die Hände vor das Gesicht, bedeckte ihre Augen, drehte sich auch von ihm weg und beugte ihren Kopf, spürte das Zittern am ganzen Körper, durfte endlich ganz Kind und verzweifelt sein.
Erst mit Verspätung fühlte sie seine Hand auf ihrem Rücken, wie sie zu trösten versuchte. Sie schüttelte sie sofort ab, bedauerte das gleich darauf auch schon.
»Ich wollte dich nicht…«
Seine unbeholfen ausgesprochene Entschuldigung ließ sie wieder Kontrolle über ihre Gefühle erlangen. Rasch wischte sie mit den Ärmeln die feuchten Augen trocken und sie schniefte auch zweimal. Dann drehte sie sich ihm zu.
»Ist schon gut…«
Sie schluckte noch einmal, hart und tapfer, sah dann wieder weg, hinaus auf die Ebene und in die untergehende Sonne.
»Das Leben ist nicht gerecht.«
»Nein«, pflichtete sie ihm traurig zu, »das ist es nicht.«
Sein Name ertönte laut vom Kloster her. Er drehte sich zur Stimme um, winkte ihr kurz und beruhigend zu.
»Ich muss gehen…«
Sie schwieg und er blieb unschlüssig neben ihr sitzen.
»Wenn ich etwas…?«
»Nein.«
Er schwang seine Beine wieder über die Mauer, diesmal darauf bedacht, sie nicht zu berühren. Dann hüpfte er herunter, blieb jedoch noch stehen.
»Ich mag dich. Du bist hübsch.«
Sie blickte ihn nicht an, starrte weiterhin zum Horizont hinüber und in das zunehmend orange Licht, nahm ihn vielleicht gar nicht mehr wahr oder tat wenigstens so.
»Du bist so anders…«, fügte er hinzu und musste wohl erst noch darüber nachdenken, was denn so Besonderes an diesem Mädchen war. Doch dann sah und wusste er es auf einmal und so ergänzte er leise, »…so stolz.«
Er sah nicht die wiederkehrenden Tränen in ihren Augen, sah nur, wie sich ihr Rücken und Nacken versteifte und wie sie zu zittern anfing. Sherif trat einen Schritt zur Seite, betrachtete ihre kecke Nase mit dem leichten Schwung nach oben, ihr schmales Kinn mit dem seidigen Flaum, ihr fast schwarzes, linkes Augen, dessen Pupille im Licht des Abendrotes Orange flimmerte.
Ein weiteres Mal wurde er vom Kloster gerufen, drängend und zornig.
»Also … ich muss.«
Sie reagierte nicht, sah weiterhin stur geradeaus.
Sherif wandte sich endgültig ab, verließ sie und ging mit eiligen Schritten zurück zu den Gebäuden, die in flammenden Farben standen. Er überlegte, wie alt dieses stolze, alawitische Mädchen wohl sein mochte. War sie in seinem Alter? Nein, dafür sah sie noch zu kindlich aus. Sie konnte höchstens fünfzehn sein. Oder sogar noch ein Jahr jünger. Sheliza war ihr Name, das hatte er längst erfahren.
»Sherif und Sheliza.«
Die beiden von ihm geflüsterten Namen klangen fast wie ein Versprechen.
*
Als Alabima zum Café des Avenues kam, sah sie durch die Schaufensterscheibe Fu Lingpo an einem der Tische und vor einer Tasse sitzen. Auch er hatte sie längst entdeckt, versuchte ein Lächeln, sah wenig glücklich und eher verlegen aus. Die Äthiopierin zog einen den Flügel der Glastür auf und trat ein, zog sie rasch hinter sich zu, um nicht zu viel Kälte hinein zu lassen. Während sie dem Tisch mit dem Chinesen zustrebte, öffnete sie ihren Wollmantel, streifte ihn von den Schultern, legte ihn über die Rückenlehne von einem der freien Stühle und setzte sich auf den daneben. Dabei starrte sie ihren Entführer die ganze Zeit lang an, abwartend und angriffslustig, zornig und unsicher zugleich. Als er keine Anstalten machte, irgendetwas zu sagen, ergriff sie das Wort.
»Was wollen Sie von mir? Warum sind Sie mir hierher gefolgt?«, herrschte sie ihn auf Englisch an.
Die Bedienung kam und Alabima musste sich einen Moment lang von Fu Lingpo abwenden, bestellte sich einen Pfeffermünztee.
»Im Glas oder eine Portion in der Kanne?«
Die Äthiopierin hatte längst wieder den Chinesen fixiert, wurde durch die Frage der Angestellten aufgeschreckt.
»Äh, im Glas. Nur ein Glas, bitte.«
Lingpo lächelte. Er sprach zwar kein Französisch, doch das Mienenspiel der dunkelhäutigen Frau hatte ihm wohl ihre Verunsicherung verraten.
»Ich bin hier, um sie zu beschützen, Madame.«
»Beschützen? Ich brauche keinen Schutz.«
Sie zischte diese Worte leise über den Tisch hinweg, damit niemand sonst im Lokal sie mitbekam.
»Aber, Madame, Sie und Ihre Tochter sind immer noch in Gefahr.«
Alabima schüttelte ablehnend den Kopf.
»Sie vergessen, dass ich wieder zu Hause bin. Und Sie haben wohl verdrängt, wie mein Ehemann mit Ihren Gangsterkollegen in Hongkong umgesprungen ist?«
»Das waren keine Leute von uns, Madame, mit den Brüdern de Smet hatte ich nichts zu tun. Die gehörten zur Yueh-Sheng-Triade, nicht zu uns Tongs. Bitte werfen Sie mich nicht in den gleichen Topf mit diesen Tieren.«
»Aber ich brauche keinen Schutz, ganz bestimmt nicht.«
»Und was ist mit diesem Jean-Robert Babtiste?«
Das Blut schien mit einem Schlag aus dem Gesicht der schönen Äthiopierin gewichen zu sein. Scharf hatte sie eingeatmet, ihre Augen erstaunt und erschrocken geweitet. Alabima war über die Nennung des Namens ihres früheren Liebhabers so sehr überrascht, dass sie nicht gleich antworten konnte.
»Ich hab ihn um Ihr Haus schleichen sehen. Er hat sie beobachtet. Mit einem Feldstecher. Deshalb wurde ich neugierig und bin ihm bis zu seiner Wohnung gefolgt. Kennen Sie ihn?«
Dem Chinesen war die Bestürzung der Äthiopierin selbstverständlich nicht entgangen. Sie musste diesen Kerl mit Namen kennen und es war ihr höchst unangenehm.
»Ist er ein Stalker? Hat er Sie bedroht?«
Als ihm die Frau nicht antwortete, er in ihrem Gesicht jedoch die rasenden Gedanken las, wie sie nach einem Ausweg suchten, kam ihm ein anderer Verdacht.
»Er war Ihr Liebhaber?«
Alabima schluckte hart und sah Lingpo fest und prüfend in die Augen, erkannte darin eine starke Zuneigung, aber auch ein grenzenloses Verständnis. Und so nickte sie stumm, aber zustimmend.
»Es war ein riesiger Fehler von mir. Und es ist lange her…«, versuchte sie eine Rechtfertigung, doch der Chinese winkte beruhigend ab.
»Sie hatten bestimmt Ihre Gründe. Eine Frau wie Sie hat immer gute Gründe für ihr Handeln. Ich verurteile Sie nicht.«
Die Äthiopierin wusste seine Worte nicht einzuordnen. Überhaupt kam ihr diese Begegnung in diesem Café in Lausanne so unwirklich vor. Träumte sie etwa? Nein, der Morgen, der Mittag, alles war real gewesen. Also saß sie nun mit ihrem Entführer aus Hongkong hier an diesem Marmortisch an der Avenue de Jurigoz 20, bekam ihren Tee serviert, starrte in zwei treu blickende Augen und auf einen Mund, der sie immer wieder ohne Erfolg freundlich anzulächeln versuchte. Wie nannte er sich am Bildschirm? In Hongkong hatte er ihr den Namen Chang Lee genannt, ihr seinen wahren Namen verschwiegen. Etwas mit Fu und Po, erinnerte sie sich, wollte sich dem Chinesen jedoch erklären.
»Ich erkannte rasch, was für ein falscher Hund Jean-Robert ist. Er nutzte mich auf das schändlichste aus und beschmutzt mich. Doch er ist schon vor zwei Jahren und für immer aus meinem Leben verschwunden.«
»Ihn plagen wohl Geldsorgen, Madame. Ich befürchte, er wird versuchen, Sie zu erpressen.«
»Das wollte er schon einmal. Doch ich konnte ihm das rasch ausreden.«
Der Chinese blickte sie nach dem Wort ausreden neugierig an, als erwartete er eine weitere Erklärung. Doch sie schwieg.
»Wenn Sie wollen, dann kümmere ich mich um ihn?«
Alabima schaute den Chinesen scharf an.
»Und mit kümmern meinen Sie?«
Fu Lingpo zuckte als Antwort nur mit den Schultern und die Äthiopierin schüttelte ablehnend den Kopf.
»Nein.«
Das Wort sollte ein Befehl sein, doch der Chinese lächelte sie bloß unbestimmt an.
»Warum sind Sie mir in die Schweiz gefolgt?«, wiederholte sie ihre Frage von vorhin, »und seit wann sind Sie hier, dass Sie Jean-Robert beobachten konnten? Wann war das?«
Der Chinese versuchte seine rechte Hand beruhigend auf ihre linke zu legen, doch sie zog sie rasch weg, verbat sich damit jede Vertraulichkeit. Er starrte einen Moment lang enttäuscht auf die leere Stelle auf der Tischplatte, auf dem ihre Hand zuvor lag, blickte sie dann wieder an.
»Ich bin seit knapp vier Wochen hier. Und vor etwas über zwei Wochen stieß ich auf diesen Stalker.«
»Stalker?«
»Er hat sie vom Hügel aus beobachtet, als sie im Garten arbeiteten. Und auch, als Sie mit Ihrer Tochter im Pool schwammen.«
Alabima schluckte leer. Selbstverständlich konnte man von den Hügeln aus ihr Grundstück am See einsehen. Und bestimmt wurde sie immer wieder von Leuten aus der Umgebung bespitzelt. Sie war eine äußerst attraktive Frau und es gab genügend Gerüchte im Dorf über die seltsam zusammengewürfelte, wohlhabende Familie in der großen Villa. Dass jedoch ihr früherer Liebhaber und Möchtegern-Erpresser sie durch einen Feldstecher ausspionierte, ihren Körper angaffte, ihre Kurven nicht nur von Weitem erblickte, sondern genau wusste, wie sie sich anfühlten, wie geschmeidig und lasziv sie sich bewegen konnten, berührte sie höchst unangenehm. Und einen Moment lang überlegte sie, ob sie den Chinesen nicht doch auf Jean-Robert Babtiste hetzen sollte, verwarf den Gedanken jedoch gleich wieder.
»Dieser Babtiste wird es nicht wagen, mich zu erpressen.«
»Nein, das wird er nicht«, meinte der Chinese mehrdeutig und erntete erneut einen skeptisch-fragenden Blick der Frau.
»Ich will nicht, dass Sie etwas in dieser Angelegenheit unternehmen. Ist das klar?«, zischte sie ihn an.
Fu Lingpo nickte: »Ich nehme ihren Entscheid zur Kenntnis.«
Mehr sagte er nicht.
»Und wie soll es nun weitergehen? Wollen Sie noch lange hier in der Schweiz bleiben? Ich brauche keine Hilfe. Und ich will auch keine, verstehen Sie?«
Diesmal nickte der Chinese und blickte sie unterwürfig an.
»Ich verstehe, dass Sie nichts mit mir zu tun haben wollen, Madame Lederer. Doch ich werde nicht gehen…«
»Aber warum?«, Alabima schien ratlos, »Sie haben sich doch nicht etwa in mich verliebt? Das hätte keinerlei Sinn, verstehen Sie? Ich bin glücklich verheiratet, habe eine Tochter und einen Sohn. Mein Leben ist großartig, so wie es ist…«
Sie verstummte unbestimmt, denn der Chinese nickte kummervoll und beruhigend zugleich.
»Selbstverständlich, Madame, machen Sie sich bitte keinerlei Sorgen. Ich will bloß eine Zeit lang in Ihrer Nähe bleiben und Sie und Ihre Tochter beschützen, falls nötig.«
»Ich brauche keinen Schutz, Mister…?«, sie sah ihn nun doch fragend an und er antwortete: »Lingpo, mein Familienname lautet Lingpo, mein Vorname Fu«.
»Ich brauche wirklich keinen Schutz, Mister Lingpo.«
Diesmal waren ihr die Worte scharf und viel zu laut herausgerutscht und einige der Gäste drehten ihr Gesicht neugierig in Richtung ihres Tisches. Das sah allerdings nur Fu Lingpo, denn Alabima drehte ihnen den Rücken zu. Doch die Äthiopierin spürte wohl die fremden Augen auf sich ruhen, denn sie biss ihre Zahnreihen so hart aneinander, dass sich die Kiefermuskeln deutlich unter der Haut abzeichneten.
»Madame, Sie können mich nicht wegschicken. Bitte finden Sie sich mit meiner Anwesenheit ab. Ich werde Sie auch nicht weiter belästigen. Höchstens, wenn ich erneut eine Gefahr erkenne, vor der ich Sie warnen muss.«
Alabima schüttelte verneinend ihren Kopf, voller Unwillen und Unverständnis. Doch sie wusste nicht, was sie noch an neuen Gründen hätte anführen können.
»Was haben denn Ihre Gangsterkollegen gesagt, nachdem Sie mich einfach so freiließen?«, sprach sie dann doch noch einen Gedanken aus, der sie seit Wochen beschäftigte.
Diesmal lächelte der Chinese wenig glücklich.
»Sie wollten mich umbringen, selbstverständlich.«
Er sprach nicht weiter.
»Und?«, fragte sie deshalb nach.
»Sie ließen mich später dann doch laufen.«
»Warum?«
Die Brutalität dieser Frage war weder der Äthiopierin noch dem Chinesen bewusst.
»Ich habe meinen Bossen von Ihnen erzählt, Madame.«
Alabima wurde aus seinen Worten zwar nicht schlau, doch sie drang nicht weiter auf diesen seltsamen Asiaten ein. Jules hatte ihr einiges über die Mentalität chinesischer Gangster erzählt, das der Stolz und die Ehre für viele von ihnen alles bedeuteten und dass innerhalb einer Triade strenge moralische Richtlinien gelten würden, dass ihre Mitglieder in der Regel lieber in den Tod gingen, als ihre Kameraden zu verraten, dass sie ihre Art von Ehre mit einer zwar eigenwilligen Moral verbinden und daraus wohl ihren sonderbaren Stolz ableiteten, der sie untrennbar miteinander verband und auf diese Weise ein starkes Bollwerk gegen die Staatsmacht und gegen konkurrierende Banden schuf. Alabima glaubte deshalb zu spüren, warum dieser Fu Lingpo freikam und warum er in die Schweiz reiste. Denn als er sie damals laufen ließ, verstieß er zwar gegen den Ehrenkodex seiner Bande, hatte sich also gegen die Moral der Triade gestellt. Doch er hatte sich für Barmherzigkeit entschieden, die sich nicht wirklich gegen seine Triade, sondern nur gegen das höchst undankbare Schicksal einer Frau mit ihrer Tochter richtete, die ohne eigene Schuld in Todesgefahr geraten war.
»Es ist Ihnen also klar, dass ich keinerlei Hilfe von Ihnen möchte?«
Fu Lingpo nickte.
»Und ich will sie nirgendwo in der Nähe meiner Familie sehen.«
Wiederum das stumme Nicken, beinahe unterwürfig. Alabima schüttelte verständnislos den Kopf: »Das führt doch zu nichts? Sie vergeuden bloß Ihre Zeit.«
Er lächelte sie still an, schien dabei gar nicht unglücklich, ganz im Gegenteil.
Alabima kramte entschlossen aus ihrer Handtasche die Geldbörse hervor, zog daraus einen Zehner und legte ihn auf den Tisch neben das unberührte Glas Tee, stand auf und packte ihren Mantel, schlüpfte hinein und knöpfte ihn zu. Fu Lingpo hatte ihr wortlos zugeschaut, hatte keine Anstalten gemacht, sie vom Gehen abzuhalten oder aufzustehen und ihr in den Mantel zu helfen, war einfach sitzen geblieben und betrachtete sie stumm, vielleicht so, wie man fasziniert einem Tiger im Zoogehege zusah, wie er sich geschmeidig erhob und sich mit langsamen, aber wuchtig-kraftvollen Schritten entfernte, ein Kunstwerk der Natur, nicht zum Anfassen, nur zum Anstaunen.
»Also.«
Das war ihr Abschiedsgruß, bevor sie sich vom Tisch abwandte und das Lokal verließ. Fu Lingpo blickte ihr nach, soweit er sie auf dem Gehsteig mit seinen Augen verfolgen konnte, bemerkte nicht die Bedienung, die zu seinem Tisch trat, ihn fragend ansah und als er nicht reagierte, den Geldschein und das noch volle Glas Wasser mit dem Teebeutel daneben achselzuckend abräumte.
*
»Bin ich hier richtig? Auf dem Fundbüro für verlorene Kleidungsstücke?«
Sherif trat grinsend und mit einem gut gefüllten Wäschekorb auf den Armen in den schwül-warmen Kellerraum, wo die Maschinen ihre nassen Lasten wild herumwirbelten und die nach Waschmittel duftende, feuchte-schwüle Luft durch das laute Summen und Kreischen, Poltern und Scheppern zu vibrieren schien. Sheliza blickte von einem der Trockner hoch, aus dem sie gerade Wollsachen heraus und in einen Zuber schaufelte.
»Stell den Korb dort auf den Sortiertisch, Sherif«, meinte die Vierzehnjährige bestimmt, zeigte auf das Möbelstück und blies sich eine vorwitzige Haarlocke aus dem Gesicht, »ich teil sie gleich anschließend auf die nächsten Maschinen auf, sobald ich hier fertig bin. Sind auch sämtliche Stücke markiert? Wenn nicht, dann bring doch gleich die Wäschemarken an. Die Gelben. Du weißt, wie das geht?«
Der Sechzehnjährige war das erste Mal mit der dreckigen Wäsche aus dem sunnitischen Gebäudeteil unterwegs. Wahrscheinlich hatte er seinen bisherigen Küchendienst mit Omar getauscht, der sonst immer die schmutzigen Kleidungsstücke hinunterbrachte. Neben Sheliza arbeiteten an diesem Tag noch zwei weitere Frauen aus ihrem Wohnblock hier, denn der Frondienst in der Wäscherei war den Alawiten übertragen worden, während die Sunniten zunehmend die Küche übernehmen mussten und die Schiiten zusammen mit den Mönchen und Nonnen die Gärten und Felder bestellten, den Hof kehrten oder Ernten einbrachten. Diese Aufteilung hatte sich aufgrund der Menge an Arbeit und der Anzahl der Hände als höchst nützlich erwiesen. So schloss man mögliche Reibereien zwischen den verschiedenen islamischen Glaubensrichtungen weitgehend aus und konnte zudem die Verantwortung klar zuweisen. Nora und Estephania, wie die beiden Alawitinnen hießen, sahen den jungen Sunniten neugierig und gar nicht feindselig an. Sie hatten bereits vor Tagen bemerkt, dass nicht nur dieser Junge aus dem Westflügel Interesse an ihrer kleinen Prinzessin zeigte, sondern Sheliza seinen Annäherungsversuchen nicht abgeneigt schien. Vor allem die zweiundvierzig Jahre alte Nora hatte mit der Vierzehnjährigen daraufhin gesprochen und sich dabei nicht etwa als Ersatzmutter aufgespielt, sondern sich als Freundin angeboten, hatte Sheliza von ihren eigenen Irrungen und Verwirrungen in der Liebe erzählt, als sie noch jung und unerfahren war. Sheliza stellte ihr kluge und recht erwachsene Fragen, wollte mehr über die damaligen Gefühle der heute dreifachen Mutter wissen. Vielleicht lag es am Krieg, vielleicht an der offenen Erziehung ihrer Eltern. Doch die Vierzehnjährige war in ihrer Entwicklung viel weiter als die meisten Gleichaltrigen, hatte bereits viel über die Liebe nachgedacht, sich auch Fragen über das Leben und den Sinn gestellt. Nun bekam sie von Nora endlich Antworten, die sie wie Medizin aufnahm und verinnerlichte.
Überhaupt hatten die Frauen ihrer kleinen, alawitischen Flüchtlings-Gemeinschaft längst das heikle Thema einer Liebesbeziehung zwischen den beiden muslimischen Jugendlichen untereinander besprochen, ohne Wissen von Sheliza selbstverständlich und vor allem ohne Wissen der Männer. Die Mehrheit von ihnen hatte ihren vorläufigen Segen erteilt. Denn wie sollte Syrien jemals wieder zur Ruhe kommen, wenn die Menschen aus den verschiedenen Glaubensrichtungen sich feindlich gegenüberstanden und ihre natürlichen Gefühle füreinander durch Dritte unterbunden wurden? Die Frauen wollten selbstverständlich strickte über die Keuschheit von Sheliza wachen. Doch ein Gespräch, ein Kennenlernen, musste ganz einfach drin liegen. Andernfalls würde es auch für ihr Land keine Zukunft geben.
»Ich weiß schon wie. Keine Sache«, hatte Sherif leichthin die Frage von Sheliza beantwortet und die Kunststoffpistole mit dem eingelegten Streifen Plastikbändern vom Tisch aufgenommen und danach ein Wäschestück nach dem anderen aus dem Korb gefischt, nach einem bereits vorhandenen Button abgesucht und bei seinem Fehlen einen neue gelben daran befestigt. Auf diese Weise würden alle sunnitischen Kleidungsstücke auch wieder in ihrem Gebäudeflügel landen und dort nach den zusätzlich gestickten oder mit wasserfester Tinte gekritzelten Namenskürzeln verteilt werden.
Estephania blinzelte Nora zu, die ihre Augenbrauen kurz hob und zurück lächelte. Aus den Augenwinkeln behielten sie vor allem den Jungen im Blickfeld, freuten sich an seinem gespielt stolzen und überlegenen Auftreten, das seine Verlegenheit aber nicht verbergen konnte. Die beiden Alawitinnen dachten zurück an ihre eigene Jugend, als für sie die ersten zarten Banden eingefädelt wurden, als sie ihr erstes Gespräch unter vier Augen mit ihrem späteren Ehemann führten, als er sie das erste Mal zärtlich mit seiner Hand berührte. Wie schön waren doch das Leben und die Liebe, vor allem, wenn sie noch so frisch und unverbraucht waren.
Sherif hatte den Korb geleert und blieb unschlüssig neben dem Sortiertisch stehen, sah auf den schmalen Rücken von Sheliza. Sie trug an diesem Tag einen farbenprächtigen, dünnen Wollpullover und weite, khakifarbene Hosen. Sie richtete sich in diesem Moment mit dem vollen Zuber auf und trat zu einem anderen Tisch, wohl um die Sachen nach den farbigen Buttons zu sortieren und danach zusammen zu falten, auch gleich die Socken der Farbe und nach den gestickten Zeichen ineinander zu stülpen. Als sie an Sherif vorbeiging, schenkte sie ihm ein warmes Lächeln, das auch Nora und Estephania nicht entging, blies erneut ihre kecke Haarsträhne aus dem erhitzten, geröteten Gesicht. Die beiden Alawitinnen taten so, als hätten sie nichts bemerkt, arbeiteten weiter, schauten aber immer wieder zu Sherif hinüber, der ihnen nun einen raschen, irritierten Blick zuwarf, so als wollte er sicher gehen, dass sie nicht zuhörten.
»Äh, was ich dich fragen wollte…«, wandte er sich direkt an die Vierzehnjährige, »was machst du eigentlich heute Nachmittag?«
Sheliza blickte von ihrer Sortierarbeit auf und sah den Jungen nachdenklich an.
»Heute Nachmittag haben wir zwei Stunden Biologie bei Schwester Helene, von zwei bis vier. Warum nimmst du eigentlich nicht daran teil?«
Sherif wirkte nun verlegen und wie ertappt, druckste auch ein wenig herum, bevor er ihr antwortete.
»Meine Mutter will nicht, dass ich den Nonnen zu viel zuhöre. Sie vertreten nun mal die falsche Religion, den falschen Glauben. Und was können die uns schon beibringen, außer ein ebenso falsches Wissen?«
Die Stirn von Sheliza hatte sich bei seinen Worten gekräuselte und ihre Augen hatten angriffslustig zu funkeln begonnen.
»Wir lernen hier die Welt kennen, Sherif. Das ist doch eine großartige Chance für uns? Jedenfalls für mich, wo ich doch gezwungen war, die letzten beiden Jahre auf dem Land in einem Dorf zu verbringen, wo wenig mehr als der Koran gelehrt wurde. Doch wie sollen wir uns Menschen und die Erde jemals begreifen, wenn wir die Naturgesetze nicht kennen und verstehen?«
»Der Koran gibt uns auf jede Frage die Antwort«, mäkelte er an ihrer Aussage herum.
»Aber ist es auch immer die richtige?«, stellte sie ihre Sicht der Dinge klar.
»Selbstverständlich«, erwiderte der Junge sogleich, »denn ohne die Güte Allahs gäbe es uns Menschen doch gar nicht.«
Seine Worte klangen nicht etwa angriffslustig, sondern versöhnlich und sorgsam darauf bedacht, nicht weiteres Öl der Zwietracht in den plötzlich entstandenen, brennende Graben zwischen ihnen zu gießen.
»Doch es sind immer Menschen, welche die göttlichen Geboten und Gesetze interpretieren. Wie kannst du wissen, dass wir die Worte des Propheten überhaupt verstehen und begreifen können?«
Der Fünfzehnjährige wusste keine Antwort oder er hatte Angst vor einem handfesten Streit mit ihr. Jedenfalls zuckte er unschlüssig mit den Schultern.
»Lassen wir das lieber. Das führt eh zu nichts.«
Sheliza wirkte nun betrübt und wandte sich wieder ihrer Arbeit zu, vielleicht, weil Sherif einer weitergehenden Diskussion auswich, vielleicht aber auch, weil sie in diesem Moment erkannt hatte, dass dieser blenden aussehende und um ein oder zwei Jahre ältere Junge ihr in geistiger Hinsicht wohl kaum das Wasser reichen konnte. Wie aber sollte eine Liebe zwischen Menschen funktionieren, die sich nicht ebenbürtig waren?
»Und später?«
Seine Frage riss sie aus ihrem plötzlichen Gedankengang.
»Später? Ich werde mir auf jeden Fall wieder den Sonnenuntergang betrachten.«
»Auf der Mauer?«
»Ja.«
»Ist gut.«
Sherif verließ sie nun, ging fröhlich pfeifend davon, schien höchst zufrieden mit der Aussicht, Sheliza spätestens am Abend an der Mauer wieder zu sehen. Als sein Pfeifen im Kellerraum nicht mehr zu hören war, wandte sich die Vierzehnjährige an Nora und fragte sie direkt, was sie denn von Sherif hielte.
»Ich denke, er ist anständiger, als man auf den ersten Blick vermuten mag. Denn im ersten Moment wirkt er ausgesprochen überheblich und furchtbar von sich eingenommen. Doch sobald er mit dir spricht, da zeigt er seine Sensibilität, sein Feingefühl. Er hatte sogar richtig Angst davor, mit dir in Streit zu geraten. Das hast du doch auch bemerkt?«
»Vielleicht ist er aber auch nur ausgesprochen dumm?«, vermutete Estephania und erntete für diese Bemerkung von Nora und von Sheliza einen bösen Blick. Sie fuhr darum entschuldigend fort, »ich mein doch nur. Wenn sich ein so junger Mann einzig auf den Koran festlegen lässt…?«
»Ach, Estephania«, meinte da Nora, »dem Jungen haben doch alle Säfte in seinem Gehirn gekocht, vor lauter Aufregung. Der konnte gar nicht mehr geradeaus denken.«
Beide Frauen und auch das Mädchen lachten nun laut los, konnten sich kaum mehr beruhigen. Die Zweifel in Sheliza waren mit dieser gemeinsamen Fröhlichkeit wie weggewischt.
*
Seine Putzfrau fand ihn am nächsten Morgen in der zum Salon hin offenen Küche der 2,5-Zimmer-Wohnung im dritten Stock der Rue de la Tour 19. Erst schrie sie laut auf, dann trat sie doch neugierig und besorgt zugleich näher und betrachtete sich das blutleere, wächserne Gesicht des Toten. Sie rief vom Festnetzanschluss die Polizei an. Drei Beamte trafen wenige Minuten später ein, zeigten ernste und besorgte Gesichter, untersuchten den Toten kurz, boten nach erstem Augenschein das Morddezernat auf. Neben einem Kommissar und noch mehr Polizisten rückte auch die Spurensicherung mit zwei Mann an. Fotos wurden geschossen, Fingerabdrücke und Gen-Proben zusammengetragen. Rasch wurde klar, dass sich der Mörder gut vorbereitet hatte, denn es fanden sich am Ermordeten keine fremden Spuren, wenn man vom Hanfstrick um seinen Hals einmal absah. Jean-Robert Babtiste hatte sich ohne Zweifel gewehrt, wie die Schrammen und Blutergüsse an seinen Händen und Unterarmen auswiesen. Denn bei einer Körpergröße von eins fünfundachtzig wog der Tote bestimmt fünfundsiebzig Kilogramm und sein Körper wirkte trainiert und fit. Doch unter seinen Fingernägeln fanden sich keine Hautreste oder Fusseln von Kleidungsstücken, waren blitzsauber. Entweder war sein Mörder äußerst Geschickt vorgegangen oder er hatte dem Toten hinterher eine gründliche Maniküre verpasst.
Die Untersuchung des Ermordeten ergab aufgrund der partiellen Leichenstarre und den rund zwanzig Grad Zimmertemperatur einen geschätzten Todeszeitpunkt zwischen Mitternacht und sechs Uhr morgens. Über die Befragung der Nachbarn und anderer Hausbewohner ergaben sich keine konkreten Hinweise auf den oder auf die Täter oder auf den exakten Zeitpunkt.
Eine junge Frau wollte allerdings gegen 23 Uhr einen ihr verdächtig erscheinenden Asiaten gesehen haben, der vor dem Wohnhaus herum zu lungern schien, wie sie aussagte. Ihr Yorkshire Terrier hatte diesen Fremden wütend angekläfft, konnte sich kaum mehr beruhigen, musste von dem Mann weggezerrt werden. Der Asiate war wohl um die vierzig Jahre alt und besaß ein typisches Vollmondgesicht und Schlitzaugen, wie sie weiter anführte. Er hatte nichts zu ihr oder zu ihrem Hund gesagt, hatte sie beide jedoch drohend angeblickt. Als sie ein paar Minuten später vom Gassi-Gehen um den Block herum wieder zur Eingangstüre zurück kam, stand der Asiate nicht mehr da.
Eine ältere Frau aus dem zweiten Stock glaubte, gegen zwei Uhr nachts ein Poltern gehört zu haben. Sie hätte einen sehr leichten Schlaf und wäre wohl über irgendwelche Geräusche, im Haus oder auf der Straße, aufgewacht, hätte auf den Wecker neben ihrem Bett geschaut und danach noch einmal Krach in der Wohnung über ihr vernommen, ein kurzes Rumpeln, als würde ein Möbelstück gerückt. Ein Uhr achtundfünfzig sei es exakt gewesen, führte sie weiter aus. Und der Lärm war um diese Zeit eine Zumutung. Der Kommissar sah sich den Wecker an und notierte sich zwei Uhr null drei als wahrscheinliche Todeszeit, da der Wecker etwas hinterher ging, was der Frau ausgesprochen peinlich war.
LeMatin berichtete am nächsten Tag über die Ermordung des Junggesellen Jean-Robert Babtiste, sprach von einem Philosophie Studenten Ende zwanzig, mit unbestimmten Einkünften, der bei seinen Nachbarn äußerst beliebt war. Er galt als heterosexuell aber ohne feste Freundin, war immer wieder mal mit wechselnden Frauen im Treppenhaus gesehen worden. Meist wären die Frauen einige Jahre älter gewesen.
Als Alabima die kurze Nachricht in der Zeitung las, ließ sie vor Schreck die Teetasse klirrend auf den Unterteller knallen, so dass dieser zerbrach. Jules schaute erstaunt hoch und sah sie fragend an.
»Was ist los? Hast du dich erschrocken? Über was denn?«
Das Gesicht von Alabima wirkte blutleer und sie musste zwei weitere Sekunden um Fassung ringen, bevor sie ihrem Ehemann ruhig antwortete.
»Nein, es ist nichts. Nur ein weiterer Mord in Lausanne.«
Der Schweizer lächelte ihr zu.
»Du warst doch früher nicht so schreckhaft?«
Die Äthiopierin versuchte sich ebenfalls an einem Lächeln, nahm einen Schluck aus der Tasse, die sie nicht losgelassen hatte, stellte sie neben dem zerbrochenen Unterteller auf dem Tisch ab und blätterte die Zeitungsseite um.
Eine Stunde später suchte sich Jules den Artikel im LeMatin heraus, las ihn zweimal aufmerksam durch, konnte nichts Schreckliches darin finden, sah man vom Ableben eines jungen Mannes ab. Doch die Reaktion seiner Ehefrau auf dessen Tod machte ihn stutzig und Misstrauen schlich sich in seine Gedanken. Und so rief er wenig später von seinem Bürozimmer aus seinen guten Freund Frédérick Glasson in dessen Detektivbüro in Genf an und bat ihn, nach Hintergründen zur Ermordung dieses Jean-Robert Babtiste und zu möglichen Verbindungen des Toten zu Alabima zu suchen. Glasson hörte sich den Auftrag an und dachte erst ein paar Sekunden nach, bevor er seinen Freund fragte: »Und du bist dir ganz sicher, dass ich in der Vergangenheit dieses Babtiste herumwühlen soll?«
Jules bestand darauf und versicherte Frédérick, dass es ihm nur um das Wohl von Alabima ginge. Glasson versprach, sein Möglichstes zu tun.
Die nächsten drei Tage regnete es fast beständig am Genfersee. Die Trübsal draußen schien sich auf die Seelen der Menschen drinnen zu legen. Vor allem Jules fühlte sich unruhig und gereizt, schlief schlecht, ohne dass er von schlechten Träumen wusste, schnauzte sogar Dr. Grey bei ihrer Sitzung ohne jeden Grund an, wurde von ihr kurzerhand hinausgeworfen. Er fuhr anschließend über eine Stunde lang ohne Ziel herum, kam immer noch wütend nach Hause, verkroch sich in seinem Büro, nahm irgendein Buch aus dem Regal, überflog den Deckel. Eine Art zu leben – Über die Vielfalt menschlicher Würde von Peter Bieri. Er versuchte sich zu erinnern, wann und wo er das Buch erstanden hatte, kam nicht sofort drauf. Doch er blätterte die ersten Seiten auf und begann zu lesen, legte es nach wenigen Seiten jedoch genervt wieder beiseite, nicht wegen den wenig anschaulichen Theorien zur menschlichen Würde, in die sich der Autor zu Beginn des Buches zu verirren schien, sondern aufgrund seiner inneren Unruhe, die beständig zunahm. Er stand vom Ledersessel auf und legte sich auf seinen Soft Pad Chaises von Charles und Ray Eames, faltete die Arme über seinem Bauch zusammen und schloss die Augen, atmete bewusst ruhig und langsam ein und aus, versuchte an nichts als an dieses Atmen zu denken.
Sein Smartphone meldete sich, spielte ihm den Mittelteil aus Phantom of the Opera von Iron Maiden vor. Jules lies das leise beginnende und danach rasch anschwellende Gitarren-Solo mit dem unverkennbar klaren Sound von Dave Murrays Fender Stratocaster aus der American Serie mit der Humbucker Bestückung an Steg und Hals als sogenannte Double Fat Strats und dem Floyd-Rose-Vibrationssystem einige Sekunden lang erklingen, bevor er mit leisem Bedauern den Anruf von Frédérick Glasson entgegennahm.
»Hallo Freddie. Wie läuft’s in Genf? Steht euch das Wasser auch schon bis zum Hals?«
»Im Moment sitze ich im vierten Stock und hab noch trockene Füße, Jules.«
Die Antwort von Frédérick war zwar lässig gesprochen, doch unüberhörbar mit einem ernsten Unterton in seiner Stimme.
»Du hast was über diesen Babtiste herausgefunden?«
Glasson antwortete nicht sofort. Dafür hörte Jules seinen Freund seufzend einatmen und der Druck in seiner Magengrube nahm entsprechend zu.
»Spuck’s aus, Freddie«, ermutigte er Glasson, spürte gleichzeitig Gänsehaut auf Nacken, Schultern und Armen, so als wäre die Temperatur im Raum auf einen Schlag um zwanzig Grad gefallen.
»Nun, Jules, eigentlich sollte ich dich anlügen. Es wäre wohl weit besser für uns alle…«
Jules wartete mit noch stärker klopfendem Herz stumm ab.
»…aber als dein Freund kann und will ich das nicht.«
Frédérick sammelte sich noch einmal.
»Es verhält sich so. Ein alter Kollege aus dem Kriminaldezernat in Lausanne hat mir im Vertrauen ein paar Fotos gezeigt, Fotos von verschiedenen Frauen in höchst intimen Situationen, durchwegs vulgäre und sexistische Bilder.«
Noch einmal schnaufte sein Freund schwer am Telefon und Jules wusste bereits alles, bevor er es sich anhören musste.
»Darunter waren auch Fotos von Alabima.«
Jules blieb am anderen Ende der Verbindung weiterhin stumm. Nicht mal sein Atmen war für den Genfer Privatdetektiv hören.
»Mein früherer Kollege versprach mir, nur den neueren Fotos nachzugehen. Die Aufnahmen von Alabima dürften dagegen zwei Jahre alt sein.«
Weiterhin gab Jules keinen Ton von sich. Doch er hatte sich aufgesetzt, hielt sein Handy ans Ohr, starrte in Gedanken versunken zum Fenster hinaus, sah die dunkelgrauen Regenwolken über dem fast schwarzen See stehen, dazwischen ein paar weiße Nebelfetzen träge dahingleiten, nahm nichts von all dem wirklich wahr. Blass sah er aus, abgekämpft und erschöpft.
»Bist du noch dran?«, fragte Frédérick Glasson mitfühlend.
»Ja«, krächzte Jules heiser geworden, »ja, ich bin noch hier.«
»Es tut mir so leid, Jules.«
»Ich weiß, Freddie. Danke.«
Bevor sein Freund noch etwas hinzufügen konnte, unterbrach Jules die Verbindung. Ein wilder Sturm von Gefühlen durchströmte ihn nun, Wut und Verzweiflung, Machtlosigkeit und dann sogar Hass. Aber nicht etwa auf Alabima, sondern auf die Situation, auf sein Leben, auf die Lüge.
Hatte er sich Alabima nicht vor ein paar Wochen vollständig geöffnet? Ihr alles über Vevey und der Sklavin Monique erzählt? Von seiner eigenen Untreue? Der körperlichen und der seelischen?
Und sie hatte ihm verziehen und großes Verständnis gezeigt, ihn sogar getröstet. Dabei war auch sie ihm untreu gewesen.
Nein, Jules dachte nicht einen Moment lang an das Wort Schlampe. Doch was war vor zwei Jahren oder etwas länger gewesen? Ägypten und Afghanistan kamen ihn in den Sinn, seine wochenlange Abwesenheit, sein spurloses Verschwinden. Hatte sie diesen Jean-Robert Babtiste vielleicht in dieser Zeit getroffen? Hatte sich womöglich sogar in den Kerl verliebt?
Ein Schauder überkam Jules, als er sich vorstellte, wie ein anderer Mann mit seiner Alabima…
Nein, er wollte keine Bilder in seinem Kopf sehen, verdrängte diesen Gedanken gleich wieder, lenkte sich ab, rief sich stattdessen die bestimmt verzweifelte Situation seiner Frau in Erinnerung. Sie war allein mit ihrer Tochter, der Ehemann spurlos verschwunden, zudem gefangen in einer Ehe, die bereits vor seiner Abreise nach Kairo angespannt war, nicht zuletzt aufgrund seiner häufigen Besuche bei der Sado-Maso Sklavin Monique.
Erneut klingelte das Telefon. Doch diesmal war es sein Festnetzanschluss. Diese Nummer kannten nur wenige Menschen. Frédérick gehörte selbstverständlich dazu, aber auch Toni Scapia aus Florida und Henry Huxley, sein britischer Freund aus London.
Jules ließ den Apparat klingeln, stand nicht einmal auf von seiner Liege, um die Nummer des Anrufers in Erfahrung zu bringen, wollte momentan mit niemandem reden, musste erst seine Gedanken ordnen und zu Ende führen. Doch das Klingeln nervte ihn gehörig, rief ihn zum Apparat, ließ nicht locker. Trotzdem versuchte er an seine Überlegungen von vorhin anzuknüpfen.
Ja, Monique und Vevey, Ägypten und Afghanistan, zuvor die häufigen, wenn auch kleinen Streitereien mit Alabima, seine Gereiztheit, auch sein sexuelles Abwenden von ihr und all seine Ausflüchte, warum er so selten mit ihr schlief. Jules konnte nicht alle Schuld auf seine Ehefrau schieben, das sah er nun klar vor sich. Das beruhigte seinen Gefühlssturm, wenigstens für den Moment.
Hatte der verdammte Kerl sie vielleicht zu den Fotos gezwungen? Sie mit irgendetwas erpresst, um sie so ablichten zu können? Sie unter Drogen gesetzt?
Jules fühlte sich beim letzten Gedanken noch elender, doch gleich darauf erleichtert, vor allem, weil das Telefon endlich verstummt war. Tief atmete er ein paar Mal ein und aus. Und ein weiterer Schauder schüttelte seinen Oberkörper durch. Doch danach fühlte er sich merklich besser, irgendwie leichter.
Er hatte damals Alabima fast im Streit verlassen, war von einem Moment zum anderen und ohne echten Abschied nach Kairo gereist, hatte viele Wochen lang keinen Kontakt zu ihr aufgenommen. Die Äthiopierin kam sich damals bestimmt sehr allein und von allen verlassen vor. Hatte dieser Babtiste diese Situation ausnutzen können?
Dass ihm Alabima nach seiner Rückkehr nichts über den Kerl und ihrem Fremdgehen erzählt hatte, schob Jules auf seine Krebserkrankung. Er wäre wohl kaum in der Lage gewesen, auch noch damit vernünftig umzugehen. Aber warum hatte sie ihm ihren Betrug an ihrer Lebenspartnerschaft weiterhin verschwiegen, nach seiner Genesung und sogar, nachdem er ihr seinen eigenen Verfehlungen mit Monique erzählt hatte? Hielt ihr Schamgefühl sie davon ab? Oder hatte die Affäre etwa weiter angedauert? Womöglich bis jetzt? War sie womöglich gar in den Tod des Studenten verwickelt? Hatte der Kerl sie vielleicht mit den Fotos erpresst?
Alles war möglich, nichts davon wirklich auszuschließen, selbst wenn vieles höchst unwahrscheinlich klang. Er würde sie zur Rede stellen müssen, um die Wahrheit zu erfahren. Fast war er entschlossen dazu, wolle schon aufzustehen, sein Büro zu verlassen, seine Frau im Haus suchen und sie über diesen gottverdammten Scheiß-Jean-Robert ausfragen, ihr den Betrug an ihm ins Gesicht zu schleudern, dabei alles vergessen, was er sich als Entschuldigung für seine Ehefrau längst ausgedacht und aufgelistet hatte. Jules fühlte den Zorn in sich weiter aufsteigen, diesen Jähzorn, den er je stärker verspürte, desto älter er wurde. Oder war es bloß seine Machtlosigkeit?
Wie nur hatte Alabima ihn betrügen können? Mit einer verdammten Wurst? Einem ewigen Studenten? Mit einem, der mit Ende zwanzig immer noch im staatlichen Schulsystem festsaß? Ein Versager vor der Welt? Ein Nichts?
Er krampfte seine Hände zu Fäusten zusammen, musste sich zwingen, sie wieder zu öffnen.
Der Festnetzanschluss klingelte erneut und wieder verspürte er keine Neigung, aufzustehen und den Hörer abzunehmen. Trotzdem hüpfte er nach einer Weile von der Liege herunter, ging zum Pult, sah sich die anrufende Nummer auf dem Apparat an und erkannte die Vorwahl von Großbritannien. Seine rechte Hand zuckte zum Hörer, zog sich noch einmal zurück. Wollte er mit Henry sprechen? In diesem Moment? Noch bevor er Alabima zu Rede gestellt hatte?
Jules griff plötzlich und entschlossen zu und hob ab.
»Hallo Henry«, begrüßte er seinen Freund auf Verdacht hin.
»Hi, Jules, my old house, how are you doing today?«
»I still know, how I used to do, but I don’t know, if I will be able to do so«, wandelte er einen alten Witz aus den Western-Romanen von G. F. Unger ein wenig ab.
»Bist du derzeit sehr im Stress?«, fragte ihn der Brite leichthin.
»Nein, nicht das ich wüsste«, schwindelte Jules und dachte dabei an die bevorstehende Auseinandersetzung mit seiner Ehefrau.
»Hättest du Lust, mich in die Türkei zu begleiten?«
»In die Türkei? Zu welchem Zweck?«
»Du kannst dich doch bestimmt noch an das Kloster Mor Gabriel erinnern?«
»Ja, selbstverständlich, Henry. Du hast doch damals für die Freilassung der entführten Heinz Strobel und Karin Huber gesorgt und auch für diesen Abt, diesen Timotheus?«
»Nein, nicht Timotheus war entführt worden, sondern Daniel Savci, der Abt des Klosters St. Jakob in Salah.«
»Aha, na gut«, meinte Jules geistesabwesend und dachte wieder an Alabima und ihren Betrug an ihrer Ehe und an die anstehende, mit Sicherheit äußerst hässliche Aussprache.
»Erzbischof Timotheus, der Abt von Mor Gabriel, hat mich zu sich eingeladen. Wenn du Lust verspürst, könnten wir doch gemeinsam hinfliegen.«
»Was will er denn diesmal von dir?«, scherzte der Schweizer.
»Nichts. Seit der Sache von damals lädt er mich regelmäßig zu sich ein. Doch bislang ergab sich einfach keine Gelegenheit dazu. Doch jetzt…?«
Weiterhin dachte Jules nur an Alabima und an diesen toten Drecksack von Studenten, an den Betrug von vor zwei Jahren an ihm, an die vulgären Aufnahmen, die Freddie wohl gesehen hatte, an seinen wilden Zorn und seine gleichzeitige Machtlosigkeit. Vielleicht darum entschloss er sich von einem Moment zum anderen.
»Das ist eine sehr gute Idee, Henry. Wann fliegst du? Wir treffen uns wohl am besten direkt in Istanbul, oder?«
Huxley hatte die Flugpläne von London und Genf bereits aufeinander abgestimmt, schlug Jules einen Flug am nächsten Morgen vor und der Schweizer willigte ein. Er würde Alina zwar erklären müssen, warum er den in wenigen Tagen stattfindenden Räbeliechtli-Umzug ihrer Schule nicht beiwohnen konnte. Das würde seiner Tochter bestimmt missfallen und womöglich musste sie darüber ein paar Tränen vergießen. Doch ein lauter Streit zwischen ihren Eltern oder gar ein eisiges Schweigen nach einer heftigen Auseinandersetzung wären bestimmt viel schlimmer für die Kleine.
An Trennung von Alabima dachte Jules nicht für eine einzige Sekunde. Zumindest in diesem Moment nicht. Doch er fühlte sich erleichtert, als er den Hörer sanft auf die Gabel zurücklegte, hatte er doch mit der Einladung von Henry jegliche Entscheidung auf unbestimmte Zeit verschoben.
*
Alabima hatte ihn an diesem Abend ein paar Mal seltsam angesehen. Konnte sie seine Gedanken etwa lesen? Oder war womöglich gar Verachtung in seinem Gesicht zu erkennen?
»Ist was, Liebling?«, hatte sie ihn endlich gefragt und er hatte schweigend, aber verneinend den Kopf geschüttelt. Womöglich hatte das verbiestert ausgesehen? Jedenfalls war ihm das sorgenvolle Mienenspiel seiner Frau nicht entgangen, hatte sie deshalb ganz besonders freundlich und beruhigend angelächelt.
Seinen Entscheid, Henry Huxley in die Türkei zu begleiten, hatte sie ohne Widerrede entgegengenommen und Alina hatte den in wenigen Tagen anstehenden Lichtumzug ihrer Schule wohl im Moment vergessen, legte jedenfalls keine Widerspruch ein. Sie fragte nur, ob sie ihn den nicht begleiten konnte, was er bedauernd verneinte.
War es Scham oder Gerissenheit, dass er sich in dieser Nacht ganz besonders intensiv um Alabima bemühte? Er hatte nach dem zu Bett gehen nach ihr gegriffen, hatte sie stürmisch geküsst und geleckt, ihr das Negligé vom Körper gestreift, sich auf sie gesetzt, mit ihren Brüsten gespielt, seinen Penis zwischen ihnen steif gerieben, hatte ihre Zunge über seine Eichel streichen lassen, ihre dunkelroten Lippen gespürt, war wenig später in sie eingedrungen, in dieses heiße, feuchte, schwüle Fleisch, dass ein anderer besessen hatte, zumindest noch vor zwei Jahren, vielleicht aber auch noch kürzlich? Ob der verdammte Kerl sie auch auf diese Weise gestoßen hatte? Oder von hinten? In all ihre Löcher?
Seine hässlichen Gedanken übernahmen die Kontrolle über ihn und er spürte, wie sein Penis zu erschlaffen drohte.
Scheiße, schrie es in ihm, ich muss an was anderes denken.
Sofort stiegen Bilder von Monique auf. Das schneeweiße, pummelige Mädchen mit den Hängebrüsten, wie sie sich von ihm benutzen ließ, ihre Qualen wie Geschenke entgegennahm, den Schmerz begrüßte, den ihr der Meister zufügte, sich hemmungslos seiner Lust hingab, nach noch mehr verlangte, nach Demütigungen, Schlägen, Peitschenhieben und heißem Wachs, wie sie sich wie ein Wurm in ihren Fesseln windete, wie sie ihre Schenkel lüstern spreizte und mit den Fingern ihre Schamlippen für ihn auseinanderzog, damit er sie möglichst hart stoßen konnte.
Die Bilder in seinem Kopf erzielten die gewünschte Wirkung. Jules konnte sich wieder auf Alabima konzentrieren. Ihre dunkle Haut glänzte vor Schweiß. Sie hielt ihre Augen geschlossen. Ihr Gesicht lag ruhig. Nur ihre Mundwinkel zuckten, im Rhythmus des Lustgefühls, das auf und ab schwappte, sich immer mehr steigerte.
Komm endlich, du Hure, schoss es ihm durch den Kopf und das Wort Hure störte ihn seltsamerweise nicht, war für ihn eher Ansporn. Er steigerte seine Kadenz, klatschte laut gegen ihre großen Schamlippen, die sich mit der Geburt der Tochter erweitert hatten, spürte die Anspannung ihrer Schenkel und ihres Unterleibs, wie sie sich aufrichtete, ihm entgegen hob, offen für ihn und für alles. Und endlich konnte er mit einem lauten Grunzen in sie hineinspritzen, seinen Samen in sie vergießen und gleichzeitig spüren, wie auch sie kam, mit langgezogenem Stöhnen, das später fast in ein Wimmern überging und dann durch ein heftiges Keuchen abgelöst wurde. Noch immer stieß er in sie hinein, holte wohl den letzten Tropfen aus seinem Hodensack, fühlte gleichzeitig auch die Lust bei Alabima langsam abklingen, blieb heftig atmend auf ihr liegen, stützte sich mit den Unterarmen auf der Matratze ab, wollte nicht zu schwer auf sie niederdrücken.
»Oh, Jules, du bist der beste Liebhaber der Welt.«
Verhöhnte sie ihn? Bestimmt hatte dieser verfluchte Babtiste einen Riesenschwanz, auf dem sie gemeinsam gen Himmel geritten waren, immer und immer wieder. Vielleicht auch noch in letzter Zeit? Vor einer Woche? Einem Monat? Freddie würde das bestimmt noch herausfinden können, falls dem so war. Und bis dahin?
In wenigen Stunden konnte er abreisen, Henry in Istanbul treffen, mit ihm weiter zum Kloster Mor Gabriel fliegen, ein paar Tage lang seine Gedanken und Gefühle ordnen. Doch was hatte er schon für Möglichkeiten? Trennung? Niemals. Verachtung? Das wäre kein Leben.
Hilflosigkeit?
Er löste sich von Alabima, legte sich neben sie, spürte ihre tastende Hand und wie sie seinen rechten Arm ergriff und ihn liebevoll festhielt.
War es wichtig, was vor zwei Jahren oder so geschehen war? Wie die Umstände lagen? Was Alabima für diesen Studenten damals empfunden hatte?
Jules spürte die Eifersucht. Aber nicht aufgrund der Untreue seiner Frau, sondern nur der Gefühle, die sie diesem Jean-Robert womöglich entgegengebracht hatte.
Oder war dieser Kerl bloß ein Callboy gewesen? Einer, den sich die Frauen kauften, um ein paar nette Stunden zu verleben?
Der Schweizer schallt sich einen Narren, dass er nicht gleich auf diese Idee gekommen war. Freddie konnte bestimmt herausfinden, ob sich dieser ewige Student als Lustknabe verkauft hatte, womöglich sogar an beiderlei Geschlecht. Das hätte alles am Ehebruch von Alabima geändert, wäre dasselbe gewesen, wie seine Untreue mit der achtzehnjährigen Monique, der kleinen, pummeligen Sklavin aus dem Sado-Maso Club in Vevey.
Oder zumindest etwas Ähnliches.
Doch warum hatte ihm seine Frau dann nicht von diesem Babtiste erzählt, als er sich ihr gegenüber offenbart hatte? Und wie passten die Porno-Fotos von Alabima in dieses neue Bild eines gekauften Callboys?
Erneute Zweifel stiegen in Jules hoch, zusammen mit einer kaum zu kontrollierenden Wut.
Er würde Freddie morgen früh vom Flughafen aus noch einmal anrufen und ihn mit weiteren Abklärungen beauftragen. Jules musste unbedingte Gewissheit erlangen, bevor er Alabima zur Rede stellte. Sonst konnte ihm das Gespräch rasch entgleiten. Und Kontrolle war das, was Jules unter allen Umständen behalten musste, das spürte er.
Endlich nahm er die ruhigen Atemzüge einer Schlafenden neben sich bewusst wahr, löste vorsichtig seinen Arm aus ihrer Hand, rückte ein wenig von ihr ab. Die Laken würden morgen früh bestimmt von seinem Samen getränkt sein, wahrscheinlich auch die Matratze.
Hatten es Alabima und dieser Babtiste etwa auch hier, auf ihrem Ehebett, getrieben? Lag er seit zwei Jahren auf den Samenergüssen eines anderen?
Jules ekelte sich plötzlich, rückte noch weiter wen und zum Rand der Matratze hin, wälzte sich vorsichtig über die Kante und landete neben dem Bett, richtete sich dort leise auf, nahm den Morgenmantel von der Sessellehne, schlüpfte hinein, gürtete sich, verließ das Schlafzimmer lautlos wie ein Geist.
Eine halbe Stunde lang schlich er durchs Haus, erst die Treppe hinunter in die Eingangshalle, von dort hinüber ins Wohnzimmer, dann hinunter in den Keller. Er musste sich für die Reise in die Türkei eh noch mit etwas Bargeld ausstatten. Später stand er wieder im Wohnzimmer an der Fensterfront zum Garten. Lange starrte er hinaus in die Dunkelheit, erkannte den See, der an manchen Stellen vom Mondlicht getroffen wurde und geheimnisvoll schimmerte. Die Wolkendecke musste aufgerissen haben. Vielleicht gab es morgen einen etwas schöneren Tag? Er hatte keinen Wetterbericht gehört.
Jules spürte seine Müdigkeit. Er tapste bis zum Sofa, ließ sich darauf nieder, streckte sich auf ihm aus. Das Leder fühlte sich unangenehm kalt an durch den seidenen, dünnen Morgenmantel. Gleichzeitig wirkte die Kühle aber auch äußerst erregend auf ihn. Er begann an seinem Penis herumzuspielen, spürte die Reste seines Ergusses an den Fingern kleben, was schmutzig und darum verlockend zugleich war und sein Glied rasch versteifen ließ. Ja, seine Lanze richtete sich nun steil auf, war härter als zuvor bei seiner Frau, fühlte sich stark und mächtig an. Nur kurz dachte Jules wieder an Monique. Danach an andere Frauen in seinem Leben, an Dr. Grey, die er allerdings noch nie nackt gesehen hatte. Ihr Pferdegesicht mit dem etwas zu langen Hals saß auf geraden, beinahe männlichen Schultern. Zwei kleine, feste Brüste mit riesigen Warzenhöfen, dazwischen ein mit Sommersprossen übersäter Busen, ein recht flacher, schon welker Bauch und die schmalen Hüften eines Knabe, dazu lange, dünne Oberschenkel, zwischen ihnen ein brauner oder gar roter Wulst an Haaren. Sie rieb ihre Klitoris ohne Scham vor ihm, machte sich geil und bereit, würde sich gleich auf ihrem schmalen Patientensofa hinlegen, ihre Schenkel weit spreizen und ihn lockend zu sich rufen, ihn in sich aufnehmen, kühl und alles beherrschend, denn sie war die Doktorin, die Psychologin, die alles im Griff behielt und er ihr Sklave und Liebhaber, der tat, was sie ihm befahl. Wie herrlich musste es doch sein, von ihr angeleitet, ja befohlen zu werden. Stoß mich, du Dreckskerl, herrschte sie ihn in seinen Gedanken an, fester, du Schlappschwanz. Er tat, wie ihm geheißen, gab sich größte Mühe, konnte ihren Ansprüchen trotzdem kaum gerecht werden, wie ihre Worte ihm bewiesen. Lass es sein, du kleiner Wicht. Du bringst es nicht. Dafür darfst du mich nun lecken. Hopp, knie dich dort auf den Boden.
Und sie ruckte sich auf der Liege zurecht, ließ sich von seiner Zunge verwöhnen.
Was ist?, fragte sie erzürnt, warum lässt du deinen Kleinen erschlaffen. Los, du kannst mich lecken und dich gleichzeitig befriedigen. Los, Sklave, ich will dich abspritzen sehen.
Jules fühlte ihre steife Klitoris unter seiner Zungenspitze, schmeckte den Saft ihrer Muschi im Mund, spürte die Geilheit in seinem Schwanz und in seinen Lenden und spritze endlich ab und hoch in die Luft, einmal, zweimal und noch ein drittes Mal, wurde sich endlich wieder bewusst, wo er lag, hörte sein lautes Keuchen, versuchte erschrocken den Atem anzuhalten, weil er plötzliche Angst verspürte, jemand könnte in der Nähe sein, Alabima oder gar Alina. Nur langsam legte sich dieser Gedanke, als er weiterhin kein Geräusch vernahm. Er blieb auf dem Sofa liegen, immer noch mit seinem Glied in der Hand, doch nun erschlafft und befriedigt.
Er richtete sich vorsichtig auf, versuchte mit seinen Händen den Samen auf seinem Bauch festzuhalten und am Tropfen zu hindern, erhob sich, ging hinüber ins Badezimmer, machte dort Licht, trat in die Dusche, ließ das Wasser rauschen, spülte die Scham weg, seifte Bauch und Penis und Hodensack kräftig ein, spülte nach, wiederholte den Vorgang ein zweites Mal, trocknete sich ab. Auch sein Morgenmantel hatte einiges abbekommen von seiner Saat der Lust und so spülte er ihn am Waschbecken mit der Handseife aus, legte ihn über die Duschabtrennung. Nackt ging er zurück ins Wohnzimmer, machte auch dort Licht, besah sich das Sofa, fand vereinzelt ein paar Sprenkel, holte sich einen feuchten Waschlappen aus dem Bad, wusch alles sorgfältig vom Leder ab, tupfte auch die beiden kleinen Flecke auf dem Teppich weg.
Es löschte das Licht und ging wieder hoch, schlich sich zurück ins eheliche Bett, ekelte sich nicht mehr vor der Matratze, fühlte nur noch die bleierne Schwere in seinen Beinen und Armen und wie sie ihn unaufhaltsam zu sich hinunterzogen, bis ihm jeder Gedanke entschwand.
*
Sie hatten sich fast jeden Abend auf der Umfassungsmauer getroffen, hatten gemeinsam den Sonnenuntergang beobachtet, waren danach zurück zu ihren Wohngebäuden gegangen. Sherif wurde misstrauisch von seinen Angehörigen überwacht, Onkel Jussuf sprach mehr als einmal mahnende Worte an Sheliza, dass sie auf ihren Ruf zu achten habe, dass sie nicht vergessen durfte, dass Sherif ein Sunnit wäre, einer von denen, welche die Dschihadisten nach al-Busayrah gerufen hatten, einer von denen, welche am Tod ihrer Eltern die Schuld trugen.
»Aber Onkelchen«, hatte die aufgeweckte Vierzehnjährige gemeint, »Sherif stammt aus Aleppo. Der hat doch nichts zu tun mit den Mördern an unserer Familie.«
»Sunnit bleibt Sunnit«, beharrte der aber auf seiner Meinung, »und sie sind auch schuld am Bürgerkrieg.«
»Schuld? Aber Onkel Jussuf, waren es nicht stets die Schiiten, die mit uns Alawiten zusammen das Land regierten und die sunnitische Bevölkerungsmehrheit unterdrückten? Haben nicht auch wir viel Schuld auf uns geladen? Und haben nicht die Schiiten die Hisbollah aus dem Libanon zu Hilfe gerufen? Gegen die wohl berechtigte sunnitische Revolution? So hast du es mir doch selbst erklärt?«
Onkel Jussuf hatte bloß irgendetwas Unzufriedenes gemurmelt und hatte sie stehen lassen. Das war zwar keine klare Antwort gewesen, doch Sheliza verstand zumindest, dass dieser grässliche Bürgerkrieg wohl längst alle Köpfe angesteckt und durcheinandergebracht hatte, die klugen genauso wie die dummen, die intelligenten ebenso wie die blöden. Es gab kein Schwarz und kein Weiß mehr, kein richtig oder falsch, nur noch ein misstrauisches Grau, aus dem ein bösartiges Gegeneinander wuchs.
Zwar immer noch jung an Jahren, jedoch wesentlich älter an Erfahrungen spürte das Mädchen immer wieder darüber nach, wie leicht doch die Gedanken der Menschen manipuliert werden konnten. Als Alawiten hatte sie immer geglaubt, die Familie Assad würde das Land zum Wohle aller Menschen führen. Doch die sunnitische Mehrheit im Land war unglücklich gewesen, wollte diese Fürsorge nicht länger ertragen, verlangte nach mehr Eigenständigkeit und nach mehr Freiheit. Doch durfte es eine Freiheit geben, wenn so verschiedene Völker, Religionen und Meinungen in einem einzigen Land zusammenlebten? Musste man nicht die Staatsmacht in wenige, fähige Hände legen, um sie geschlossen und zum Wohle aller Bewohner einzusetzen? War nicht die Zersplitterung der Macht einer der Gründe, weshalb Nationen in einem Bürgerkrieg untergehen konnten?
Sie hatte ihre Fragen Schwester Helene gestellt, denn zu ihr fühlte sie sich dank ihrem erfrischend unorthodoxen Biologie-Unterricht ganz besonders hingezogen. Sie erwartete von ihr deshalb auch in dieser Hinsicht klare Antworten, wurde aber enttäuscht.
»Du denkst sehr weit, liebe Sheliza«, hatte die kluge Nonne zu ihr gesagt, »weit und durchaus richtig. Aber du musst einen wichtigen Umstand zusätzlich beachten. Eine Gesellschaft ist stets dem Wandel unterworfen. Was heute vielen Menschen wichtig erscheint, kann schon morgen überholt sein. Die Veränderung der Bedürfnisse einer Zivilgesellschaft lassen sich nur in geringem Masse durch den Staat oder die Religionen beeinflussen oder gar steuern. Und zähmen lassen sie sich schon gar nicht, zumindest nicht auf Dauer. Deshalb nehmen die Politik und auch die Kirche die Anliegen der Menschen stets von Neuem auf und suchen nach tragfähigen Lösungen. Doch Lösungen stellen stets Kompromisse dar und in Kompromissen erhält niemand zu 100 % das, wonach er strebt, wonach es ihn im Moment dürstet. So entsteht die Unzufriedenheit. Und diese lässt sich oft leicht kanalisieren und für eigene Zwecke ausnutzen.«
»Was für Zwecke?«
»Nun, meine Tochter, ich weiß nicht, ob du in deinem Alter die Zusammenhänge bereits zu begreifen vermagst. Syrien ist in einen weltpolitischen Strudel geraten, der nicht wirklich etwas mit den Ansprüchen der eigenen Bevölkerung zu tun hat. Seit Jahrzehnten tobt der Kampf der Palästinenser gegen Israel. Unterstützt werden sie durch die Hisbollah im Libanon. Diese Organisation wird vor allem durch die syrischen Machthaber in Damaskus mit Geld und Waffen versorgt. Doch Damaskus macht dies nicht aus freien Stücken, sondern im Auftrag des Iran. Der will nämlich wieder zur alles bestimmenden Macht im gesamten arabischen Raum werden. Und um dieses Ziel zu erreichen, wird der Stellvertreterkrieg zwischen den Palästinensern und den Israeli immer wieder von neuem genährt.«
»Stellvertreterkrieg?«
Sheliza hatte ihre Stirn in Falten gelegt.
»Ja, ein Stellvertreterkrieg. Denn in Wahrheit kämpft der Iran mit der Unterstützung der Palästinenser und der Hisbollah vor allem den Einfluss der USA und von Saudi-Arabien in der Region«, das Mädchen nickte nun, schien die Erklärung der Nonne soweit verstanden zu haben und so fuhr diese fort, »der schiitische Iran, das frühere Persien, will wieder zur alles bestimmenden Macht im arabischen Raum werden. Das sunnitische Saudi-Arabien hat davor Angst, weshalb es alles daransetzt, um diesen iranischen Anspruch zu torpedieren. Die Israelis ihrerseits haben die Palästinenser in den autonomen Gebieten praktisch eingesperrt. Vor allem die Hamas im Gaza-Streifen. Die Palästinenser stellen so keine militärische Bedrohung für Israel dar. Ebenso hat die Hisbollah nach der Ermordung des libanesischen Ex-Ministerpräsidenten Rafiq al-Hariri in weiten Teilen der Bevölkerung ihren Rückhalt verloren. Das schwächte die Stellung des Irans zusätzlich. Mit dem von Saudi-Arabien angezettelten Bürgerkrieg in Syrien soll die Macht der Mullahs am Persischen Golf noch weiter zurückgedrängt werden. Nur deshalb unterstützt Saudi-Arabien und andere Golfstaaten die Sunniten in Syrien, wiegelte sie zum Aufstand an, versorgt sie weiterhin großzügig mit Geld und Waffen, schickt auch sunnitische Terroristen aus dem Irak und Taliban-Kämpfer aus Afghanistan in dein Land.«
Sheliza sah die Nonne aus großen Augen an, sagte jedoch nichts.
»Statt dass Saudi-Arabien und der Iran also direkt Krieg gegeneinander führen, bedienen sie sich der Unzufriedenen in anderen Ländern, schüren ihre Wut weiter an, sähen so den Samen der Zwietracht unter die Völker. Die unterschiedlichen Kirchen, auf der einen Seite die Sunniten, auf der anderen die Schiiten und Alawiten, sind bloß ein Mittel zum Zweck, sollen den Bürgerkrieg durch Fatalismus und Radikalismus verschlimmern.«
Das Mädchen versuchte die Ausführungen von Schwester Helene in ihrem bisherigen Bild unterzubringen.
»Dann sind meine Eltern und meine Geschwister also nur gestorben, weil Saudi-Arabien und der Iran nicht offen gegeneinander kämpfen wollen?«
Eine große Unruhe war dem Mädchen nun anzusehen und die Nonne lächelte sie bedauernd und verständnisvoll zugleich an: »Das Schicksal ist oft ungerecht, Sheliza. Wir Menschen müssen es erdulden, sind darin oft nur der Ball und selten der Spieler.«
»Und dein Gott hilft dir, diese Ungerechtigkeit und das Unglück zu ertragen?«
»Jeder Gott hilft den Menschen, solange sie an ihn glauben, mag es Allah sein oder ein anderer.«
»Warum bist du Nonne geworden, Schwester Helene?«
Das Mädchen sah die Ordensschwester mit ernsten Augen an, hatte irgendwie begriffen oder gespürt, dass diese an Jahren noch junge Frau vielleicht gar nicht so richtig an ihren Gott glauben mochte, dass sie viel stärkere Zweifel verspürte, als es ihr Gewand und das Kreuz um ihren Hals auswies.
Helene schüttelte nachdenklich geworden den Kopf, schien für einen Moment in ihr Inneres zu blicken und dort nach Antworten zu suchen.
»Stolz«, meinte sie nach längerem Zögern, »es war meine Stolz, der mich in die Arme Christus führte.«
»Dein Stolz?«
Sheliza war skeptisch.
»Ja, mein Stolz, der sich nur durch Ehre in eine andere, bessere Bahn lenken ließ.«
Die Vierzehnjährige verstand nicht wirklich, spürte jedoch ganz stark, dass sie nicht weiter auf die Nonne eindringen sollte, dass diese nicht bereit war, noch mehr von sich und ihrem früheren Leben Preis zu geben. Ihre verkniffenen Lippen, die abweisenden Augen und die leicht geblähten Nasenflügel, so als hätte sie die Witterung eines Raubtiers aufgenommen, einem Ungeheuer, das sie längst gut kannte und vor dem sie sich fürchtete, waren überdeutliche Zeichen für die Vierzehnjährige.
»Ich werde über deine Worte erst gründlich nachdenken müssen, Schwester Helene«, verabschiedete sich Sheliza von der Nonne. Die Ordensschwester sah ihr lange nach, sah aber nicht den schlanken Rücken, nicht die feingliedrigen Arme und Hände, den gut geschnittenen Kopf, denn ihr Blick war verschwommen, ihre Augen mit Tränen gefüllt.