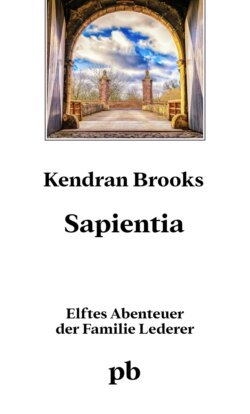Читать книгу Sapientia - Kendran Brooks - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1988 – für Heinz
ОглавлениеSeine Abschlussarbeiten hatte Jules termingerecht eingereicht und alle Anspannung, aller Ärger, alle Mühsal war in diesem Moment von ihm abgefallen. Er hatte auch noch nicht für seine Zukunft geplant, wollte die nächsten Monate ohne jede Verpflichtung verbringen, vielleicht die Welt bereisen, das Leben genießen. Zwar nur mittelgroß, schlank und mit einem Allerweltsgesicht gesegnet, zog der Schweizer trotzdem viele Frauen jeden Alters an, sobald er sich lässig an einem Sandstrand in der Badehose oder an einer Bar mit weit geöffnetem Hemd und eng geschnittener Hose zeigte und so seinen gestählten Körper mit den deutlichen, wenn auch nicht protzigen Muskeln präsentierte.
Finanziell war Jules Lederer bereits damals weitgehend unabhängig. Seine geschiedenen Eltern hatten ihn stets reichlich mit Geld versorgt. Zudem beerbte er eine verstorbene Tante, die er gar nicht kannte, die ihn wahrscheinlich als Säugling zum ersten und letzten Mal gesehen und in ihren bestimmt schon damals faltigen und fleckigen Armen gewiegt hatte. Doch achthunderttausend Franken blieben achthunderttausend, selbst wenn sie vom Teufel selbst ausbezahlt worden wären.
Immer noch lebte Jules in der 1-Zimmer-Wohnung an der Waldaustraße in St. Gallen, immer noch trainierte er täglich seinen Kampfsport, wenn auch nicht mehr unter einem Meister und in einem Dojang, sondern in einem gewöhnlichen Karateklub, dessen Mitglieder allesamt weit weniger an asiatischen Weisheiten als an durchschlagenden Argumenten interessiert waren.
Jules hielt sich meist abseits von ihnen, hatte in einer Ecke der großen Trainingshalle auf eigene Kosten einen Wing Chung Holzdummy installieren lassen, um seinen Körper weiter abzuhärten. Heinz Keller war ihm hierher gefolgt, hatte das frühere Dojang von Meister Hiro Kashi ebenfalls verlassen, blieb sein guter Kollege und beinahe Freund. Nur beinahe, denn Jules mochte die Nähe eines anderen Mannes nicht aushalten und ohne die war echte Freundschaft unmöglich. Vielleicht lag das an Jules Kindheit mit einem Vater, der nie für ihn da war und einer Mutter, die jede Körperlichkeit ablehnte. Womöglich auch an seinem früheren Sportlehrer Peter Maischberger, der die Verletzlichkeit von Jules damals im Knabeninternat in Montreux gespürte hatte, ihn verführte und missbrauchte.
Nein, mit Männern sich im Kampf messen, das mochte Jules Lederer, war für ihn zu einem wichtigen Lebensinhalt geworden. Doch mehr und echte Nähe? Über Gedanken und Gefühle sprechen? Vertrautheit aufbauen? Das alles kam für ihn nicht mehr in Frage. Und so blieb seine Beziehung zu Heinz Keller eine rein kollegiale, mit lockeren Gesprächen und stets ausweichendem Tiefgang. Und Heinz spürte die mangelnde Bereitschaft von Jules, nahm darauf Rücksicht, vielleicht, weil er in ihm längst den Anführer ihres Zweiergespanns sah, dessen Launen er sich unterzuordnen hatte, vielleicht auch, weil er damals schon die innerliche Verlorenheit von Jules fühlte und kein Mittel fand, sie aufzubrechen.
Doch dann trat Roger Spälti in ihr Leben, tauchte an einem Abend in der Karateschule auf, beobachtete die Kämpfer auf den Kwon-Matten, gesellte sich wenig später zu Jules und Heinz, die an der Wing Chung Holzpuppe Ausdauer übten und ihre Schmerzempfindlichkeit senkten. Und irgendwann stellte sich Roger den beiden vor, lud sie zu einem isotonischen Getränk an der Bar ein, fragte sie aus, nach ihren Kampfkünsten, der Einschätzung ihrer Fähigkeiten. Jules war ehrlich überrascht, dass Heinz ihn als sein Vorbild beschrieb und von seinem Können schwärmte, tat dasselbe für seinen Kollegen, wenn auch wenig überzeugend.
Später ließ sich Roger Spälti von ihnen beiden einen Showkampf mit Nunchakus zeigen. Sie gehörten für Jules und Heinz zu den bevorzugten asiatischen Waffen, waren doch die beiden durch kurze Ketten verbundenen und mit Blei ausgegossenen Holzenden nur schwer beherrschbar, verlangten gleichermaßen nach körperlichem, wie nach geistigem Geschick, mussten geradezu mit dem Kämpfer verschmelzen, um wirksam eingesetzt zu werden.
Roger Spälti zeigte sich von der Vorführung begeistert, lud Heinz und Jules spontan zu einer asiatischen Kampfsport-Show ein, die sein Arbeitgeber Lenz & Karrer, eine große Anwaltskanzlei in Zürich, sponserte. Die beiden nicht-mehr-lange Wirtschaftsstudenten nahmen freudig an und zeigten ein paar Wochen später dem Publikum einen ebenso wilden, wie erklärenden Schaukampf. Zufrieden saßen die beiden hinterher in der Umkleide zusammen, hatten längst geduscht und die Haare gewaschen und schlüpften gerade in ihre Straßenschuhe, als Roger Spälti zu ihnen hineinkam und sie zu einem Bier oder Wasser in einer nahen Kneipe einlud. Zu dritt saßen sie wenig später in der Gräbli Bar an einem Tisch zusammen, Heinz und Jules innerlich in gespannter Erwartung, Roger locker und doch bestimmt.
»Ich hab das Okay bekommen«, vermeldete er, nachdem sie sich zugeprostet hatten, »von meinen Vorgesetzten«, ergänzte Roger erklärend, »die saßen nämlich auch im Publikum. Auf meine Bitte hin.«
Irgendwie seltsam geheimnisvoll klangen diese Sätze in den Ohren der beiden Wirtschafts-Studenten, beinahe schon verschwörerisch.
»Wir möchten euch beiden deshalb ein Angebot machen.«
Heinz und Jules sahen einander an, lächelten überrascht und erfreut.
»Wir sind ständig auf der Suche nach jungen Talenten, die unsere Teams verstärken«, führte Spälti weiter aus, flocht immer noch an seinem Netz, um die Beute sicher einzufangen, »und ihr beide könntet zu den Besten gehören«, was immer er mit Besten meinen mochte. Heinz und auch Jules sagten nichts darauf, warteten auf weitere Erklärungen.
»Lenz & Karrer sind weltweit als Wirtschaftskanzlei tätig. Wir besitzen Niederlassungen in Washington, Tokio und Singapur, werden bald eine weitere Filiale in Doha eröffnen. Ihr seht, wir expandieren kräftig«, und er blickte seine Beute ein wenig gönnerhaft, aber keineswegs überheblich an.
»Unsere Mandanten sind die größten Konzerne der Erde und die wohlhabendsten Familien und Privatpersonen«, köderte er seine beiden Opfer weltmännisch verführerisch.
»Und mit was verdient ihr euer Geld?«, fragte Heinz neugierig dazwischen, längst angesteckt durch die süßen Düfte fremder Länder und Kulturen, die sich bei Lenz & Karrer wohl mit Beruf und Einkommen verbinden ließen.
»Wir sind Wirtschaftsanwälte«, stellte Roger Spälti unnötigerweise klar, als müsste er Heinz und Jules aus Wolkenkuckucksheim zurück auf die Erde holen, »internationale Steuersachen, Unternehmenszusammenschlüsse, Nachfolgeregelungen, Family-Offices«, ließ er gleich wieder eine breite Palette an möglichst exotischen Tätigkeitsfeldern aufblitzen.
»Und wir wären…?«, meinte nun auch Jules und wirkte weitaus skeptischer und vorsichtiger als Heinz.
»Anfänger, selbstverständlich«, meinte Roger laut auflachend, »oder was dachtet ihr denn, so direkt nach eurem Studium?«
Heinz schien ernüchtert, Jules dagegen eher interessierter als zuvor. Doch beide sagten nichts, warteten auf das konkrete Angebot.
»Ihr arbeitet vorerst in Zürich, werdet einem Team zugeteilt, erhaltet einen Patenonkel, der euch in den nächsten zwei oder drei Jahren betreuen wird, lernt zuerst unseren Betrieb und danach schrittweise unsere Klienten kennen. Keine Sorge, ihr werdet auf jede eurer Aufgaben sorgfältig vorbereitet. Lenz & Karrer können es sich nicht erlauben, einen Mandanten zu verärgern oder zu enttäuschen.«
»Und du glaubst, wir beide gehören zu den Richtigen?«, fragte Jules weit skeptischer zurück, als er sich tatsächlich fühlte, so als müsste er mit dem Angebot spielen.
Roger lächelte, nachsichtig, aber auch wissend. Vielleicht waren die drei aus demselben Holz geschnitzt, auch wenn Spälti bestimmt fünfzehn Jahre älter war als die beiden Noch-Studenten. Doch er schien in ihnen vielleicht eine Art von jüngerer Ausgabe zu sehen, hoffte es zumindest.
Heinz bewegte sich als erster, streckte Spälti seine Hand entgegen. Der nahm sie ohne Zögern an, schüttelte sie, nickte seinem neuen Mitarbeiter lächelnd und zufrieden zu, meinte trotzdem: »Und keinerlei Fragen? Zur Höhe des Einkommens? Unseren Sozialleistungen? Den Spesen?«
»Nein«, meinte Heinz strahlend lachend und fügte an, »ich bin mir sicher, dass Jules und ich bei Lenz & Karrer alles finden werden, was wir uns nur wünschen.«
Spälti antwortete nicht darauf, sah stattdessen Jules auffordernd an. Doch der zögerte noch, so als spürte er bereits all die Probleme und Schwierigkeiten, auch all den Zorn und die Wut, die Gewalt und die Menschenverachtung, die stets an den großen Vermögen der Welt klebten.
»Wie steht es mit dir?«, fragte Roger deshalb nach und allen dreien war in diesem Moment bewusst, dass Spälti unbedingt Jules mit in sein Boot der Wirtschaftsanwälte holen wollte und Heinz eher als eine Dreingabe betrachtete.
»Wir wissen doch noch nicht einmal, ob unsere Abschlussarbeiten fürs Diplom reichen«, wandte Jules Lederer ein und sah dann etwas staunend in das breite Grinsen von Roger Spälti.
»Ihr vielleicht nicht. Wir jedoch schon.«
Jules schlug in die angebotene Hand ein.
*
Heinz Keller und Jules Lederer verloren sich in den nächsten Wochen aus den Augen. Denn Jules blieb in der Zentrale der Anwaltskanzlei in Zürich hängen, während Heinz bereits zehn Tage nach ihrem gemeinsamen Antritt nach Washington übersiedelte. Ein amerikanischer Kollege war durch einen Unfall ausgefallen und schneller Ersatz gefragt. Heinz fühlte sich auserwählt, foppte Jules gehörig, was sich der gerne gefallen ließ und seinem Kollegen alles Gute wünschte. Doch irgendwie fühlte sich Jules doch zurückgesetzt und er sprach Roger Spälti darauf an, beschwerte sich indirekt bei ihm. Doch der nickte ihm bloß aufmunternd zu und klopfte ihm auf die Schultern: »Deine Zeit kommt schon noch, Jules, keine Sorge.«
»Aber warum habt ihr Heinz vorgezogen?«
»Die Entscheidung fiel aufgrund der Resultate des Assessments nach eurem Eintritt.«
»Und Heinz schnitt darin besser ab als ich?«, zweifelte Jules den Test sogleich an.
Roger lachte auf.
»Nein, Jules, ganz und gar nicht.«
»Aber warum …?«
»Der frei gewordene Posten in Washington war der Richtige für Heinz Keller. Er ist ein Heißsporn, wie du sicher weißt, und an diesem Ort bestimmt gut aufgehoben. Denn in den USA geht’s weit hemdsärmeliger zu und her als hier bei uns in der gemütlichen Schweiz. Zudem haben wir mit dir weit mehr vor«, ließ Spälti gewisse Erwartungen in Jules zurück.
Doch die immer selteneren Telefongespräche mit seinem Kollegen Heinz verhießen für Jules wenig Gutes. Während er in Zürich fast ausschließlich an seinem Arbeitsplatz im Großraumbüro saß und dort Bilanzen und Kapitalflussrechnungen von irgendwelchen Unternehmen analysieren und auf besonders Gewinn versprechende Investitionen abtasten musste, berichtet ihm Heinz von unwahrscheinlich betuchten Klienten, die er als Junior-Berater zusammen mit seinem direkten Vorgesetzten besuchte, von riesigen Villen, teuren Sportwagen und den schönsten Frauen des Erdballs. Und auch wenn Jules die Schilderungen durchwegs als übertrieben und prahlerisch abtat, sie versetzten ihm trotzdem Stiche. Mehr als einmal ermahnte er seinen Kollegen auch, doch auf dem Teppich zu bleiben, doch Heinz ließ sich nicht mehr beirren, sprach von ungeahnten Möglichkeiten und wenig später von seinem ersten Alleineinsatz im nahen Ausland. Mehr verriet er Jules nicht, tat geheimnisvoll, als wäre er plötzlich der Bruder von James Bond und kein kleiner Anwaltsgehilfe. Sie verabschiedeten sich wie üblich, mit lockeren Sprüchen und guten Wünschen. Missmutig legte Jules den Hörer auf die Gabel zurück, fragte sich, ob sein Eintritt bei Lenz & Karrer nicht ein riesiger Fehler gewesen war. Roger Spälti sprach er jedoch nicht mehr an. Der war eh immer häufiger abwesend, besuchte wohl die anderen Standorte im Ausland, stellte den Kontakt mit der Zentrale sicher.
Ein Gefühl der Vereinsamung oder der Verlassenheit stellte sich bei Jules ein. Denn nach seinem Umzug von St. Gallen in ein 2-Zimmer-Appartment an der Mühlegasse in Zürich hatte er sich noch keinen neuen Bekanntenkreis aufgebaut. In der Kanzlei waren fast alle Angestellten und auch die Partner verheiratet, pflegten außerhalb der Büroräume keine Kontakte untereinander, schienen sich richtiggehend abzuschotten und sich abends und übers Wochenende in ihre selbst geschaffenen Schneckenhäuser zurückzuziehen.
Nur einmal hatte ihn Roger Spälti zu sich nach Hause eingeladen, kurz nach der Abreise von Heinz. Es gab Otak-otak, in Bananenblätter eingewickelte Kugeln aus Makrelenfleisch, danach Satay mit Erdnusssauce und etwas gedünstetes Gemüse, eine Curry Laksa mit Nudeln und als Hauptgang ein Rendang aus Rindfleisch, scharf gewürzt und mit Ingwer, Zitronengras und Galgant verfeinert, wie Jules verwundert und fragend zugleich feststellte.
»Meine Familie versorgt uns regelmäßig mit allem Notwendigen«, meinte Yolida und lächelte dazu, als müsste sie sich entschuldigen, »doch woher kennst du Galgant? Kaum jemand in der Schweiz kennt dieses Gewürz?«
Die malaysische Ehefrau von Spälti sprach ein derart britisch klingendes Englisch, dass sich Jules sogleich an einen Austauschstudenten aus England erinnert fühlte, den er ein Jahr zuvor in St. Gallen kennengelernt hatte. Tatsächlich hatte Yolida am Girton College englische Geschichte und englische Literatur studiert und in Cambridge auch ihren Heinz kennengelernt, der am Jesus College Philosophie und Theologie belegte. Das Ehepaar war kinderlos geblieben. Jedenfalls wurden keine erwähnt und Jules fragte aus Gründen der Pietät nicht weiter nach.
»Meine Mutter hatte eine Phase, in der sie mit asiatischen Heilkräutern und Gewürzen experimentierte und eine Reihe von Hausmittelchen herstellte. Sie verlor zwar rasch das Interesse daran. Doch ich kann mich an eine rotbraune Flüssigkeit erinnern, die sie mir gegen Bauchschmerzen verabreichte. Sie war scharf und roch nach Ingwer, den ich damals aber noch gar nicht kannte. Und als ich sie fragte, was ich da schluckte, sprach sie von Galgant, was für mich so ähnlich wie Galgen tönte. Ich hab später in der Schulbibliothek nachgeschlagen und darüber gelesen. Seinen besonderen Geschmack habe ich jedoch nie mehr vergessen.«
So und ähnlich verliefen die drei Stunden Plauderei mit Essen, das mit einem Bubur cha-cha endete. Erst Monate später und nach Jules Einsatz in Haiti erzählte ihm Roger Spälti, was Yolida nach diesem Abend zu ihm sagte.
»Er ist ein sehr angenehmer junger Mann. Er wirkt aufrichtig und abgeklärt, sehr vernünftig und ruhig. Doch tief in ihm drin brennt ein Feuer. Ich konnte nicht spüren, ob es gut oder schlecht ist. Aber es ist vorhanden und wirkt ähnlich wie Heimweh, eine Art von Sehnsucht. Vielleicht nach einem bestimmten Menschen? Oder nach einem Ort? Vielleicht auch nur nach Ansehen, Geld oder Macht. Er scheint mir hungrig, dieser Jules. Doch nach was?«
Jules hatte laut aufgelacht und lausbübisch gegrinst, als ihm Spälti dies erzählte, hatte seinem Mentor aufmunternd auf das linke Schulterblatt geklopft und gemeint: »Deine Frau ist so klug. Grüß sie bitte nett von mir.«
*
Jules hatte sich entschieden. Er wollte noch in dieser Woche bei Lenz & Karrer kündigen und die Anwaltskanzlei verlassen. Von Heinz Keller hatte er seit zwei Wochen nichts mehr gehört und auch Roger Spälti schien sich nicht mehr um ihn zu kümmern.
»Ich versauere hier noch«, hatte er seinem Vorgesetzten am gestrigen Abend an den Kopf geworfen, »immer nur Zahlen analysieren und Berichte schreiben und nie erhält man ein Feedback, weiß nicht, wer was auf der Basis meiner Arbeit entschieden hat oder ob ich hier bloß für den Papierkorb lese und tippe.«
Sein Vorgesetzter sah ihn nur mitleidig an, setzte seinen dunkelgrauen Filzhut mit dem dunkelbraunen Seidenschweißband auf und verließ das Großraumbüro, ging wie jeden Abend exakt um Viertel nach Fünf, ließ diesmal bloß sein sonst obligates Kopfnicken zur Verabschiedung weg, als deutliche Missbilligung des Ausbruchs seines Untergebenen. Jules blieb ratlos in seinem zwei mal zwei Meter kleinen, von hohen Schallschluckwänden umschlossenen Einzelarbeitsplatz zurück, fühlte sich wie ein überdimensionierter Hamster im Käfig, fürchtete sich gleichzeitig vor der allabendlichen Rückkehr in seine Wohnung, vor der nächsten einsamen Nacht. Er erhob sich von seinem Bürostuhl, blickte über die Kante der eins sechzig hohen Wände und sah sich um. Da und dort leuchteten noch Arbeitsplatzlampen, vielleicht vergessen von längst gegangenen Kollegen, vielleicht auch die Markierungen von anderen noch emsigen Hamstern im Rad. Er setzte sich wieder hin, starrte auf die Tastatur, hob seine rechte Hand und wuchtete seine Faust mit aller Kraft auf die Buchstaben, so dass einzelne der Kunststoffkappen zerbrachen, nahm das Keyboard danach hoch und zerlegte es krachend über seinem Oberschenkel, faltete es zusammen wie einen Karton und warf es in den Papierkorb neben seinem Pult, starrte feindselig darauf nieder, schalt sich gleichzeitig einen verdammten Narren. Wie sollte er nun seine Kündigung tippen?
Erschlagen fühlte er sich, als er sich in sein Apartment mehr schleppte als ging. Im Kühlschrank fand er noch eine Block billigen Gouda-Käse und eine fast volle Tube Mayonnaise, setzte sich mit den beiden in den Händen aufs Sofa und tippte mit dem kleinen Finger auf die Fernbedienung, schaltete den Fernseher ein, blickte auf die Mattscheibe, sah nicht wirklich die Bilder, hörte auch nicht zu, drückte mechanisch die Paste aus der Tube auf den Käse und biss vom großen Stück ab, kaute flüchtig und schluckte zornig.
Zehn Minuten später war er wieder auf der Straße unten, spürte Käse und Mayonnaise wie einen harten Brocken schwer im Magen liegen, so als hätten sich die Bissen dort wieder zusammengefügt, bekam auch einen unangenehm beißenden Geschmack im Mund, peilte die nächstgelegene Bar an, in der er ab und zu einen der Abende verbrachte. Diesmal war sie kaum besucht und so konnte er sich auf seinen Lieblingshocker am Tresen setzen, ganz hinten in der Ecke, von dem aus er den Eingang beobachten konnte. Er bestellte sich einen Dry Martini, musste sich den längst schalen Bond-Spruch bezüglich geschüttelt oder gerührt vom grinsenden Barkeeper anhören, der sich im Übrigen auf einen Wodka-Martini bezog, ärgerte sich beim Kauen der Olive einmal mehr darüber, dass sie, wie fast überall in der Stadt, zuvor in Öl eingelegt war und nicht in der obligaten Lake, dachte über sein Leben nach, rief sich in Erinnerung, dass er am nächsten Morgen zuerst im Computerfachgeschäft vorbeigehen musste und eine neue Tastatur erwerben.
Ein zweiter Dry Martini folgte dem ersten und Jules dachte kurz an die US-amerikanische Schriftstellerin Dorothy Parker, die einmal gesagt haben soll: »Ich trinke gerne Martini, doch zwei sind genug, denn nach dreien liege ich unter dem Tisch und nach dem vierten unter dem Wirt.«
Jules war nicht nach Lachen oder auch nur nach Grinsen zumute. Denn was sollte er nach dem Austritt aus der Kanzlei tun? Wo sich bewerben? Welche Richtung einschlagen?
Sein Vater war ein hoher Diplomat, reiste für die Schweizer Regierung in der Welt herum und machte sich wichtig. Seine Mutter war vereinsamt, seit ihr Ehemann ausgezogen und ihre Jugend verblüht war. Sie widmete sich ausschließlich dem Alkohol und manchmal noch jungen, gekauften Liebhabern. Als einziges Kind würde er dereinst von beiden genug Geld erben, um nicht arbeiten zu müssen. Machte Arbeit Sinn, wenn man auf den Verdienst nicht angewiesen war?
Jules bestellte sich einen weiteren Martini, diesmal jedoch aus halb-halb Gin und Wodka. Der Barkeeper schüttelte ihn, ohne zuvor zu fragen, servierte ihn in einer Schaumweinschale und legte eine Zitronenzeste hinein. Nun musste Jules doch ungewollt grinsen, murmelte sogar ein: »Close but no cigar.«
»Wie bitte?«, fragte der Barkeeper zurück, hatte wohl ein Lob von Jules erwartet.
»Schon gut«, und er trank das Glas in einem Zug leer, »ich möchte zahlen.«
Als er zum Apartmenthaus kam, wartete Roger Spälti vor der Eingangstüre auf ihn, hatte wohl zuvor erfolglos bei ihm geklingelt. Jules erkannte eine ungewohnte Unruhe in den Augen seines Mentors. Spälti schien höchst verunsichert oder gar erschüttert. Die beiden Männer begrüßten sich wortkarg, denn Jules glaubte selbstverständlich, seine verbale Auseinandersetzung mit seinem Vorgesetzten hätte Roger auf den Plan gerufen und er war zu ihm geeilt, um ihm eine gehörige Standpauke zu halten. Darum fragte Jules auch gar nicht nach den Gründen für den unerwarteten Besuch. Aber auch sein Mentor erklärte nichts, während sie schweigend in der Liftkabine ins fünfte Obergeschoss fuhren und wenig später die Wohnung von Jules betraten. Spälti steuerte direkt das schmale Sofa an und setzte sich hinein.
»Hast du einen Whiskey?«, fragte ihn sein Mentor und Jules schüttelte verneinend den Kopf: »Ich kann nur mit Tequila dienen.«
»Dann her damit. Und nimm dir auch einen.«
Während Jules den Agavenschnaps aus dem Schrank holte und mit zwei Wassergläsern zurückkam, sie hinstellte und zur Hälfte mit Tequila Silver füllte, sah er Spälti fragend an, konnte sich auf das Verhalten seines Mentors keinen Reim machen.
Wollte man ihn fristlos entlassen? Oder ihm gar noch zusätzlichen Ärger bereiten? Vielleicht eine Klage wegen Zerstörung von Firmeneigentum? Anwälten war einfach Alles zuzutrauen.
Spältis offensichtliche Unsicherheit begann sich auf Jules zu übertragen. Sie prosteten sich mit ernstem Blick zu, als ginge es um einen Abschied, hoben die Gläser an, ohne etwas zu sagen, tranken jeder einen großen Schluck.
»Heinz wurde letzte Woche auf Haiti ermordet.«
Jules war einen Moment lang sprachlos. Er fühlte, wie ihm die knappe Information über den Tod seines Kollegen heiß zu Kopf stieg, wo sein bisheriger Alkoholkonsum in der Bar längst für Enthemmung und für besten Nährboden gesorgt hatte.
»Ermordet? Wie? Und von wem?«
»Man hat ihn im Lift seines Hotels überfallen und erdrosselt. Er ist wahrscheinlich einer Bande von Erpressern in die Quere geraten. Weißt du, Jules, wir versuchen dort unten schon seit ein paar Monaten drei Ferienhotels für einen unserer Klienten aus den USA zu erwerben. Er braucht sie zwar bloß als Abschreibungsobjekte für seine Steuern, doch er hat sich nun Mal in den Kopf gesetzt, dass es unbedingt Haiti und exakt diese drei Hotels sein müssen. Die lokale Schutzgeldmafia ist jedoch allzu gierig und verlangt für ihr Stillhalten dreißig Prozent des Kaufpreises. Das wären mehrere Millionen Dollar und entschieden zu viel für unseren Kunden und seine Steueroptimierung. Das würde sich für ihn nicht mehr rechnen. Heinz war für uns dort unten, um mit den Kerlen zu verhandeln und ihren Preis zu drücken. Wahrscheinlich hat man ihn bloß umgebracht, um uns vor Augen zu führen, wie wenig wir in ihrem Machtbereich auszurichten vermögen.«
Der Redeschwall von Spälti sollte von so viel ablenken, von seiner Verunsicherung über den Tod eines jungen Mitarbeiters, vom Gefühl der Verantwortung und des eigenen Versagens.
»Und du schickst nun mich hinunter?«
Erst nachdem er es ausgesprochen hatte, wurden Jules seine eigenen Worte bewusst. Spälti sah ihn auch erstaunt an, ob gespielt oder echt: »Wie kommst du denn darauf?«
»Na, du hättest mir die Umstände um den Tod von Heinz bestimmt nicht erzählt, wenn du das nicht vorhättest.«
Roger schaute Jules einen Moment lang forschend an.
»Nur wenn du willst, Jules, nur wenn du wirklich willst.«
Der Alkohol und seine plötzliche Wut ließen Jules keine Wahl.
»Lass für mich bitte einen Sitzplatz im nächsten Flugzeug buchen und gib mir alle Informationen und Berichte, die wir über den Auftrag besitzen.«
»Dein Flug geht morgen, nein, heute früh um halb neun ab Kloten. Ticket und alle Informationen findest du an deinem Arbeitsplatz.«
Spälti nahm erneut das Glas zur Hand und stürzte den Rest Tequila hinunter, erhob sich und reichte Jules seine Hand, aber nicht zum Abschied.
»Für Heinz«, meinte sein Mentor feierlich, beinahe salbungsvoll, so als wollte er Jules für den mit Sicherheit sehr gefährlichen Auftrag in Haiti segnen, ähnlich einem Priester vor der Schlacht die Soldaten. Der grinste schief zurück.
»Für Heinz.«
*
Die Air France brachte Jules über Paris und New York in die Karibik und nach Port-au-Prince. Die von der Anwaltskanzlei zusammengestellten Informationen waren in einem gut gefüllten Bundesordner untergebracht, der auf dreihundert Seiten nicht nur den Auftrag des US-amerikanischen Kunden exakt beschrieb, selbstverständlich ohne Namensnennung, sondern auch alle Umstände, wie Heinz in Haiti vorgehen sollte und welche Kontakte er dort besaß. Daneben war umfangreiches Material zur bewegten Geschichte dieses Landes und zu den Besonderheiten der aktuellen Politik und der Wirtschaft vorhanden. Bereits 1791 kam es zu Sklavenaufständen, gefolgt von französischer Besatzung und Bürgerkrieg. 1804 wurde in Haiti die erste freie Nation Lateinamerikas ausgerufen. Doch der Kampf um die Macht zwischen den fünf Prozent Mulatten, die sich als eigentliche Herrschaftsklasse sahen, und den über neunzig Prozent Schwarzen, dauerte über viele Jahrzehnte an, schien sogar bis in die Neuzeit das Zusammenleben zu stören. Nach der über dreißig Jahre andauernden Diktatur der Duvaliers ernannte sich vor zwei Jahren General Namphy zum Präsidenten und ließ eine neue Verfassung mit Präsidialsystem, einem Abgeordnetenhaus und einem Senat ausarbeiten. Doch die Wahlen 1987 mussten abgebrochen werden, weil die immer noch zahlreichen Duvalier-Anhänger alle wahlwilligen Bürger bedrohten und manche sogar ermordeten. Der dann im Januar 1988 gewählte Präsident Manigat war eher eine Marionette der Armeeführung und stand von Beginn an auf wackligen, politischen Füssen. Jederzeit konnte das Militär erneut die Macht an sich reißen und so war Haiti derzeit ein wahrer Hexenkessel, in dem die Armeeführung, Duvalier-Anhänger und viele andere Parteien und Politiker kräftig rührten und sich darum niemand um das organisierte Verbrechen kümmerte oder sich gar mit ihm wirtschaftlich verband.
Jules las auf dem langen Flug die Informationen mehrmals durch, dachte nach, strich in Gedanken auf der Liste seiner möglichen Kontakte in Port-au-Prince alle Namen bis auf einen. Nelson Sloanne Larue hatte für Lenz & Karrer in Washington gearbeitet, war vor zwei Jahren in die Heimat zurückgekehrt und hatte eine Bar direkt am Hafen eröffnet. Ihn wollte Jules als einzigen aufsuchen, versprach sich von ihm nicht nur Informationen über die Stadt, sondern vor allem auch Verschwiegenheit und damit Sicherheit vor der Polizei und anderen Interessengruppen.
Die Kanzlei hatte für ihn ein Zimmer im Hotel Oloffson reserviert, wo bereits Heinz Keller untergebracht war und ermordet wurde. Jules dachte jedoch keinen Moment lang daran, dort auch tatsächlich abzusteigen. Stattdessen hatte er sich auf JFK einen Reiseführer gekauft und sich selbst kundig gemacht.
Nachdem er seinen Koffer vom Transportband genommen und auf das Wägelchen gestellt, dieses an anderen Passagieren und am Zoll vorbei dirigiert hatte, übersah er bewusst den dunkelhäutigen Mann im schwarzen Billig-Anzug und der Chauffeur-Mütze, der mit einem Kartonschild in der Hand auf ihn wartete und alle ankommenden Fluggäste kurz musterte. Jules warf einen gelangweilten Blick auf seinen Namen, ließ seine Augen gleich weiterwandern, wurde vom Anzug-Mann nicht mehr beachtet. Draußen stieg er ins nächste freie Taxi und nannte die Adresse. Der Mann sprach nur ein paar Brocken Französisch oder war an einer Unterhaltung nicht interessiert. Jedenfalls kam auf der kurzen Fahrt hinauf in die Hügel kein Gespräch auf. Wie gewünscht hielt der Wagen vor der Casa Emanuela Grandis, einem einfachen Bed & Breakfast und Jules bekam wenig später ein spartanisch eingerichtetes, kleines, aber sehr sauber gehaltenes Zimmer, hatte beim Einchecken zudem eine Broschüre mit Stadtplan überreicht erhalten. Der Weg hinunter zum Hafen war recht weit und Jules benötigte für ihn zu Fuß eine gute halbe Stunde, stand dann aber vor der Miracles Bar und schüttelte seinen Kopf, denn sie lag nicht am Hafen, wie in den Unterlagen von Lenz & Karrer vermerkt, sondern mehrere hundert Meter entfernt in der Innenstadt.
Was stimmte wohl noch alles nicht an all den zusammengetragenen Informationen im Dossier der Kanzlei?, fragte sich Jules unweigerlich, als er mit den Händen die Perlenketten vor dem Eingang teilte und ins Halbdunkel eintrat. Viel los war nicht an diesem späten Nachmittag. Zwei sehr dunkelhäutige junge Männer saßen an einem der Tischchen so nahe beisammen, dass sie sich flüsternd unterhalten konnten. Eine immer noch hübsche Frau von vielleicht Mitte dreißig stand hinter dem Tresen und taxierte ihn, den braungebrannten und trotzdem weißhäutigen Europäer, der sich wahrscheinlich hierher verlaufen hatte. Jules nickte ihr wie entschuldigend zu und setzte sich auf einen der Hocker, stellte seine Ellbogen auf die Platte, lächelte die Barkeeperin gewinnend an.
»Hi, einen Daiquiri, please?«
Jules hatte sich für Englisch entschieden. Zwar sprach er Französisch wie eine zweite Muttersprache. Doch eines hatte ihm Roger Spälti noch am Abend zuvor eingebläut: »Lass dich deine Feinde und auch deine Freunde stets so lange wie nur möglich unterschätzen. Mit offenen Karten spielen bloß Idioten, Bluffer und Verlierer.«
»War das eine Frage oder eine Bestellung?«, kam es in erstaunlich gutem Englisch zurück. Die Frau hinter dem Tresen lächelte nicht dazu, blickte ihren neuen Gast sogar recht abweisend oder missbilligend an.
»Eine Bestellung«, meinte Jules immer noch lächelnd, »doch ich hätte tatsächlich eine Frage«, wobei er seine Stimme senkte, um die Frau näher zu sich zu locken und vertraulicher mit ihr reden zu können. Doch sie blieb stehen, wo sie war, machte auch keine Anstalten, seinen Cocktail zu mischen, verschränkte ihre Arme vor der Brust.
»Ist Nelson Larue zu sprechen?«, fragte Jules deshalb lauter, als er es gerne getan hätte.
»Nelson Sloanne Larue«, berichtigte ihn die Barkeeperin und er nickte zustimmend.
»Um was geht es?«, kam die Gegenfrage nun scharf zurück.
»Das möchte ich nur mit Nelson direkt besprechen.«
Die Augen der Frau schweiften kurz hinüber zum Tisch mit den beiden jungen Männern, dann schwenkte ihr Kopf kurz in Richtung Ausgang. Die zwei erhoben sich sogleich und gingen hinaus, stellten sich jedoch links und rechts neben dem Eingang auf, so als müssten sie ihn bewachen. Jules schluckte trocken, fühlte ein mulmiges Gefühl im Magen, auch wenn er keine Gefahr oder Feindseligkeit spürte.
»Was wollen Sie von mir?«, fragte die Frau.
»Von Ihnen?«, meinte Jules erstaunt.
»Ja, Sie suchen nach mir?«
Der Schweizer starrte die Frau dämlich an, worauf sie das erste Mal lächelte, wenn auch spöttisch: »Nelson JOANNE Larue. Kapiert?«
Jules nickte.
»Also?«
Ohne seine Antwort abzuwarten, begann sie nun doch seinen Daiquiri zu mischen.
»Ich komme von Lenz & Karrer.«
»Sie sind wegen Heinz Keller hier?«
»Ja und nein«, wich der Schweizer aus, worauf ihn die Frau forschend musterte.
»Ich will zwar die Schwierigkeiten beseitigen, wegen denen Heinz sterben musste, aber auch seinen Mörder finden. War Heinz denn öfters hier bei Ihnen Gast?«
Nelson Joanne nickte: »Ja, das letzte Mal an dem Abend als er ermordet wurde.«
Die Frau schien bedrückt. Machte sie sich Vorwürfe? Hatte sie seinen Kollegen womöglich falsch beraten? Hatte sich an seinem Tod schuldig gemacht? Oder steckte sie weit tiefer in der Sache drin, als Lenz & Karrer vermuteten? War sie weniger Informantin als vielmehr Mitglied der lokalen Erpresser-Mafia? Eine Mittäterin?
Auch wenn Jules die Erfahrung fehlte. Von dieser Frau ging keine Falschheit aus. Er fühlte nur Anteilnahme und ein gewisses Interesse.
»Können Sie mir denn weiterhelfen? Wissen Sie, wer hinter der Ermordung steckt? Kennen Sie vielleicht sogar die Täter? Man hat mir gesagt, Heinz wurde im Aufzug im Hotel Oloffson erdrosselt. Sind seine Mörder dort zu suchen? Unter den Angestellten?«
Nun blickte ihn Nelson Joanne mitleidig an, nahm ihre Unterlippe zwischen die Zahnreihen, fragte sich wahrscheinlich, ob sie diesem so naiv wirkenden Europäer etwas erzählen sollte. Jedenfalls spürte Jules eine gewisse Abneigung, aber nicht unbedingt gegen seine Person, sondern eher gegen seine Frage.
»Das Oloffson besitzt gar keinen Aufzug«, gab sie ihm dann doch eine Information, auf die er bei einem Besuch des Hotels von selbst gestoßen wäre. Jules schaute irritiert.
»Wussten Lenz & Karrer wirklich nichts Besseres, als einen weiteren Welpen nach Port-au-Prince zu schicken und zu verheizen?«, fügte sie etwas boshaft oder womöglich auch frustriert hinzu. Der Schweizer fühlte sich gekränkt und gleichzeitig herausgefordert, warf sich in die Brust.
»Sie unterschätzen mich vielleicht.«
Nelson Joanne taxierte ihn noch einmal, sah ihm für Sekunden tief in die Augen, schien seine Seele zu erkunden oder auch nur seine Entschlossenheit.
»Ja, das ist möglich«, schloss sie ihre Untersuchung ohne konkretes Ergebnis ab. Doch zumindest war leichter Zweifel herauszuhören. Sie stellte den fertigen Daiquiri vor ihm hin, nahm sich selbst ein Wasserglas und füllte zwei fingerbreit Havanna Club ein, prostete ihm zu.
In der folgenden halben Stunde erfuhr Jules alles, was Nelson Joanne über den Verkäufer der drei Hotelanlagen wusste, über die örtliche Immobilien-Mafia und deren Verbindungen in die höchsten Kreise des Militärs. Auch über drei mächtige Straßengangs, bei denen man fast beliebig Auftragsmorde bestellen konnte, wurde er eingehend informiert.
»Ich weiß nicht, warum die Zentrale in Washington einen so unerfahrenen Mann wie Heinz Keller hierhergeschickt hat. Er war der Aufgabe schlichtweg nicht gewachsen. Mit seinem Auftreten verunmöglichte er von Anfang an jede vernünftige Lösung.«
»Mein Mentor bei Lenz & Karrer hat gemeint, Heinz wurde möglicherweise nur als eine Art Warnung ermordet«, stocherte Jules nach.
»Und wer ist ihr Mentor?«
»Roger Spälti. Kennen Sie ihn vielleicht?«
»Ich lernte ihn vor Jahren kennen, als ich noch in Washington arbeitete. Hätte ich gewusst, dass Spälti Ihr Mentor ist, ich hätte Sie wohl etwas freundlicher empfangen.«
Jules registrierte, dass sie seinen Mentor beim Nachnamen nannte. Wahrscheinlich hatten die beiden also nie ein Verhältnis miteinander, noch nicht einmal besonders engen Kontakt.
»Meiner Meinung nach wurde Heinz Keller ermordet, um den US-Investor zu einem raschen Nachgeben zu zwingen.«
»Und warum die Eile?«
Nelson Joanne lachte trocken, beinahe gehässig auf: »Unser neuer Präsident, Leslie Manigat, hat bereits damit begonnen, den Einfluss des Militärs zurückzudrängen. Falls ihm dies gelingen sollte, werden die örtlichen Mafia-Gruppierungen bald einmal nicht mehr an die Generäle zahlen…«
»…sondern an die neuen politisch Mächtigen?«, schloss Jules die Erklärung von Nelson Joanne gleich selbst ab. Sie nickte zustimmend.
»Der arme Heinz. Er kam zwischen Hammer und Amboss, geriet zwischen die Interessen der Armee und der Politiker. Zwei Tage vor seiner Ermordung schlug er sich mit einer Straßengang herum und verprügelte drei oder vier der Kerle. Er dachte wohl, damit hätte er sich erst einmal Respekt verschafft.«
»Hatten Sie und Heinz etwas miteinander?«, rutschte Jules ungewollt eine peinliche Frage heraus. Nelson Joanne war ihm aber nicht böse, lächelte sogar nachsichtig: »Heinz war ein feiner Kerl, aber nicht mein Typ.«
Fast hätte Jules sie nun gefragt, ob vielleicht eher er ihrer Vorstellung entsprach, konnte sich diesmal aber zurückhalten. Doch das amüsierte Lächeln von Nelson Joanne bewies ihm, dass sie den mit ihrer Antwort wohl bewusst provozierten Gedanken in seinem Gehirn von seinem Gesicht abgelesen hatte.
»Dann steckt Ihrer Meinung nach also das Militär hinter der Ermordung meines Kollegen?«
Jules erwähnte den Namen bewusst nicht mehr, versuchte so Distanz zwischen Nelson Joanne, Heinz Keller und sich selbst aufzubauen.
»Mit Sicherheit. Denn nur die Armee und der Geheimdienst verfügen über genügend Macht, um den Mord an einem Ausländer derart zu verfälschen. Und der Geheimdienst dürfte längst für Präsident Manigat arbeiten.«
»Und wer hätte beim Militär genügend Macht für eine Verfälschung? Können Sie mir einen Namen nennen?«
Nelson Joanne lächelte erneut mitleidig.
»Von wem wird denn die Armee befehligt?«, fragte sie anzüglich zurück.
»Namphy?«, vergewisserte sich Jules und die Frau nickte leicht.
Die Schultern des jungen Schweizers sanken etwas ein. Wie sollte er den Oberbefehlshaber der Armee zur Rechenschaft ziehen? An ihn heran kam er mit Sicherheit nicht. Falls aber General Namphy tatsächlich die Ermordung von Heinz Keller zu verantworten hatte, machte es kaum Sinn, an seiner Stelle irgendwelche untergeordneten, ausführenden Schergen aufzuspüren und zu bestrafen.
»Wollen Sie immer noch Rache nehmen?«
Nelson Joanne meinte ihre Frage zumindest diesmal nicht etwa sarkastisch, sondern schien durchaus an der Antwort interessiert.
»Haben Sie etwa Beweise für eine Beteiligung von General Namphy?«
Sie lachte kurz und laut auf.
»Wer in Haiti lebt, braucht keine Beweise, erfährt die Macht und die Gewalt der Militärs jeden Tag, kennt ihre engen Verbindungen zur Mafia, ihre Beteiligung an Schutzgelderpressungen, ihre Förderung der Korruption.«
»Das ist mir zu wenig.«
Erneut lachte Nelson Joanne auf, diesmal hell und anzüglich: »Ja, Mister, Sie haben sich Ihren Auftrag bestimmt simpler vorgestellt.«
»Genauso wie Heinz Keller?«, fügte Jules an und die Frau hinter dem Tresen nickte.
»Sie sollten wieder abreisen. Richten Sie Spälti aus, dass der US-Bonze die geforderte Summe einfach bezahlen soll und gut ist. Oder er soll seine Idee einfach vergessen.«
Jules zögerte mit einer Antwort, worauf Nelson Joanne weiterfuhr: »So laufen die Geschäfte nun mal hier in Haiti. Wer sich damit nicht abfinden kann, soll wegbleiben oder er muss sich eine eigene Armee mitbringen.«
Nachdenklich erhob sich Jules, dankte der Frau und wollte gehen.
»Zwei US-Dollar«, rief sie ihn zurück und er blieb irritiert stehen, sah auf das fast leere Glas mit dem Rest vom Daiquiri, kam zurück und legte eine 5-Dollar-Note auf den Tresen.
»Darf ich wiederkommen?«, fragte er sie dann doch noch und schaute die Frau aufmerksam an.
»Dies ist zwar kein freies Land, aber zumindest ein öffentliches Lokal«, gab sie vage und auch schnippisch zurück.
Das Oloffson stellte sich wenig später als imposanter, aber ziemlich heruntergekommener Bau heraus. Auch im Innern stieß man überall auf Erneuerungsbedarf. Verschlissener, fleckiger Teppichboden, zerkratztes Parkett, schmutzige Wände und herab rieselnder Putz. Die Mitarbeitenden allerdings waren ausgesprochen freundlich und zuvorkommend. Sie zeigten auch den seltsamen Stolz von Menschen, die sich selbst als unbedeutend einstuften, jedoch ihrer Meinung nach für etwas Bedeutendes arbeiteten, auch wenn dessen ehemaliger Glanz längst verloren gegangen war und nur noch aus Erinnerungen bestand. Jules gab sich als Tourist aus, der im Reiseführer vom historischen Hotel gelesen hatte. Eifrig wurde er von einem livrierten Kellner im Erdgeschoss herumgeführt, bekam Erklärungen zu den Räumen und der Geschichte des Hauses. Er bedankte sich mit einer 5-Dollar-Note und verließ das Hotel, schlenderte die Straßen hinauf und zurück zum Bed & Breakfast, kaufte sich unterwegs an einem Straßenstand zwei Hot Dogs, schlenderte nachdenklich weiter, kaute geistesabwesend, ließ die Informationen von Nelson Joanne und seine bisherigen, persönlichen Eindrücke von Land und den Leuten ineinanderfließen, versuchte sich an einem Gesamtbild. Die Dämmerung setzte ein, die Leute gingen nach Hause, Passanten und Fahrzeugverkehr nahmen in den Straßen rasch ab. Nur unbewusst hörte der Schweizer ein Motorrad hinter sich aufheulen, registrierte beinahe zu spät den geplanten Überfall, drehte seinen Kopf fast im letzten Moment herum, erkannte den geschwungenen Baseballschläger in der Hand des Beifahrers, ließ sich instinktiv rückwärts zu Boden fallen, sah den Keulenkopf undeutlich an seinem Gesicht vorbei wischen, rappelte sich rasch wieder auf, sah das Motorrad stoppen und die beiden Männer absteigen und drohend auf ihn zukommen.
»Money … Money«, befahl ihm der eine Kerl mit schauderhaftem, französischem Akzent, schwang dazu drohend die Keule, während der andere bloß fordernd seine Hand ausstreckte. Jules ließ die beiden noch etwas näher herankommen, versuchte sich an einem ängstlich wirkenden Gesichtsausdruck, kramte nervös in seinen Jackentaschen, so als suchte er nach Geld. Doch dann tauchte er unvermittelt unter den erhobenen Armen mit dem Baseballschläger durch und knallte dem Kerl seinen rechten Unterarm gegen die Kehle, packte ihn beim Herumwirbeln mit der anderen Hand am Hals und brachte ihn so aus dem Gleichgewicht, zerrte ihn zu Boden, stellte seinen linken Fuß auf dessen Gurgel und sah den Motorradfahrer wild an, rief ihm ein Verächtliches »Allez, balourd!« zu.
Der blickte noch einmal kurz zu seinem Kumpanen am Boden, der verzweifelt versuchte, den Fuß von Jules wegzustoßen, sah dem vermeintlichen Opfer die Selbstsicherheit an und dass dieser bestimmt noch weitere Tricks kannte. Zögernd und umsichtig wich er zurück, bis er sich auf den Sitz schwingen und das Motorrad starten konnte. Er drehte um und brauste an Jules und seinem Kumpanen vorbei die Straße hinunter, ließ eine langgezogene, blaue Abgaswolke zurück.
Der Schweizer ließ den anderen Kerl nun endlich los, ging hinüber zur fallengelassenen Keule, hob sie auf und zerbrach sie über seinem Oberschenkel, warf die beiden Teile im weiten Bogen die Straße hinunter. Danach ging er seelenruhig weiter, kümmerte sich nicht weiter um den Angreifer, der sich aufgesetzt hatte und sich immer noch keuchend den Hals rieb.
Nein, keinen Moment lang dachte Jules an einen geplanten Angriff irgendeines Widersachers. Er hatte sich bloß dämlich wie ein Tourist angestellt, war bei einbrechender Dunkelheit immer noch zu Fuß unterwegs gewesen, von jedermann sogleich als Ausländer erkennbar, hatte zudem seine Gedanken ganz woanders gehabt, war zu offensichtlich als ein wehrloses Opfer erschienen.
Der Schweizer hatte allerdings den jungen Mann übersehen, der immer noch im Schatten der Häuser verharrte und zuvor dem Überfall unbeweglich, aber interessiert zugeschaut hatte. Erst als Jules weit genug entfernt war, trat er zurück auf den Gehsteig und schlenderte nachdenklich in Richtung Hafen davon.
*
Auch am nächsten Morgen beim Frühstück hatte sich Jules noch nicht entschieden. Wie unvernünftig doch sein Zorn über den Tod von Heinz war, die dumm sein Anspruch, hierher in dieses ihm völlig fremde Land zu reisen, um den Mord an einem Kollegen zu rächen und die Probleme der Kanzlei zu lösen.
Stolz war in den meisten Situationen ein schlechter und gefährlicher Ratgeber, vor allem wenn man die jeweilige Kultur des Stolzes gar nicht kannte. Denn Stolz verspürten alle Völker der Erde und die allermeisten Menschen. Doch worauf sich dieser Stolz bezog, war sehr unterschiedlich. Im Westen bildeten oft Geld und Macht, aber auch bloße Überheblichkeit die Grundlagen. In arabischen Ländern waren Herkunft und persönliche Ehre entscheidend, während in afrikanischen und asiatischen Regionen die Familie das wichtigste Statussymbol nach außen hin blieb. Doch hier in der Karibik? Aufgrund ihrer Geschichte hatten die Einheimischen bestimmt einen natürlichen Stolz gegenüber allen Ausländern entwickelt, trotz jahrzehntelanger Diktatur, trotz anhaltender Ausbeutung und trotz fehlenden oder zumindest höchst mangelhaften staatlichen Institutionen und sozialen Netzen. Denn ähnlich wie die kleine Schweiz, hatten sich auch die Haitianer von den Fesseln ausländischer Mächte mit Gewalt befreit, hatten sich den Respekt der Welt verdient und sich ihren eigenen, wenn auch steinigeren Weg gesucht.
Jules dachte an die Verkaufsstände an den Straßen, an denen für wenige haitianische Cent Lehmkuchen verkauft wurden. Auch das Rezept dieser Hungerunterdrücker fand er in den Unterlagen der Kanzlei, diesmal ihm als dringende Warnung dienend. Unter ein Kilogramm Lehm wurden fünf Gramm Salz und hundert Gramm billigste Margarine mit etwas Wasser gemischt und der so entstandene Brei an der Luft getrocknet. Giftig waren die Dinger in der Regel zwar nicht und sie erfüllten durchaus ihren Zweck, gaukelten dem Magen ein Völlegefühl vor, das über Stunden anhielt, während der Körper trotzdem weiter hungerte. Auch das Fleisch in den Würstchen der beiden verzehrten Hot Dogs am gestrigen Abend war nicht über jeden Zweifel erhaben gewesen. Doch sie schwammen zuvor in sauber aussehendem und vor allem dampfend heißem Wasser. Ab 70 Grad Celsius wurden fast alle Bakterien abgetötet, wie Jules wusste, und nur noch wenige giftige Pilzsporen konnten sich bei diesen Temperaturen vermehren. Das Brot allerdings war matschig gewesen, obwohl bestimmt am selben Tag gebacken. Doch in der Schwüle des Tages verdarben Mehlprodukte rasch. Einen US-Dollar hatte man ihm für die beiden eher missglückten Sattmacher abgeknöpft, ein Wucherpreis verglichen mit dem, was die Einheimischen bezahlten, ein Bettelgeld jedoch für jeden Touristen und trotzdem eher ein Magenbetrug und bestimmt keine Gaumenfreude.
Seine Gastgeberin, Emanuela Grandis, eine füllige Mulattin mit gewaltigen Hängebrüsten und einem runden, gemütlichen Gesicht mit warmherzigen Augen, setzte sich zu ihm, als Jules am nächsten Morgen als letzter Frühstücksgast noch am Tisch bei seiner zweiten Tasse Tee saß.
»Haben Sie für heute besondere Pläne, Monsieur?«, fragte sie in einem leidlichen Englisch mit dem weichen Akzent vieler Französisch-Muttersprachlichen und der Betonung der letzten Silbe in fast allen Wörtern.
»Nein, Madame Grandis, das heißt, ich habe mich noch nicht entschieden.«
»Sie sollten ein paar unserer Museen besuchen. Und selbstverständlich auch die Kathedrale«, wollte sie weitere Informationen über den Grund des Aufenthalts ihres seltsamen Gastes herausfinden, der sich gestern ohne jede Reservierung von einem Taxi direkt hierherfahren ließ und dem die Höhe des Zimmerpreises völlig egal schien.
Jules musste lächeln.
»Vielleicht könnten Sie mir ein wenig von Ihrem schönen Land und den Menschen erzählen?«
Die Mulattin sah ihn prüfend an. Die Flügel ihrer breiten Nase blähten sich für einen Moment auf. Sie ahnte wohl ein Geheimnis, zumindest etwas Ungewöhnliches und einige Aufregung Versprechendes.
»Was möchten Sie denn gerne erfahren?«
»Was wissen Sie über General Namphy? Oder Präsident Manigat?«
Emanuela Grandis sog scharf die Luft durch ihre Nase ein und ihr Gesichtsausdruck wechselte von fröhlich zu vorsichtig.
»General Namphy hat uns den Frieden gebracht. Er wurde zum Vater aller Haitianer. Und Präsident Manigat? Er ist ein Unruhestifter. Ich habe ihn nicht gewählt. Wussten Sie, dass er vor Jahren in Venezuela lebte und von dort aus Pläne schmiedete, um die Macht in Haiti mittels Staatsstreich an sich zu reißen? Ich traue keinem Menschen, der nicht einmal vor dem Einsatz von Gewalt zurückschreckt.«
»Und General Namphy ist nicht gewalttätig?«
»Nach dem Fall der Duvaliers musste jemand die Macht zum Wohle des Volkes übernehmen. Das Land wäre sonst in einem Bürgerkrieg versunken.«
»Hat Namphy seine Karriere nicht unter den Duvaliers begonnen?«
Die Bed & Breakfast Betreiberin sah ihren Gast aus Europa missbilligend an.
»Wir alle mussten uns mit den Duvaliers irgendwie arrangieren, waren von ihrem Wohlwollen abhängig. Das können Sie General Namphy doch nicht vorwerfen?«
Jules nickte zustimmend versöhnlich.
»Und heute? Wer hält heute die Fäden der Macht in der Hand? Wer lässt die Puppen nach seinem Willen tanzen? Ist es bereits Präsident Manigat und seine Verbündeten oder noch immer General Namphy mit seinen Leuten?«
Der Gesichtsausdruck der Frau wurde erneut vorsichtig, ja, sie schien längst zu bereuen, sich mit dem Schweizer auf dieses Gespräch eingelassen zu haben. Sie machte eine Körperbewegung, als wollte sie sich vom Stuhl erheben und weggehen, entschied sich dann doch zum Bleiben.
»Sie sollten nicht solche Fragen stellen, Monsieur Lederer. Das kann hier in Haiti schnell zu gefährlichen Missverständnissen führen.«
Damit stand sie nun doch auf und drehte sich ab, um zu gehen. Jules hielt sie jedoch mit einer weiteren Frage noch einmal zurück: »Wenn ich hier in Haiti ein Haus kaufen wollte, sagen wir mal, ein Hotel, an wen müsste ich mich da wenden?«
Emanuela Grandis stutzte, dachte nach, wahrscheinlich jedoch nicht über einen Namen, sondern bloß über das mögliche Risiko, das sie mit einer ehrlichen Antwort einging.
»Ich meine eine Person, die sämtliche rechtlichen und politischen Probleme für mich lösen kann«, stocherte Jules nach.
»Avocat Muller, an der Rue Eden«, gab sie ihm nun doch Auskunft, biss sich gleich danach auf die Unterlippe, als hätte sie etwas Falsches gesagt.
»Kann mir diese Kanzlei denn in jedem Fall weiterhelfen, egal, ob eher die alte oder ob die neue Regierung vom Kauf betroffen ist?«
»Avocat Muller ist Avocat Muller«, gab sie kurz angebunden zurück, als hätte Jules am Sockel einer Gottheit rütteln wollen. Doch dann wandte sich die füllige Mulattin abrupt von ihm ab und verließ den Frühstücksraum fast fluchtartig.
*
Sie schien klein und unbedeutend. Auch wies nichts auf Immobiliengeschäfte hin. Muller & Cie. war auf dem Bronzeschild an der Eingangstüre zu lesen, ohne Hinweis auf eine Kanzlei oder ein Notariat. Jules klingelte und nach ein paar Sekunden öffnete sich die schwere Holztür elektronisch und mit kurzem Summton, sprang einen schmalen Spalt weit auf. Der Schweizer trat in ein großzügiges Vorzimmer, hinter dessen einzigem Pult eine verbrämt dreinblickende, dunkelhaarige Frau von sechzig oder mehr Jahren saß und ihn durch eine schwarze Hornbrille kritisch musterte.
»Bonjour, Monsieur, vous désirez?«
»Ich komme für eine Auskunft«, quittierte Jules die französisch gestellte Frage mit einer Antwort in Englisch.
»Um was geht es?«
Die etwas bärbeißig wirkende Vorzimmerdame hatte sich seinem Englisch nahtlos angepasst.
»Ich soll für einen Klienten einige Immobilien hier in Haiti erwerben und suche einen erfahrenen Rechtsbeistand, der mich beraten und anleiten kann. Man hat mir Mister Muller wärmstens empfohlen.«
Sie blickte ihn forschend abschätzend an.
»Woher kommen Sie?«
»Aus Europa. Doch der Käufer der Immobilien ist US-Amerikaner. Stellt das ein Problem dar?«
Sie gab ihm keine Antwort: »Avocat Muller ist ein sehr beschäftigter Mann. Ich weiß nicht, ob er die Zeit findet …«
»Wenn er mir nur zwei Minuten gewährt. Ich bin mir sicher …«
Die Frau lächelte Jules auf einmal derart freundlich an, dass er sich verunsichert gleich selbst unterbrach.
»Monsieur Muller kann Sie jetzt empfangen. Bitte treten Sie ein.«
Damit wies sie auf eine der drei Bürotüren, die aus dem Vorzimmer führten. Jules überflog das Pult der Vorzimmerdame, sah das Kästchen mit den Lämpchen und dem grünen Schein reflektiert an ihrer Hand, blickte hoch zur Zimmerdecke und erkannte die Kamera, nickte der Frau zu.
»Vielen Dank, Misses…?«
Sie antwortete ihm nicht, sondern widmete sich wieder irgendeiner Schreibarbeit, so als hätte sie ihn nicht gehört.
Jules klopfte kurz und leise an die von ihr bezeichnete Tür und trat ein. Rechtsanwalt Muller stellte sich als ein schlanker Mann von mindestens fünfundsechzig Jahren heraus. Er besaß graues, kurzgeschnittenes Haar, einen sauber gestutzten Knebelbart, der wie ein schmutziger Eiszapfen an seinem Kinn hing und kleine, listig-flinke und aufmerksame Augen, die vom ersten Moment an eine suggestive Kraft auf Jules ausübten.
»Bitte, Mister Lederer.«
Jules war sich sicher, bislang seinen Namen noch gar nicht genannt zu haben, auch nicht gegenüber der Vorzimmerdame, und war entsprechend perplex.
»Sie kennen mich?«, fragte der Schweizer darum ehrlich erstaunt und reichte dem Anwalt, Notar oder Advokat die Hand. Dessen Rechte fühlte sich fest und kühl an, schien allzeit beherrscht und bot der seinen exakt so viel Gegendruck, wie notwendig war, um Stand zu halten, aber kein Quäntchen mehr. Muller hieß Lederer bitte Platz zu nehmen.
»Lassen Sie mich mit zwei Fragen beginnen«, riss Jules das Gespräch vorerst an sich und fuhr auch gleich fort, als er Muller stumm nicken sah, »wie darf ich Sie ansprechen? Mister Muller? Oder Avocat Muller? Notaire?«
»Mister genügt vollkommen.«
»Und woher kennen Sie meinen Namen?«
Der Anwalt lächelte, jedoch nicht etwa fröhlich, freudig, mitleidig oder arrogant, sondern entwaffnend amüsiert.
»In Port-au-Prince geschieht wenig Wichtiges, von dem ich nicht erfahre.«
»Und meine Ankunft war wichtig? Für wen denn?«
Das Schulterzucken von Muller zeigte dem Schweizer, dass ihm sein Gegenüber keine Antwort geben würde.
»Dann wissen Sie bereits, warum ich hier bin?«
Muller nickte, wirkte gleichmütig.
»Das war bereits Ihre vierte Frage, Mister Lederer«, stellte er dann aber klar und nahm Jules die Gesprächsführung elegant aus der Hand.
»Ich kannte auch Ihren Vorgänger, diesen Heinz Keller.«
»Heinz war bei Ihnen?«
Jules Alarmglocken begannen zu schrillen.
»Nein, ich habe ihn nie persönlich getroffen. Heinz Keller war, wie soll ich es am besten ausdrücken…?«, Jules zweifelte keinen Moment daran, dass Muller sich seine Worte längst zurechtgelegt hatte und bloß rhetorisch mit ihm und der Situation spielte, »er war so unbedarft, der junge Mann, so stürmisch und von sich selbst überzeugt.«
Jules sah seinen früheren Kollegen und Trainingspartner vor sich, erinnerte sich an ihr letztes Telefongespräch.
»Heinz wollte meistens mit dem Kopf durch die Wand.«
»Sie sagen es, Mister Lederer, Sie sagen es. Leider ließ sich Ihr Herr Kollege gar nicht raten.«
»Sie haben ihm Ihre Hilfe angeboten?«
Muller nickte, wirkte sogar ein wenig bekümmert.
»Ja, als ich von seinen Problemen erfuhr, ließ ich Kontakt zu ihm aufnehmen.«
»Doch Heinz lehnte ab?«
Wieder das zustimmende, stumme Nicken des Anwalts.
»Wie viel kostet denn Ihr Ratschlag?«, wollte Jules nun Gewissheit haben.
»Achthunderttausend amerikanische Dollar«, gab Muller, ohne mit der Wimper zu zucken zurück.
»Und sämtliche Probleme lösen sich mit der Zahlung dieser Summe für uns in Luft auf?«, fragte Jules ungläubig zurück, denn achthunderttausend waren weniger als zehn Prozent der Kaufsumme der Hotels und weniger als ein Drittel der Forderung der Erpresserbande.
»Ja, selbstverständlich, Mister Lederer«, meinte der Anwalt gelassen und saß dabei unerschütterlich ruhig hinter seinem breiten Mahagoni-Schreibtisch.
»Und warum hat Heinz nicht …?«, der Schweizer schien ratlos.
»Wie gesagt, Mister Lederer, es kam nie zu einer Unterredung. Ihr Kollege zog es vor, wie beschrieben Sie es eben? He wanted to break through walls with his head?«
Diesmal nickte Jules, jedoch nicht nur zustimmend, sondern überaus grimmig.
*
In den nächsten Tagen telegraphierte Jules mit Zürich und Washington, erhielt die Zusage für die Achthunderttausend, leitete die Überweisung des Betrags auf ein Konto von Muller ein. Welche Fäden im Hintergrund gezogen wurden, das erfuhr der Schweizer nicht. Doch der US-Investor kam eine Woche später nach Port-au-Prince, unterzeichnete ein paar Verträge und flog noch am selben Abend zurück nach New York. Nicht einmal bedankt hatte er sich bei Jules. Für ihn war das Haiti-Geschäft reine Routine, ein unwichtiger Nebenschauplatz seiner Geschäfte. Und zur Beseitigung jeglicher Probleme bezahlte er schließlich Lenz & Karrer. Jules blieb nach der Verabschiedung des Amerikaners noch ein paar Minuten bei Muller sitzen.
»Nun werden Sie wohl bald nach Europa zurückfliegen?«
Der Anwalt hatte für Jules und sich selbst zwei Gläser mit französischem Cognac gefüllt und dem Schweizer eines davon gereicht. Sie nickte einander zu, schnüffelten befriedigt den verführerischen Duft ein und nippten kurz am Rand.
»Ich habe es nicht eilig«, beantwortete Lederer endlich die Frage.
»Sie denken doch nicht etwa an Rache?«
»Eher an Gerechtigkeit.«
Der Anwalt lachte kurz und trocken auf und lehnte sich dann im schweren Ledersessel zurück, zog die hochgerutschte Weste ein Stück nach unten, beugte sich dann wieder nach vorne.
»Das Schicksal Ihres Kollegen tut mir ehrlich leid, Mister Lederer. Doch Gerechtigkeit lässt sich in dieser Frage wohl kaum herstellen.«
»Sie wissen, wer ihn ermorden ließ?«
Muller nickte zustimmend, sein Gesicht blieb allerdings gleichgültig.
»Ein unbedeutendes Führungsmitglied einer ansonsten recht nützlichen Schlägerbande. Er überschritt seine Kompetenzen und wurde dafür bereits bestraft.«
»Und wie, wenn ich fragen darf?«
»Man hat ihm die linke Brustwarze abgeschnitten, als Zeichen dafür, dass er sein Herz einer falschen Sache gewidmet hat.«
Jules spürte, wie ihm bei der bildlichen Vorstellung der Bestrafung etwas flau im Magen wurde und er nippte rasch vom Glasrand einen weiteren Schluck Cognac, sah Muller daraufhin wieder fest an.
»Ein Leben für einen Nippel?«, fragte er dann den Anwalt erneut angriffslustig geworden. Der zuckte mit den Schultern, »Aug um Auge erschien uns wenig sinnvoll. Denn so ist der Mann uns weiterhin nützlich.«
»Heinz war ein guter Kollege von mir.«
»Aber kein Freund«, konterte Muller, »das spürte ich von Anfang an.«
»Um ehrliche zu sein, ich kenne keine Freunde, Mister Muller, wenn Sie mich so direkt fragen.«
»Das ist sehr schade, Mister Lederer. Erst eine echte Freundschaft bringt die besten Eigenschaften von uns Menschen zum Ausdruck.«
»Oder die schlimmsten«, konterte nun Jules und der Anwalt nickte amüsiert.
»Was würde Ihrer Meinung nach geschehen, wenn ich den Kerl ausfindig mache und ihn für die Ermordung meines Kollegen bestrafe?«
»Man würde Sie ohne Zweifel verhaften, des Mordes anklagen, verurteilen und für viele Jahre einsperren.«
»Und abgesehen von der Polizei und der Justiz?«
Muller verstand sehr gut, worauf der Schweizer zielte.
»Sie sind mir sympathisch, Mister Lederer. Falls Sie den Mörder Ihres Kollegen tatsächlich zur Rechenschaft ziehen wollen, so halten wir uns heraus. Wenn Sie sich jedoch dabei erwischen lassen, so sollten Sie nicht mit meiner Hilfe rechnen. Für Dummheiten ist der Staat zuständig.«
»Danke, Mister Muller, auch Sie werden mir bei jedem unserer Treffen sympathischer. Dann hätte ich nur noch eine Bitte.«
Der Anwalt hatte sich wieder bequem im Sessel zurückgelehnt, beugte sich nun aber wieder erwartungsvoll nach vorne.
»Könnten Sie bitte dem Mörder meines Kollegen ausrichten lassen, dass ich ihn suche und bestrafen will?«
Die Augen von Muller blitzten kurz auf, bevor er lächelnd nickte.
*
Mehrmals hatte Jules in diesen Tagen die Miracles Bar und Nelson Joanne Larue aufgesucht. Meistens saßen die beiden jungen Aufpasser an ihrem Tischchen im hinteren Teil des Lokals, kümmerten sich scheinbar um nichts. Oft waren auch Einheimische zugegen, tranken ihr Bier oder mal einen Rum, ganz selten einen Cocktail, so wie Jules jedes Mal. Mit der Barbesitzerin hatte er sich weiter angefreundet, machte immer wieder den Versuch eines echten Flirts, bekam aber stets die kalte Schulter der aparten Frau von Mitte dreißig gezeigt. Selbstverständlich fanden sich in den Straßen und Gassen der Hauptstadt immer hübsche Dinger, die durchaus Interesse an einem Flirt oder mehr mit einem reichen Touristen zeigten. Doch auch in diesem Punkt hatten Lenz & Karrer vorgesorgt und auf die hohe Aids-Rate bei den Prostituierten des Landes deutlich hingewiesen.
Im Verlauf der letzten vier Jahre konnte Jules auch einiges an Erfahrung mit wesentlich älteren Frauen sammeln. Viele waren auf der Suche, kurz nach einer Scheidung oder Trennung oder einem Todesfall, hatten vielleicht Jahre an der Seite eines in jeder Beziehung alten Sacks vergeudet, spürten große Angst, zu viel in ihrem Leben bereits verpasst zu haben, waren deshalb bereit, sich kopfüber in eine Affäre mit ihm zu stürzen, um sich noch einmal völlig verlieren zu dürfen, um sich noch einmal begehrt zu fühlen. Die Vorteile des Alters waren auch nicht unerheblich für einen jungen Mann wie Jules. Denn jüngere Frauen verbaten sich mittlerweile konsequent jeden Sex ohne Kondom, fürchteten sich meist sogar vor dem Blasen ohne Gummi. Frauen ab vierzig hingegen kannten kaum Angst vor ansteckenden Krankheiten, kümmerten sich nicht weiter um den Aids-Virus, hatten die letzten Jahre der allgemeinen Panik in einer treuen Partnerschaft verbracht, waren in dieser Zeit verblüht und fühlten sich längst abgestorben, empfanden das spontane Kennenlernen eines weitaus jüngeren, attraktiven und sehr höflichen Mannes wie ein Elixier, das sie wieder zum Leben erwecken sollte. In diesen Momenten gab es keinen Raum für Furcht oder Vorsicht. Womöglich war ihr Verhalten sogar auf biologisch tief verankerte Instinkte zurückzuführen? Das Überlebenssystem der Natur blendete Vernunftgründe zum eigenen Schutz und Überleben doch bei allen Tierarten regelmäßig aus, nur um die Vermehrungsrate zu sichern. Warum sollte dies bei Menschen anderes sein?
Jules dachte damals aber nicht an all die möglichen Hintergründe, genoss ganz einfach die daraus resultierenden Vorteile. Und so wurde auch Nelson Joanne im Laufe der beiden Wochen in Haiti immer mehr zu einer Herausforderung für ihn, zu einer Aufgabe, die er noch lösen wollte, bevor er nach Zürich zurückkehren musste. Der besondere Reiz bestand auch darin, dass beiden sehr bewusst war, wo sie standen und wo jeder von ihnen hinwollte. Und so begannen sie miteinander vermehrt zu spielen, rieben ihre Rhetorik aneinander, sprühten mit ihrem Scharm, sie als Gastgeberin, die ihren Kunden auf Distanz hielt, er als der einzig mögliche, zukünftige Liebhaber der Frau.
Mehr als einmal hatte Jules auch den einen oder anderen Aufpasser aus der Bar erkannt und das er beschattet wurde, sie ihm durch die halbe Stadt folgten, immer mit gebührendem Abstand zwar, so dass er sich nicht wirklich belästigt fühlte, sondern stets annahm, er hätte seine Schatten der Aufmerksamkeit von Nelson Joanne zu verdanken. Überhaupt war die Barbesitzerin und ehemalige Mitarbeiterin von Lenz & Karrer in Washington zu seiner einzigen Vertrauten auf der Insel geworden. Laufend berichtete er ihr von seinen Fortschritten. Doch als er ihr vom letzten Gespräch mit Anwalt Muller erzählte und von seiner Bitte, doch dem Mörder von Heinz Keller auszurichten, dass er nach ihm suchte, schüttelte Nelson Joanne wütend und ablehnend ihren schönen Kopf.
»Bist du wahnsinnig geworden? Die knipsen dich doch aus, wann immer sie wollen. Was ist bloß in dich gefahren? Du hast doch längst all das erreicht, wofür man dich hergeschickt hat?«
»Aber ich habe noch nicht alles erreicht, wofür ich hierhergekommen bin«, stellte Jules hart klar, »ich fühle mich verpflichtet, den Tod meines Kollegen zu rächen. Anwalt Muller hat mir versichert, dass sich dieser kleine Anführer einer Straßengang ohne Wissen und Einwilligung seiner Vorgesetzten an Heinz vergriffen hat. Für seinen dummen Ungehorsam wurde er auch bereits bestraft. Doch das genügt mir nicht.«
»Und warum lässt du Muller die ganze Bande auf dich hetzen? Das ist doch reinster Selbstmord?«
»Aber wie komme ich auf andere Weise an den Kerl heran? Muller hat mir versprochen, die Sache so zu drehen, dass sie zu einer persönlichen Angelegenheit zwischen dem Anführer und mir wird, so dass dieser nicht irgendwelche Mörder auf mich hetzen kann, sondern mich persönlich angreifen muss.«
»Doch du kennst den Kerl ja gar nicht. Es könnte jeder Passant sein, der an einer Ampel zufällig hinter dich tritt, der dir unter der Tür zu einer Bar begegnet oder an dessen Tisch du zufällig vorbeigehst. Er hat alle Vorteile auf seiner Seite, kann dich ins offene Messer rennen lassen.«
Ihre beiden Aufpasser hatten ihrem Gespräch diesmal aufmerksam zugehört, blickten auch zur Theke hinüber, wollten die Antwort des Schweizers hören, wirkten angespannt und gleichzeitig begierig.
»Ich werde ihn bestimmt fühlen, Nelson Joanne. Sobald er mir nahekommt, werde ich die Gefahr spüren und entsprechend handeln. Der Kerl kennt mich nicht, weiß nichts von meinen Fähigkeiten.«
»Du beziehst dich auf den Angriff der beiden Motorradfahrer an deinem ersten Abend hier in Port-au-Prince? Das war gar nichts. Das waren bloß Amateure.«
»Hast du mich damals schon beschatten lassen?«, fragte er zurück und sah zu den beiden jungen Männern hinüber, die nun spöttisch zu ihm hinüber lächelten.
»Nicht beschatten, sondern beschützen«, konterte die Barbesitzerin.
»Na, allzu viel Schutz fiel für mich an diesem Abend aber nicht gerade ab.«
Nelson Joanne wirkte nun zornig erregt, beinahe aufgebracht.
»Du bist ein blöder Ignorant, Jules Lederer, genauso wie Heinz Keller damals. Wenn du nicht einmal mit den beiden Idioten mit ihrem Baseballschläger zurechtgekommen wärst, wie hättest du dann jemals deine Aufgabe hier erfüllen können?«
»Dann hast du mir die beiden auf den Hals gehetzt?«
Der Schweizer fühlte eine erste Wut in sich hochsteigen, die sich mit jeder Sekunde verstärkte, die er ungeduldig auf die Antwort von Nelson Joanne wartete. Doch die Frau sah ihn nun zunehmend finster mit ihren dunklen Glutaugen an, war ebenfalls zornig, auf sich selbst oder auf Jules oder auf irgendjemand anderen.
»Du bist ein Idiot, Jules, ein hirnverbrannter Idiot. Verschwinde.«
Sie wies ihm die Tür und Jules erhob sich vom Hocker, warf einen zehn Dollar Schein auf den Tresen.
»Behalte dein Geld, pauvre crétin, vielleicht brauchst du es ja noch, falls du nicht direkt stirbst, sondern irgendwann im Krankenhaus wieder zu dir kommst.«
Jules verließ das Lokal, ohne sich noch einmal umzublicken, sah draußen im Dunkel der Nacht für einige Momente nichts, schalt sich sogleich einen Narren, wich rasch seitlich vom Eingang weg, drückte sich in den Schatten einer Hausecke, beobachtete die Straße mit den Gehsteigen, musterte die wenigen Passanten und die vorbeifahrenden Motorräder und PKWs, spürte eine große Erleichterung, weil er nirgendwo eine Gefahr erkannte oder spürte. Langsam folgte er den Straßen den Hügel hoch zurück zum Bed & Breakfast von Emanuela Grandis, fühlte sich wie ein Tiger in einem ihm fremden Urwald, versuchte die Wildnis zu erspüren, irgendwelche Feinde zu erahnen, hielt die Spannkraft in seinem Körper jederzeit aufrecht, hätte in Sekundenbruchteilen herumwirbeln, fliehen oder angreifen können. Und doch wusste der Schweizer, dass er gegen eine Gewehrkugel, abgefeuert aus hundert oder mehr Metern, keinerlei Chance besaß. War sein Vorgehen irrsinnig? Oder reinster Selbstmord, wie Nelson Joanne es ausgedrückt hatte? Jules wusste es nicht, dachte auch nicht darüber nach, war sich aber in einem Punkt sicher. Nur die Rache am Mörder von Heinz Keller konnte einen gewissen Ausgleich schaffen. Ob diese Art von Gerechtigkeit einen Sinn ergab? Lohnte es sich tatsächlich, dafür das eigene Leben zu riskieren? Objektiv betrachtet bestimmt nicht. Doch war Objektivität nicht sehr oft bloßer Ausdruck von Ängstlichkeit? Oder von mangelhaftem Verantwortungsbewusstsein? Oder zumindest geringem Selbstbewusstsein?
Familienväter zogen in Kriege, wenn ihr Staat es von ihnen verlangte. Sie ordneten sich der Pflicht unter und opferten ihr Leben für eine Sache, mit der sie selbst oder ihre Angehörigen im Grund genommen herzlich wenig zu schaffen hatten. Denn was kümmerte den einzelnen Menschen, von wem er regiert wurde? In welchem Wirtschaftssystem und unter welcher Regierungsform er lebte? Man konnte sich doch mit jeder Situation irgendwie arrangieren. Das hatte die Menschheit in den letzten zwei Millionen Jahren zu Genüge bewiesen. Die Nuancen spielten doch keine bedeutende Rolle. Das Glück des Einzelnen hing weder von seinem Patriotismus noch von einem Nationalismus oder Fanatismus ab, auch nicht von Vorbildern oder Feindbildern.
Doch ebenso, wie jeder Mensch Pflichten gegenüber seinen Angehörigen spürte und dieses Gefühl manchmal auch auf Staaten oder Religionen oder gar Unternehmen übertrug, genauso konnte ein Mensch auch für eine Sache einstehen, die nur ihm persönlich sinnvoll erschien. Und niemand besaß das Recht, diesem einzelnen Menschen seine Sache auszureden oder zu verbieten. Denn für Vernunft gab es keine eindeutigen Richtlinien, keine natürlichen Gesetze. Denn Vernunft war doch bloß eine Erfindung des Menschen, weshalb sie sich stets der jeweiligen Situation anpasste. So zumindest dachte Jules damals.
An diesem Abend gelangte er gesund und ohne jede Belästigung zurück zum Bed & Breakfast. Und auch die nächsten beiden Tage passierte nichts, während er weiter durch die Stadt streifte, sich in Straßencafés setzte oder an Theken stellte, durch Läden schlenderte. Womöglich hatte ihn Muller belogen? Hatte niemanden informiert? Wusste zu genau, dass dieser Gringo aus Europa bald einmal nach Hause fliegen musste, dass sich die leidige Angelegenheit in wenigen Tagen von selbst regelte.
Lange reichte sein Geld tatsächlich nicht mehr aus. Und ein Telegramm aus Zürich hatte ihn erst gestern erreicht. Darin stand die unmissverständliche Anordnung von Lenz & Karrer, so rasch als möglich in die Zentrale zurückzukehren.
Als er an diesem Abend zu Emanuela Grandis und ihrem Bed & Breakfast zurückkehrte, wartete Nelson Joanne vor dem Eingang auf ihn. Sie wirkte angespannt und nervös, war zuvor wohl auf und ab gegangen, wie ein Tiger im zu engen Käfig.
»Jules«, rief sie aus, als sie ihn im Halbdunkel der wenigen Straßenlaternen endlich erkannt hatte, »Gott sei Dank.«
»Was ist denn los?«
»Sie suchen nach dir. Zwei Kerle waren auch in meiner Bar, wollten wissen, wo man dich finden kann. Sie haben Roberto und Chaves verprügelt und mich bedroht. Ich hab aber nichts verraten.«
»Und sie sind dir auch nicht hierher gefolgt?«
Jules hatte die beiden Männer längst entdeckt, die aus einer dunklen Nebengasse getreten waren und sich ihnen zielstrebig näherten. Er blickte Nelson Joanne lächelnd an und nickte zu den Kerlen kurz hin, worauf sie sich ihnen zudrehte.
»Das sind die beiden Männer«, ihre Stimme klang erschrocken, beinahe panisch und sie sah Jules wild an, »renn weg!«
Doch Jules dachte nicht einen Moment lang an Flucht, da er keinerlei Waffen in den Händen der beiden Kerle erkennen konnte. Sie waren sehr dunkelhäutig, nur mittelgroß aber äußerst kräftig gebaut und von gedrungener Gestalt. Sie blickten ihm grimmig entgegen, aber nicht etwa zornig oder hasserfüllt, erledigten wohl bloß einen Job, mit dem sie beauftragt worden waren. Jules entdeckte erst mit Verspätung die Schlagringe an ihren Fäusten. Der eine trug seinen rechts, der andere links. Als sie näherkamen, trennten sie sich, wollten den Schweizer ganz offensichtlich in die Zange nehmen. Jules wich rückwärtsgehend zurück und damit weg von Nelson Joanne und dem Eingang zum Bed & Breakfast. Die beiden Männer passten sich sogleich seiner Bewegung an. Ihre Körper waren angespannt, erwarteten vielleicht die Flucht ihres Opfers, wollten es womöglich sogar in eine bestimmte Richtung treiben? Dort, wo der Mörder von Heinz Keller wartete?
Jules tat ihnen den Gefallen nicht, sondern ging zum Angriff über, rannte direkt auf den einen los, sprang drei Meter vor ihm in die Luft, die Füße voran, traf den Überraschten voll auf die Brust, so dass der sich nach hinten überschlug, während der Schweizer geschmeidig wie eine Katze auf allen Vieren auf dem Boden gelandet war, sich sogleich wieder hochgestemmt hatte und nun den zweiten erwartete. Dieser schlug mit seiner unbewaffneten Rechten eine Finte, um sein Opfer anschließend mit dem Schlagring an der linken Hand zu erwischen. Doch Jules hatte nicht nur die vorstoßende Rechte mit seinem linken Unterarm geblockt, sondern auch den Schwinger der Linken mit seiner rechten Hand abgefangen, stieß gleichzeitig mit seinem Kopf vor, knallte seine Stirn in das breite Gesicht des Haitianers, zertrümmerte krachend dessen Nase und spaltete dessen Oberlippe. Der Mann taumelte ein paar unbeholfene Schritte zurück, war nicht ausgeknockt, jedoch angeschlagen und der Schweizer ließ ihm keine Chance mehr, setzte sogleich nach, knallte dem kurzzeitig Wehrlosen die Faust auf den Gurgelknoten. Der Dunkelhäutige ächzte und begann zu röcheln, sah den Schweizer aus hervorquellenden Augen an und setzte sich auf seinen Hosenboden, legte sich dann sogar hin, weil ihm jeder Atem fehlte, wurde bewusstlos.
Fast gemächlich wandte sich Jules wieder dem ersten Angreifer zu, der sich aufgerappelt hatte und mit staunendem Blick seinen wie tot am Boden liegenden Kollegen betrachtete.
»As-tu assez? Tu veux aller dormir comme ton confrère?
Der Mann hob seine Hände wie zur Abwehr und wich von ihm weg, wirbelte dann herum und rannte fort. Jules ging die paar Schritte zurück zu Nelson Joanne.
»Du bist nicht sicher hier. Komm mit hinein. Madame Grandis wird dir ein Taxi rufen.«
Er führte die Barbesitzerin ins Haus und drückte die Eingangstüre hinter sich ins Schloss. Da drängte sich Nelson Joanne plötzlich an ihn, presste ihren Körper an seinen und ihre Lippen fanden einander. Wahrscheinlich wurde die Frau von ihren Gefühlen nach der überstandenen Gefahr überwältigt. Ob das in ihre Blutbahn eingeschossene Adrenalin dafür verantwortlich war oder ob die Barbesitzerin eine perverse Neigung für Gewalt besaß, mochte Jules nicht entscheiden, während sich ihre Zungen fanden, liebkosten und umspielten und er vom starken Moschusduft ihres Parfüms umhüllt wurde. Doch er sollte es noch in dieser Nacht herausfinden.
*
Sie stellte sich als die von ihm erwartete, sehr erfahrene Liebhaberin heraus, forderte alles von ihm, gab ihm genauso viel zurück. Jules und Nelson Joanne harmonierten vom ersten Moment an, steigerten ihre Erregung im Gleichklang. Trotzdem kam Jules zuerst, japsend und nach Luft schnappend, nach seinem minutenlangen Stakkato seines Beckens, zu dem sie ihn angestachelt und immer wieder angefeuert hatte. Wahrscheinlich bemerkte sie es im ersten Moment noch gar nicht, hörte jedenfalls mit der Gegenbewegung ihres Beckens nicht auf, forderte mehr und mehr von ihm. Und Jules gab ihr alles, was er nur konnte, bis auch sie aufstöhnend kam, mühsam ihre Schreie unterdrückend und heftig aufbäumend ihre Finger ins Laken krallend. Jules presste sich weiterhin auf ihren Körper, bewegte sein Becken im selben Rhythmus weiter, bis sie unter ihm zuerst zu zittern und dann zu schlottern begann, als sich ihre lustvolle Anspannung langsam löste. Gesprochen hatten sie die ganze Zeit über kein Wort, weder ein Liebesgeflüster noch Anfeuerungsrufe. Zu intensiv empfanden wohl beide diese Begegnung, schicksalsträchtig verbunden in den Momenten der vollkommenen Lust, der Selbstaufgabe, des reinen Spürens und Schmeckens des anderen.
Auch Licht hatte sie keines angemacht und so lagen sie nebeneinander in der Dunkelheit, hielten sich an den Händen, entspannten sich, kamen zur Ruhe, schwiegen weiterhin, aber nicht vor Scham oder Selbstvorwürfen, sondern aus purem Genuss. So jedenfalls empfand der Schweizer, auch wenn er sich selbst eingestand, dass ihn an Nelson Joanne vor allem ihre Eroberung gereizt hatte und er mit keinem Gedanken an eine längere Beziehung dachte. Und so hoffte Jules, dass es der Frau ähnlich erging, dass sie in ihm auch bloß den interessanten Zeitvertreib sah, eine weitere Trophäe in einer mit Sicherheit sehr langen Reihe ähnlicher Begegnungen. Sie legte sich plötzlich und mit einer gleitenden Bewegung auf ihn drauf, war mit ihrem Gesicht dem seinen auf einmal ganz nahe.
»War das etwa schon alles?«, gurrte sie leise und schloss den Satz mit einem spöttischen, auffordernden Lachen ab. Er umfasste mit seinen Armen ihren Oberkörper, presste ihn an sich, fand ihren Mund und küsste ihn.
»Aber diesmal liege ich unten und du kannst die Hauptarbeit leisten«, forderte er sich leise lachend auf. Und Nelson Joanne ging sogleich darauf ein, wand sich aus seinen Armen und setzte sich rittlings auf seine Oberschenkel, begann seinen Penis zu streicheln und massieren, hockte sich dann auf ihn drauf, sobald er hart genug war, begann auf und ab zu hüpfen, in einer lüsternen, alles verzehrenden Weise, so als wäre sie am Verhungern, als müsste sie eine viele Jahre lang dauernde Sehnsucht in dieser einen Nacht befriedigen. Jules ließ es sich gerne gefallen, ging mit ihrem Rhythmus mit, packte irgendwann zu und hielt sie fest, stieß von unten mit seinem Becken auf und ab, drang so tief als ihm möglich in sie hinein, fühlte ihr Zittern und Beben und strengte sich doppelt an, spürte, wie er bereits wieder kurz vor dem Abspritzen stand, wollte es aber weiter hinauszögern, verringerte rasch seine Kadenz, konnte den Samenerguss trotzdem nicht mehr verhindern, spritze in sie hinein, zweimal voller Lust, das dritte, vierte und fünfte Mal bereits unter zunehmend ziehenden Schmerzen in seinem Hodensack, der völlig leergepumpt schien. Erst als er sich entspannte, spürte er, dass auch Nelson Joanne im selben Moment wie er gekommen sein musste, spürte ihre immer noch bebende Bauchdecke auf der seinen, fühlte ihre schweißnasse Haut auf seinem Körper.
»Das war richtig gut, diesmal. Du machst dich langsam, Jules«, erteilte sie ihm ein ziemlich verunglücktes Lob, so als wäre er bloß einer von vielen Schülern und sie die Lehrerin. Vor allem ihr Tonfall ärgerte ihn und womöglich nur deshalb packte er ihre Oberarme hart und drückte ihren Oberkörper von sich herunter, warf sich auf sie drauf, presste sie auf die Matratze, suchte mit seinem Mund den ihren, verschloss ihn mit heißen Küssen, zwang sie regelrecht zur erneuten Hingabe, fühlte plötzlich ihre Hand an seinem Hodensack und wie sie unbarmherzig hinlangte und seine Eier presste, auf dass er kurz aufschrie und sich von ihr strampelnd herunter wälzte.
»Spinnst du?«, warf er ihr fluchend vor.
»You‘re welcome«, verhöhnte sie ihn auf Englisch, »hier gebe ich den Ton an, nicht du, mein Lieber.«
Er rückte von ihr ein Stück weit ab, war sauer, wütend, fühlte sich irgendwie benutzt und danach weggeworfen, nicht für voll genommen. Er starrte in die Dunkelheit und in das Gesicht der Frau, die vor ihm liegen musste und dessen Züge er nicht richtig erkennen konnte.
Lachte sie ihn etwa schweigend aus? Genoss sie ihren Triumph und seine Niederlage? Verdammtes Teufelsweib.
Zu jemandem hingezogen zu sein und gleichzeitig abgestoßen zu werden, diese Erfahrung war für den jungen Schweizer neu und er dachte einen Moment lang darüber nach, ob ihm diese Art von Spiel eventuell sogar gefallen könnte. Nelson Joanne war eine höchst dominante Frau, wollte die Kontrolle über ihre körperlichen Beziehungen behalten, sich keinem Mann unterwerfen, ja ihn noch nicht einmal als gleichberechtigt neben sich gelten lassen. Doch gleichzeitig war diese Frau irrsinnig aufregend. Ihre überaus weiche Haut und ihr betörender Duft reizten ihn bereits wieder und seine Gedanken an ihre immer noch so enge und feuchte Lustgrotte ließ seinen Penis erneut aufrichten.
Behalte die Kontrolle, verdammt, schnauzte er sich selbst unhörbar an, fühlte gleichzeitig, dass seine Unterwerfung einen ebenso starken Reiz auf ihn ausübte, wie die Möglichkeit, die Frau und ihren Körper völlig zu beherrschen. War das möglich? Sado und Maso in einem? Mit derselben Person?
»Leck mich, Sklave«, hörte er ihre feste, kalte Stimme, die ihm trotzdem unter die Haut ging. Und ohne nachzudenken gehorchte er ihr, robbte ein Stück die Matratze hinunter, legte sich zwischen ihre Beine, suchte mit seiner Zunge ihre Schamlippen, spürte die Finger ihrer Hände, mit denen sie ihre Lustgrotte eng umschlossen hielt und mit denen sie den Zugang kontrollierte und ihm bloß ihre Klitoris anbot, die sich aufgrund ihres Fingerdrucks weit hinaus stülpte, fordernd und lockend zugleich. Jules ging auf dieses Spiel ein, bewegte seine Zungenspitze so schnell er nur konnte auf und ab, raspelte über ihre Knospe, massierte sich gleichzeitig mit seinen Händen den Penis, der sich im selben Masse wieder versteifte, wie Nelson Joanne zuerst leise zu keuchen und dann lauter zu stöhnen begann. Als sie kaum zwei Minuten später erneut kam, fühlte auch Jules die Lust erneut in sich explodieren, auch wenn diesmal kaum noch Samenflüssigkeit austrat.
Die Frau bewegte nun unwillig ihr Becken und der Schweizer nahm dies zum Anlass, ihre Schenkel zu verlassen und sich wieder neben sie hinzulegen.
»Leck mir die Zehen, Sklave«, hörte er erneut ihre Stimme aus der Dunkelheit, noch kälter, beinahe gnadenlos. Was war das für ein Spiel, in das ihn die Barbesitzerin treiben wollte? Jules verspürte keine Lust mehr, noch länger darauf einzugehen.
»Joanne?«, fragte er sie leise.
»Schweig, Sklave«, herrschte sie ihn an, »leck mir die Zehen und halt dein verdammtes Maul.«
Jules setzte sich ernüchtert auf, rückte noch weiter von der Frau ab: »Du spinnst doch.«
»Was erlaubst du dir, Sklave? Leg dich wieder hin. Na los. Gehorche.«
Die Barbesitzerin schien sich in irgendeiner einstudierten Rolle verloren zu haben. Jules musste unwillkürlich lachen, amüsiert und wohl auch ein wenig herablassend. Jedenfalls stemmte sich auch Nelson Joanne sogleich auf und warf sich auf ihn, umarmte seinen Oberkörper und fetzte mit ihren gefeilten, langen Fingernägeln über die Haut seines Rückens, riss sie unbarmherzig auf, so dass der Schweizer erschrocken und voller Schmerzen aufschrie, sich aus ihrer Umarmung losriss und eine Ohrfeige der Dunkelheit irgendwo vor sich austeilte, die Frau klatschend auf Ohr und Wange traf, so dass sie ebenso erschrocken und vor Schmerz aufschrie, sich jedoch gleich wieder auf ihn stürzte und ihn mit Krallenhänden die Haut auf Brust und Bauch aufriss.
Jules ließ sich in seiner Not aus dem Bett und auf den Boden fallen, robbte weiter weg, erhob sich dann und schaltete das Deckenlicht ein. Wie eine Furie hockte Nelson Joanne auf der Matratze, sah ihn wild aus zornig funkelnden Augen an.
»Bist du durchgedreht?«, versuchte er sie zu beruhigen. Doch statt einer Antwort veränderte sich ihr Gesichtsausdruck, wurde von einem Moment zum anderen wieder weich und verführerisch, wandelte sich dann sogar zu schmollend.
»War ich denn ein zu böses Mädchen?«, begann sie ihn zu locken, »dann musst du mich wohl oder übel bestrafen. Du könntest meine Arme und Beine an die Bettpfosten fesseln. Na? Wie wäre das? Ich wäre dir ausgeliefert und du könntest mit mir anstellen, was immer du willst? Hast du eine Kerze irgendwo hier herumstehen? Hast du Erfahrung mit heißem Wachs? Oder vielleicht sogar mit Atem-Kontrolle?«
Er schwieg betroffen, blickte starr auf die lockende Frau, die nun ihre Brüste lasziv massierte und sich auch immer wieder in den Schritt griff, ihn mit ihren Katzenaugen zu hypnotisieren versuchte.
»Komm, mein Hengst, fessle mich, vergewaltige mich, stoß mir deine Faust in die Muschi, bis ich schreie.«
Jules schluckte, war von der unersättlichen Frau plötzlich angewidert und gleichzeitig irgendwie enttäuscht.
»Ich denke, es ist das Beste, wenn du jetzt gehst«, verlangte er kühl von ihr. Und wiederum veränderte sich ihre Mimik von einer Sekunde zur nächsten, wurde gleichgültig, zeigte auch nur leichte Enttäuschung.
»Ihr Europäer bringt es einfach nicht«, verhöhnte sie ihn und Jules fragte sich unwillkürlich, ob sie damit bloß ihn oder auch Heinz Keller oder sogar Roger Spälti meinte.
»Verschwinde«, empfahl er ihr, »bevor ich mich vergesse. Eine derart verdrehte Nudel ist mir noch nie untergekommen.«
Sie erhob sich stolz wie die Schaumgeborene, präsentierte ihm ihren Körper nackt und ohne jede Scham, wiegte sich in ihren Hüften und sah ihn dann verächtlich und doch erneut lockend an.
»Ich bin wohl die erste, echte Frau in deinem Leben?«, stellte sie sarkastisch fest, »bist wohl bloß lahme Tussies gewöhnt? Bist noch ein Baby, das seine Mami braucht?«
Wollte sie ihn in Rage reden und ihn so zu einem neuen Ringkampf zwingen? Jules blieb ruhig, sah sie kalt an und forderte: »Geh endlich.«
Ihr Gesicht wandelte sich nun vollkommen zur schnippischen Gleichgültigkeit: »Na gut. Du weißt doch gar nicht, auf was du verzichtest, du Dummkopf.«
Sie sammelte ihre Kleidung vom Boden zusammen, schlüpfte hinein, zog sich die Schuhe über.
»Wie steht’s nun mit dem versprochenen Taxi?«, forderte sie unverblümt. Anstelle einer Antwort öffnete Jules die Zimmertüre, sah sie schweigend an. Da griff sie ihre Handtasche und rauschte an ihm vorbei in den nur mit dem Notausgangsschild beleuchteten, dunklen Flur, entschwand seinem Blick über die Treppe nach unten. Nachdenklich schloss Jules die Zimmertüre, sah sich um, sah auf das zerwühlte Bett und schüttelte den Kopf, war mit sich und der Welt höchst unzufrieden.
*
Die Miracles Bar besuchte er vor seiner Abreise nicht mehr. Auch hatte er entschieden, gegenüber Roger Spälti mit keinem Wort Nelson Joanne zu erwähnen. Jules wollte nicht riskieren, in den Augen seines Mentors Dinge zu lesen, von denen er nichts wissen wollte.
Am Morgen nach der Nacht mit der Barbesitzerin war er erneut durch die Stadt gestreift, wollte dem Mörder von Heinz Keller weitere Gelegenheiten bieten ihn anzugreifen. Nach dem Ausschalten der beiden Schläger musste doch der Bandenführer irgendwann persönlich auf ihn losgehen? Doch an diesem Tag geschah nichts und auch am nächsten blieb Jules unbehelligt. Weitere Telegramme trafen aus Zürich ein, forderten ultimativ seine Rückkehr oder zumindest eine Antwort. Allerdings schrieb ihm nicht Roger Spälti, sondern sein direkter Vorgesetzter. Jules reagierte weder auf die Befehle noch auf die verdeckten Drohungen.
Es passierte in der nächsten Nacht, nachdem er gegen Abend in die Stadt hinunter gegangen war und in einem der kleinen Restaurants an der Route de Delmas gegessen hatte. Satt und ein wenig angetrunken schlenderte er durch dunkle Straßen und enge Gassen, ohne ein Ziel zu kennen. Er dachte über sein bisheriges Leben nach, über seine Arbeit bei Lenz & Karrer und er wusste, zurückkehren in das Großraumbüro in Zürich konnte er nicht mehr, nicht, nachdem er hier in Haiti tätig gewesen war, in einer anderen Kultur und unter fremden Menschen und auf sich allein gestellt und erst noch höchst erfolgreich handelnd. Auch an Nelson Joanne dachte er irgendwann, vermutete einen direkten Zusammenhang zwischen ihrem Weggang in Washington und ihrer sadistisch-masochistischen Veranlagung. Sie tat ihm leid, fand es auch sehr schade, dass eine so hübsche Frau sich derart ihren perversen Machtfantasien hingab und sich wohl nur noch in ihnen völlig vergessen und verausgaben konnte. Wenn auch noch jung an Jahren war Jules doch bewusst, dass eine Frau wie Nelson Joanne niemals glücklich werden konnte. Gelenkt von abartigen Trieben blieb ihre Hingabe an einen Partner beschränkt auf rein körperliche Extreme. Ein gleichberechtigtes Liebesleben war dieser Frau nicht möglich. Macht jedoch, ob aktiv ausgeübt oder passiv ertragen, nutzte sich rasch ab, verlangte stets nach Steigerung, weshalb jede zwischenmenschliche Beziehung über kurz oder lang scheitern musste.
Es überfiel ihn diesmal von einem Moment zu nächsten, ohne jeden Ansatz. Er tauchte ein, als hätte er einen Hechtsprung vollführt. Eben noch hatte er das Bild der hübschen Nelson Joanne Larue vor seinem geistigen Auge erblickt, im nächsten Moment spürte er, wie sein Gehirn wie zu schweben begann, befand er sich in der gleichen Sekunde zurück in Sapientia, schloss genüsslich geblendet seine Augenlider, blieb mitten auf dem Gehsteig einfach stehen, verharrte beinahe andächtig, wollte diesen einen Moment festhalten, so lange wie ihm nur möglich war. Erst als die Geborgenheit auch nach vielen Sekunden nicht von ihm wich, getraute er sich, noch weiter in ihr vorzustoßen, direkt in diesen weißen Nebel hinein, der ihn umwallte und durch den das strahlende Licht drang und ihn so leitete. Er ging vorwärts, immer nur vorwärts, durchstieß die nicht spürbare Watte, fühlte sich dabei prächtig, gelöst und frei. Jules sah nicht, wie er die Straße überquerte, stolperte weder vom Gehsteig auf die Fahrbahn noch auf der anderen Seite hinauf, schritt wie auf Wolken, trat sicher auf, hörte nicht das Hupen des Wagenlenkers, der wegen ihm auf die Bremse hatte treten müssen, war völlig aufgegangen in seinem Sapientia. Auch das schwarze Augenpaar war ihm entgangen, das ihn seit Minuten beobachtete, das ihm langsam gefolgt war, zuerst den Gehsteigen entlang und ihm immer näherkommend, dann über die Fahrbahn auf die andere Straßenseite hinüber und nur noch wenige Meter von ihm entfernt. Die Gegend wurde zunehmend dunkler, denn die Straßenlaternen wurden spärlicher und aus den Fenstern der Wohnhäuser drang kaum Licht. Immer näher schob sich der Verfolger an Jules heran, hielt nun ein Messer mit langer Klinge in der einen Hand, wurde noch schneller, war endlich hinter dem Rücken des Schweizers angelangt, stieß auch schon mit seinem Arm und der Klinge vor, war sich seines Stiches sicher.
Jules blickte derweil auf seinen Körper hinunter, so als hätte sich sein Geist von ihm getrennt, erblickte gleichzeitig seine Schulterblätter und das Rückgrat, die Brust und seinen Bauch, Gesicht, Ohren und Hinterkopf, fühlte nun auch die plötzliche Anwesenheit irgendeiner Gefahr, konnte auch alle Nebelwolken um sich herum durchdringen, sah einen Kerl mit einem Messer in der Hand in seinem Rücken auftauchen und wie er sich ihm wie in Zeitlupe näherte, wie er den Arm langsam zurückzog und dann nach vorne stieß, sah die blitzende Stahlklinge, drehte sich von ihr weg, stellte sich dem Angreifer entgegen, schlug dessen Unterarm mit der einen Hand weg und landete einen Sudo Yeop Taerigi auf dessen rechter Schulter. Das Messer entglitt der sogleich schlaff gewordenen Hand und fiel zu Boden, während sich im Gesicht des Kerls großes Erstaunen und dann heftiger Schmerz zeigten. Die Augäpfel des Angreifers schienen dessen Kopf verlassen zu wollen, derart weit traten sie vor, und Jules führte einen Pyongkwansu Tulki gegen dessen linke Höhle aus, spürte, wie sein Mittelfinger erst den Augapfel seines Gegners traf und an ihm vorbei quetschend tief in dessen Schädel eindrang, zog ihn auch schon wieder zurück wie ein Florett, trat auch einen Schritt zurück und führte einen Apchagi aus, krachte mit seinem Schienbein zwischen die Oberschenkel des anderen, zerquetschen ihm Penis und Hoden, packte dann mit beiden Händen in die Haare des sich zusammen krümmenden Mannes und zog dessen Kopf heftig nach unten, kam ihm mit dem linken Knie entgegen, ließ es in dessen Gesicht krachen und ihn rücklings zu Boden stürzen, sprang hoch in die Luft auf und landete mit seiner rechten Ferse exakt auf dessen Gurgelknoten, zertrümmerte ihn und auch die dahinterliegenden Halswirbel.
Für Jules hatte sich dies alles wie in Zeitlupe abgespielt und er konnte jedes Zucken im Gesicht seines Gegners klar erkennen, hörte jedoch weder seine Schreie noch sein Röcheln, so als würde sich der Körper des Manns gar nicht in seiner Welt befinden, als wären sie durch mindestens eine Dimension voneinander getrennt.
Dann endlich tauchte Jules aus Sapientia wieder auf und der weiße Nebel verlor sich um ihn herum. Erst jetzt nahm der Schweizer bewusst das heruntergekommene Quartier wahr und den toten Mann zu seinen Füssen, sah das unbenutzte Messer neben dessen Körper auf dem Gehsteig liegen. Jules kannte den Angreifer nicht. Doch er beugte sich zu ihm hinunter, riss dessen Hemd vorne auf, sah den Verband über dessen linker Brustwarze, riss diesen weg, sah die große, verkrustete und vernähte Wunde, nickte stumm, aber bestätigend. Er richtete sich wieder auf und sah sich um, konnte weder Beobachter noch weitere Gegner ausmachen, entfernte sich rasch vom Toten, brachte ein paar Gassen und Straßen zwischen sich und dem Tatort. Morgen würde er in die Schweiz zurückfliegen.