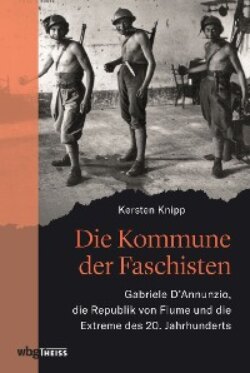Читать книгу Die Kommune der Faschisten - Kersten Knipp - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der mächtigste Instinkt
ОглавлениеQuellcode dieser Darbietungen war D’Annunzios Sprache. Konsequent achtete der Dichter darauf, seinen Wortschatz zu entwickeln, seine Ausdrucksfähigkeit zu steigern. Stets war er den Wörtern auf der Spur. „Meine Sprache ist mein mächtigster Instinkt“, notiert er in seiner Autobiographie.22 Immer wieder seien ihm Wörter ganz plötzlich in den Sinn gekommen, schreibt der Dichter, überraschend, plötzlich und schnell, wie aus den Untiefen der See. „Deutlich erkenne ich mich in ihnen wieder, deutlich auch sehe ich in ihnen das, was ich an mir bislang nicht kannte, was ich mir von mir selbst nicht vorzustellen vermochte.“23
Dieser enthüllenden Kraft der Sprache hat sich D’Annunzio immer wieder anvertraut. Genauer gesagt, er hat um sie gerungen, in nie nachlassender Anstrengung. „Der Ausdruck ist meine einzige Art zu leben“, schrieb er am Ende seines Lebens in seinem letzten großen Text, dem Libro Segreto. Und fügte hinzu: „Esprimere è vivere“: „Sich auszudrücken heißt zu leben.“24 Der kurze Satz ist so etwas wie die Summe eines Lebens, ein Glaubensbekenntnis, dem der Dichter, so launenhaft und unstet er sonst gewesen ist, durchgehend die Treue gehalten hat. Er spricht, ebenfalls im Libro Segreto, von einem „wahnsinnigen Bedürfnis, mir meine Sprache und meinen Sprachklang zu erfinden“.25
Wer seine Identität bewusst an die Sprache klammert, sich mit ihrer Hilfe immer neue Aspekte des eigenen Daseins erschließt, der wird mit einer Vorstellung wenig anfangen können: dass der Mensch aus einem Guss sei, dass er so, wie die ersten Jahren ihn formten, für immer bleiben und durch das gesamte Leben gehen könne. Intellektuelle Selbstgenügsamkeit ließen die aufgewühlten Zeiten nicht zu, erst recht nicht für jemanden, der sich bewusst und voller Absicht mitten in ihren Strom begab. Zu einem „von edler Eleganz verzierten Leben“ gehöre vor allem eines, erklärte der Dichter: „das Gefühl dauernder Veränderung, der kontinuierlichen Entwicklung, des stetigen Vergehens“.26 Ruhe, träges Verharren, Zufriedenheit mit sich selbst und dem Lauf der Welt waren D’Annunzios Sache nicht. Dergleichen empfand er nicht nur als langweilig, sondern als einfältig, weder den aufgewühlten Zeiten angemessen noch dem Anspruch an sich selbst. Wie kann man meinen, einen Standpunkt gefunden zu haben, wo doch alles in Bewegung ist?. „Tante io ho anime, e tante stirpe“: „So viele Seelen habe ich, und so viele Wurzeln“.27
So ging er an gegen die Macht der biographischen Konstellation, suchte Abschied und Aufbruch, immer im Sprung zu neuen Erfahrungen. Der „flexible Mensch“, der über hundert Jahr später seinen Einzug in die Geschichte halten sollte, fand in ihm einen seiner wendigsten Vorläufer.28 Ehrfurcht vor der Tradition, das ja. Auf keinen Fall aber Unterwerfung, devote Ergebenheit unter ihre Vorgaben. Aus der Überlieferung zu lernen führt letztlich zu nichts anderem als der Fähigkeit, sie weiterzuentwickeln, um neue, aufregende Formen und Erfahrungen zu bereichern. Tradition ist eine Einladung zum Spiel mit dem Kommenden, in der Kunst ebenso wie im eigenen Leben. „Ich habe mit dem Schicksal gespielt, ich habe mit den Ereignissen gespielt, mit dem Schicksal, mit den Sphinxen und mit den Chimären“, schreibt er in seinem Libro Segreto.29
Mit den Chimären und Moden seiner eigenen Zeit war er durchgängig vertraut. Symbolismus und literarische Dekadenz, Sport, Patriotismus und Nationalismus, Technikbegeisterung und Futurismus, Kriegsbegeisterung, dann Hedonismus und erste Ansätze zur „Gegenkultur“, die ein halbes Jahrhundert später, 1968, ihren Siegeszug antreten sollte, sogar Ansätze zu dem, was heute „Kosmopolitismus“ heißt: Alle diese Regungen griff er auf, sei es als Stoff seiner Bücher, sei es als Staffage für sein eigenes Leben. Auf Systematik und intellektuelle Durchdringung der je aktuellen Ideen kam es ihm nur bedingt an. In seinen Händen schien jeder Stoff leichtfüßig und elegant, kam spielerisch und beiläufig daher, stieß das Hirn, aber auch und vor allem das Herz an. Darin, in seiner unbefangenen, launenhaften, man könnte auch sagen: opportunistischen Wandlungsfähigkeit wurde D’Annunzio zu einem vergleichsweise frühen Vorläufer jener brüchig-wandelbaren Daseinsform, die sich zumindest im Westen seit dem späten 18. Jahrhundert als Norm der Lebensführung durchgesetzt hat. „Je est un autre“, „Ich ist ein anderer“: Arthur Rimbauds selbst die Grenzen der Syntax sprengende Formel von der Vielfalt und Ambivalenz moderner Lebensformen hat in D’Annunzio einen ihrer bekanntesten und gewiss auch kunstvollsten Protagonisten gefunden. Von seiner „multanimità“, von der Vielfalt seiner Seele, spricht der Protagonist des 1892 erschienenen Romans L’innocente („Der Unschuldige“).
An der Oper seines Lebens arbeitete D’Annunzio ohne Unterlass. Und stets achtete er darauf, dies vor hinreichend großem Publikum zu tun. In der Konzentration auf die Wirkung seiner Auftritte, in seiner entschlossenen Selbstvermarktung, war D’Annunzio durch und durch modern. Das Bewusstsein, eine öffentliche Figur zu sein, an der es immer und überall zu feilen gelte; sein Schielen auf Wirkung und Erfolg noch in den scheinbar ganz der Kunst hingegebenen Momenten; seine Weigerung, zwischen Poesie und Wirklichkeit rigoros zu unterscheiden: All dies machte ihn zu einem ebenso faszinierenden wie frivolen Charakter.
Sonderliche Achtung vor den Fakten hatte er nicht. Wo die sich der Phantasie in den Weg stellten, schob er sie beiseite oder manipulierte sie. Das galt vor allem mit Blick auf das eigene Fortkommen: D’Annunzio setzte sich nicht nur so konsequent in Szene wie wenig andere Dichter seiner Zeit. Wenn es ihm erforderlich schien, scheute er auch vor Lüge, Manipulation und Täuschung nicht zurück. Er sei 1864 auf einem die Wasser der Adria kreuzenden Schiff, einer Brigg namens „Irene“, zur Welt gekommen, schrieb er 1892 seinem französischen Übersetzer Georges Hérelle. „Diese maritime Geburt hat Einfluss auf meinen Geist genommen. Das Meer ist in der Tat meine tiefste Leidenschaft: Es zieht mich wirklich an wie ein Vaterland.“30 Die Leidenschaft zum Meer mochte der Wahrheit entsprechen – alles andere war schlicht erfunden.
Tatsächlich kam D’Annunzio in der Hafenstadt Pescara, gelegen an dem gleichnamigen, in das adriatische Meer mündenden Fluss zur Welt. Zwar verströmte auch das damals verschlafene Städtchen einen bukolischen Reiz. Aber in den Augen des Dichters zählte das wenig im Vergleich zur maritimen Dramatik der offenen See, dem Mythos der Méditerranée, mit dem sich auch in Paris verlässlich punkten ließ. Den südlichen Zauber ergänzte D’Annunzio um eine ausführliche Schilderung seiner intellektuellen Biographie. Auch damit, war er sich sicher, würde er seine französischen Leser beeindrucken. Alsbald, im April 1893, erschien das Selbstporträt in der Revue hebdomadaire und löste unter deren Lesern eine Debatte über den Stand der italienischen Kultur aus. In deren Mittelpunkt stand, wie von ihm selbst kalkuliert, Gabriele D’Annunzio. Im literarischen Horizont der Franzosen wurde er zu einer festen Größe.
1897 widmete André Gide seinem italienischen Kollegen Zeilen freundlicher Anerkennung. Nur wenige Jahre zuvor, als die Romane D’Annunzios noch nicht übersetzt waren, habe die italienische Literatur in Frankreich als tot gegolten, schreibt Gide. Doch dies habe sich dank D’Annunzio geändert, er habe ganz Europa auf die Literatur seines Heimatlandes aufmerksam gemacht. „Man hat D’Annunzio seine nicht-italienische Bildung vorgeworfen. Zu Unrecht. Mir scheint, er hat seine Wurzeln in den Literaturen ganz Europas geschlagen. Dieser Umstand wirft Licht auf die triste Tatsache, dass Italien kein hinreichend fruchtbares Terrain bietet, von dem man sich literarisch nähren könnte. D’Annunzios möge allen jungen Schriftstellern als Beispiel dienen, dass Italien sehr wohl produktiv ist und Europa zu zwingen vermag, ihm zuzuhören.“31 Ein solches Kompliment aus der Feder eines der bedeutendsten französischen Schriftsteller seiner Zeit war exakt das, was D’Annunzio brauchte. Nun konnte er sagen, er sei im Herzen des französischen Publikums angekommen.
Um Aufmerksamkeit buhlte er auch mit teils überraschend simplen literarischen Spielereien. Durch die Schilderung erotischer Anstößigkeiten suchte er gezielt den Skandal. Tabus waren in seinen Augen vor allem dazu gut, gebrochen zu werden – und ihn selbst darüber ins Gespräch zu bringen. D’Annunzio war ein Erotomane, sein Verhältnis zu den Frauen war zeitlebens ein brodelndes. Eine bis heute große Bekanntheit erfuhr ein kurzer Text über einige erotische Frivolitäten 1877 im Archäologischen Nationalmuseum von Florenz, genau vor der Statue der Chimäre von Arezzo, einem in Bronze gefassten Ungeheuer mit dem Kopf eines Löwen, dem Schwanz einer Schlange und einem Ziegenkopf auf dem Rücken. Vor diesem etruskischen Kunstwerk – niemand schaut hin in diesem Augenblick – beginnen eine Freundin, Clemenza, genannt Malinconia, und Gabriele ihr laszives Spiel. Vor dem zähnefletschenden Monster drückt er ihr die Hand in den Mund – „mit solcher Wucht, dass mir die Fingernägel und Knöchel schmerzten“.32 Ob ihm der Mund brenne, will die drei Jahre Ältere wissen. Ja, er brennt. „Und so packte ich sie ohne Hemmung, mit einer Gewalt, die sich von der bissigen Bronze auf mich zu übertragen schien, als würde sich die Massivität des Metalls in meinen Muskeln entfalten.“ Ja, er würde noch viele Male den Mund einer Frau beißen, fährt es ihm durch den Kopf. „Und mir wurde in trunkenem Schauder, in schlüpfriger Verderbnis klar, dass es noch einen anderen Mund zu bearbeiten gab, geheim und nicht für einen allzu jungen Mann.“ Sex sells, auch und gerade in der belle époque, deren Sehnsüchte D’Annunzio zielsicher aufgriff, mit Metaphern im Geist der Zeit – die Frau als Chimäre – verzierte und andeutungsreich – der „andere Mund“ – ins Ungesagte, aber doch Eindeutige gleiten ließ.
In der Bereitschaft, auch das zutiefst Private dem eigenen Fortkommen zu opfern, kannte D’Annunzio keinerlei Hemmungen. Im April 1881 lernte er Giselda Zucconi kennen, die Tochter seines damaligen Sprachlehrers in Florenz. Die beiden verlieben sich, und Elda, wie D’Annunzio die ein Jahr Jüngere nennt, wird zur ersten längeren Liebe des Dichters. Um eine unschuldige Liebe allerdings handelt es sich nicht. Kaum haben die beiden sich kennengelernt, zieht D’Annunzio zum Studium nach Rom. Die räumliche Trennung überbrückt das Paar durch Briefe – knapp 500 werden es insgesamt sein. Im April 1882 umreißt er ihr seine Vorstellungen von der gemeinsamen Zukunft: „ein Haus für uns, schön, elegant, voller Luft und Licht, voller Blumen“. Klar ist auch, wie er sich das Interieur vorstellt: „Ich werde ein lichthelles Zimmer für meine Studien haben, voller Bilder, Skizzen, hübscher Gegenstände, seltener Stoffe, voller Waffen, Bücher, Karten.“33 Dort werde er seine Verse, seine Prosa schaffen. Und ja, auch sie, Elda, habe eine Rolle in diesem Haus: „Ich werde einen Hexameter bei der Hälfte stehen lassen und dir einen Kuss geben, ich werde mir ein dichteres Bild entgehen lassen, um zu den leisen, ausgelassenen Schreien unseres Kindes zu eilen und es mit Zärtlichkeiten zu überhäufen.“
Der Dichter in seinem Arbeitszimmer, die Frau als gute Seele des Hauses: Noch in den intimsten Momenten wird D’Annunzio seinen Narzissmus nicht los, vermag er die Egozentrik seiner Phantasien nicht zu überwinden. Da, wo es auf ein größeres Publikum nicht ankommt, versagen ihm Sensibilität und Empathie den Dienst – und zwar so sehr, dass Elda ahnt, mit wem sie es zu tun hat. Ein „feiger Komödiant, trunken von Worten“, sei er, schreibt sie ihm in ihrem Antwortbrief. Mit scharfem Blick hat sie die größte Schwäche ihres – so jedenfalls scheint es in diesem Moment noch – angehenden Ehemanns erkannt: D’Annunzio ist ein Mann der Worte, sie bilden seine vornehmste Realität, der sich alles Weitere unterzuordnen hat. Ihre nüchterne Analyse hindert den Dichter nicht, sie ins Zentrum seiner Werke stellen zu wollen. „Alle meine in der Lyrik ersonnenen Frauen sind Puppen“, schreibt er ihr. „Es sind Marionetten aus Holz, mit Köpfen aus Wachs. Aber du, du wirst in meinen Strophen zittern, weinen, lachen.“34
Es liegt auf der Hand: Elda ist des Dichters wichtigste Muse. Das könnte ein schönes Gefühl sein – wenn dieser Dichter nicht D’Annunzio wäre. Denn den leidenschaftlichen Ton der Briefe stimmt er womöglich aus Liebe an, ebenso aber auch aus Kalkül. Elda nämlich – wenn nicht die reale, so zumindest die poetisch aufgeladene Elda, an die er sich in seinen Briefen wendet – beflügelt seine poetische Kreativität, versetzt ihn in jene Stimmung, die den hohen Ton seiner Briefe überhaupt erst möglich macht. Darum – auch darum – muss Elda bleiben, darf sie fürs Erste nicht von ihm loskommen.35
Über Monate setzt sich die Korrespondenz fort. Doch dann, im Januar 1883, schreibt er ihr einen seiner letzten Briefe: „Lebewohl, Lebewohl, Lebewohl, mein heiliges, mein wundervolles und leidendes Kind.“ Es folgen weitere Briefe, die die Trennung ankündigen. Im März schickt er ihr seinen vorerst letzten Text – ein Telegramm: „Habe deinen Brief erhalten. … Ich bin halb krank, sehr traurig. Lebewohl. Gabriele.“ Wenige Wochen zuvor hat Gabriele eine andere Frau, Maria Hardouin, kennengelernt. Er habe sich, vertraut D’Annunzio einem Freund an, „mit an Wahnsinn grenzender Gier in die Turbinen der Lust“ gestürzt.36 Die Lust ist, für die nächsten Jahre zumindest, hinreichend erfüllend. Bald werden die beiden heiraten. Der zehn Jahre später geschiedenen Ehe werden drei Kinder entspringen.
Die unglückliche Elda hingegen war als Adressatin von D’Annunzios Liebesbriefen eine Art literarische Versuchsperson, an der der Dichter die Wirkungen seiner Zeilen testete. An ihren Antworten las er ab, welchen Eindruck bestimmte Worte, Metaphern und Stilebenen machten.
Darüber wurden die Briefe für die junge Frau zur Falle. Sie verrannte sich in ihnen wie rund hundert Jahre vor ihr Madame de Tourvel, eine der Figuren des Briefromans Les Liaisons dangereuses (Gefährliche Liebschaften) des französischen Offiziers Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos. Indem Madame de Tourvel sich auf eine Korrespondenz mit dem zynischen Edelmann Vicomte de Valmont einlässt, wird sie zu dessen willenlosem Opfer, das ohne die Briefe nicht mehr glaubt leben zu können. De Laclos’ berühmter Briefroman räumte radikal mit dem Topos auf, dass Liebesbriefe ausschließlich zum Wohle einer Beziehung geschrieben werden. Bisweilen dienen sie auch dem genauen Gegenteil. Kaum weniger zynisch verfährt D’Annunzio, indem er den zumindest für Elda existentiellen Unterschied zwischen Liebesbriefen und Dichtung nicht achtet.
Der fließende Übergang zwischen privatem und fiktivem Schreiben zeigt sich in dem 1882 erschienenen Gedichtband Canto Novo, gewidmet „E. Z.“ – Elda Zucconi. D’Annunzio hat allen Grund, der Verflossenen zu danken: Der Band basiert nicht zuletzt auch auf den Briefen, die er ihr geschrieben hat. In dessen allerersten Strophen erwähnt der Dichter das „Lächeln“ der Geliebten, das er auch in seinen Briefen an sie regelmäßig erwähnt hat. „Wo immer du mir erschienen bist, hast du mich angelächelt“, heißt es in einem Brief vom 1. Mai 1881. „Dein lächelndes Bild, ein göttliches Lächeln von Liebe und Schmerz“, heißt es am 5. Dezember desselben Jahres. „Ich habe hier auf dem Tisch … den Schatz deines Lächelns“, schreibt er am 8. Januar 1882. Die Reihe lässt sich fortsetzen.37 Auch die „weiße Magierin“, die in der folgenden Strophe ihren Auftritt hat, findet ihre Entsprechung in den Briefen. „Bist du nicht eine Magierin?“, fragt er am 7. Mai 1882. Und dann, in einer Variante, am 18. Mai: „Aber du, aber du, aber du bist eine ungeheure Sirene.“ Zehn Jahre später wird er den Begriff auch auf eine andere Geliebte, Barbara Leoni, beziehen, wenn auch in seiner adjektivischen Form: „Du bist, gewiss, auch magisch … Zum Glück bist du magisch“, wird er ihr im April 1892 schreiben.38
Derartige Parallelen zwischen Liebesbriefen und Gedichten finden sich zuhauf. Das Private da, wo es passt, öffentlich zu machen, diese Strategie wird D’Annunzio immer wieder nutzen. Auch seine Beziehung zu der damals in weiten Teilen Europas hoch populären Schauspielerin Eleonora Duse – die beiden lernen sich 1894 in Venedig kennen und bleiben rund zehn Jahre ein Paar – wird diesem Prinzip folgen. Ihre Beziehungen pflegen sie „vor Tausenden und Tausenden von Augen. Das Öffentliche und das Private, Liebe und Geschäft zu vermengen, ist die Ursünde der beiden.“39