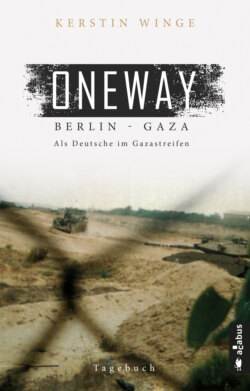Читать книгу Oneway – Berlin-Gaza. Als Deutsche im Gazastreifen - Kerstin Winge - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеBerlin-Lichtenberg von 1988 bis 1994
An einem milden Spätnachmittag im Oktober 1988 saß ich mit drei meiner Arbeitskolleginnen im Café Moskau, weil ich mit ihnen meinen 23. Geburtstag feiern wollte. Das Café befindet sich auch heute noch am U-Bahnhof Schillingstraße, nicht weit von meiner damaligen Arbeitsstelle, dem Kunstgewerbegeschäft Kunst im Heim. Aus diesem besonderen Nachmittag wurde bald Nacht, die Musik rhythmischer, das Licht schummriger, die Getränke schmeckten besser und wir lachten lauter. Auch die Gestik und das Gehabe der Männer um uns herum wurden eindeutiger.
Irgendwann spürte ich seine Blicke und sah hinüber. Hitze stieg mir ins Gesicht und ich war verwirrt: Er unterhielt sich mit seinen Begleitern, nippte dabei an seinem Glas und blickte immer wieder zu mir. Direkt in meine Augen. Im Schein der Barbeleuchtung fiel mein Blick auf seine weinrote Krawatte, an der etwas Silbernes blitzte. Neben seiner geschmackvollen Kleidung konnte ich zwischen seinen welligen Haaren vereinzelte graue Haarsträhnen schimmern sehen. Mein Herz stolperte und meine Kolleginnen waren von da an unwichtig.
Nach einer halben Stunde saß er neben mir und sah mich interessiert an. Ich war so aufgeregt in seiner Nähe! Seine Deutschkenntnisse waren unvollständig und Begriffe, die er nicht kannte, ersetzte er einfach mit englischen Wörtern. Er sagte, dass er Said heiße, 33 Jahre alt sei und aus dem Gazastreifen komme. Noch nie davon gehört, wo ist das denn?, fragte ich mich erstaunt. Doch die Musik war zu laut, um Näheres über ihn zu erfahren, wir wollten einfach nur tanzen und uns dabei in die Augen schauen. Gegen zwei Uhr fiel ich ins Bett, immer noch aufgewühlt vom aufregenden Abend und den Duft seines Aftershaves in meiner Nase. Ehe ich einschlief, hörte ich in meinem Ohr noch das letzte Lied, zu dem wir eng getanzt hatten.
Er wollte mir einfach nicht mehr aus dem Kopf gehen, nicht am nächsten und auch nicht am übernächsten Tag. Ständig musste ich an seine blaugrauen Augen denken und daran, wie es war, als wir eng umschlungen tanzten. Ihm schien es nicht anders ergangen zu sein, denn am dritten Tag nach unserer Begegnung stand Said in unserem Kunstgewerbegeschäft. Er kaufte eine Tischdecke und fragte mich dabei, ob und wo wir uns heute treffen könnten. Wie sehr sehnte ich an diesem Tag den Feierabend herbei! Mein Herz schlug mir bis zum Hals, als ich ihn in der Mokka-Milcheisbar neben dem Kino International wiedersah. Er war der erste Mensch, mit dem ich redete, der nicht aus der DDR kam, das wurde mir in dem Augenblick bewusst. Gerade diese Tatsache machte ihn für mich so anziehend. Aufmerksam hörte ich ihm zu, während er von seiner Familie und der großen Sehnsucht nach seiner Heimat, dem Gazastreifen, erzählte. Warum besucht er sie denn nicht einfach?, fragte ich mich insgeheim öfter.
Ich war so sehr verliebt in Said! Alle Schmetterlinge in meinem Bauch flatterten, sobald ich nur an ihn dachte. Sein ironischer Humor, seine Hände, mit denen er während des Sprechens elegant gestikulierte, die Art, wie er Auto fuhr, wie er mit seinen Freunden und Bekannten umging, sein tiefes, warmes Lachen, seine funkelnden Augen, wenn er mich amüsiert ansah oder berührte – von all dem konnte ich nicht genug bekommen.
Said wohnte in Berlin-Pankow inmitten einer Neubausiedlung, wo Ausländer unterkamen, die in Botschaften oder anderen ausländischen Vertretungen tätig waren. Er arbeitete im Internationalen Handelszentrum an der Straße Unter-den-Linden. Immer, wenn ich zum Feierabend zu ihm fuhr, hatte er bereits Abendessen vorbereitet, mit wunderbaren Gewürzen und selbstgebackenem Fladenbrot. Im Laufe dieser Zeit lernte ich auch Manuela und Susan kennen, deren Männer Landsmänner und Arbeitskollegen von Said waren. Sie würden ebenso wie ich 1994 im Windschatten der Osloer Verträge Berlin verlassen, um in den Gazastreifen umzuziehen.
Immer, wenn er Geschichten über seine große Familie und seine Heimat erzählte, hörte ich ihm beeindruckt zu, denn dabei konnte ich ihm bis ins Herz sehen. Seine tiefen Emotionen berührten mich sehr. In vielen Dingen war und blieb er für mich weiterhin geheimnisvoll. Daraus entstanden auch einige Missverständnisse, die unsere Zweisamkeit interessant und prickelnd machten. Dass ich die arabische Sprache nicht verstand, unterstrich das Gefühl des Geheimnisvollen noch. Im Laufe unseres Zusammenlebens merkte ich, dass Said jemand war, der Gespür und Geschick besaß, wenn es darum ging, etwas zu erreichen oder etwas zu besitzen. Seine ausgeprägte Verhandlungsstärke und Hartnäckigkeit kam ihm dabei zugute. Menschen zu überzeugen und dabei für sich zu gewinnen, das war genau seine Berufung. Jedoch gerade deshalb war er aber auch imstande, Menschen zu dirigieren und zu manipulieren. Er war ein geborener Puppenspieler, Taktiker und Diplomat.
Im März 1990, anderthalb Jahre nach unserem Kennenlernen, machte mir Said einen Heiratsantrag. Unbeschreiblich glücklich sagte ich vertrauensvoll und verliebt »Ja«. So feierten wir unsere Hochzeit in einer Gaststätte in Berlin-Pankow zusammen mit ungefähr 100 Gästen. Es war ein rauschendes Fest, mein Kleid war traumhaft schön und Said an meiner Seite auch. Glücklich scherzend sagte ich zu ihm: »Du gehörst jetzt zu mir!«, während ich dabei besitzergreifend meine Arme um ihn legte. Von Saids Familie konnte wegen der politischen Lage niemand zum Fest kommen. Umso leichteres Spiel hatte er, mich im Oktober desselben Jahres davon zu überzeugen, seine Familie im Gazastreifen kennenzulernen. Er selbst hätte niemals mitreisen können, weil er keine Einreisegenehmigung erhalten hätte. Er meinte dazu erklärend und mit ernstem Blick zu mir, dass die Israelis ihn sofort ins Gefängnis stecken würden. 15 Jahre lange hatte er seine Familie und Heimat nicht gesehen. Wie konnte ich seine Sehnsucht nachfühlen. Ich würde also nach Gaza fliegen und ihm meine Eindrücke und Erlebnisse so authentisch wie möglich vermitteln. Die Reise sollte zwei Wochen dauern.
Noch nie hatte ich Deutschland bis zu diesem Zeitpunkt verlassen, weder mit dem Zug noch mit dem Flugzeug.
So kam es, dass mich Said im Oktober 1990 zum Flughafen Berlin-Schönefeld brachte. Die Passagiere, die mit der Fluglinie der El Al nach Tel Aviv fliegen wollten, wurden gesondert abgefertigt. In diesem Terminal befanden sich sehr wenige Zivilisten, dafür aber umso mehr zivile Security. Das verwunderte mich, weil ich nicht verstand, warum und wozu. Ein Anzugträger mit randloser Brille und wasserblauen Augen startete seine sehr intensive Befragung, während dazu im Hintergrund zwei Männer mit einer M16 in Habtacht-Stellung standen: Was die Gründe für meine Reise seien, wohin ich genau wolle, bei wem ich leben würde, welche Geschenke ich dabei hätte und ob sie in meiner Abwesenheit verpackt in meine Tasche gesteckt worden seien. Das waren nur die ersten Fragen. Sie wollten alles wissen, auch, wer der Mann war, der mich eben zum Terminal gebracht hatte. Worauf ich unschuldigen Blickes erwiderte, es sei der Mann meiner Freundin. Dabei hatte ich unsere eigenen Hochzeitsfotos für Saids Familie in der Tasche dabei und der Mossad hatte mich schon längst durchschaut. Heute staune ich über meine Naivität.
Die Hitze auf dem Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv empfing mich wie bei einem spontanen Eintritt in eine Sauna. Es wurde langsam dunkel, als ich in die Empfangshalle eintraf. Überfordert beim Anblick der vielen fremd aussehenden Menschen, dachte ich spontan und beunruhigt: Oh mein Gott, wo soll ich hin, ich will wieder zurück ins Flugzeug nach Berlin! Was mache ich nur, wenn mich jetzt niemand abholt? Ich hatte keinen Plan B parat. Kurz darauf hörte ich jemanden »Kristina« rufen. Ich sah einen Mann, der große Ähnlichkeit mit Said hatte. Das war sein Bruder Abu Ali, der mich sofort herzlich umarmte, als ob er mich schon lange kennen würde. Wie erleichtert ich war!
Die Fahrt in den Gazastreifen wurde unterbrochen von zwei Kontrollen an Checkpoints des israelischen Militärs. Mein Gepäck, welches zum größten Teil aus Garderobe und Süßigkeiten bestand, wurde intensiv und ausgiebig durchsucht. Die Soldaten starrten mich dabei verständnislos an. Sicher war ich seit Langem die erste ausländische Touristin für sie, die Urlaub in einem Land machen wollte, in dem die Luft bleigeschwängert ist. Nach einer für mich endlosen Fahrt durch die Dunkelheit kamen wir endlich in Chan Yunis an. Das erste Tier, welches ich auf einer größeren Hauptstraße sah, war eine Ratte. Flink hangelte sie sich über die vielen Stromkabel, welche in einem heillosen Durcheinander quer über den Straßen und Häusern miteinander verknüpft waren. Dabei benutzte sie balancehaltend ihren Schwanz. Ausgestiegen, liefen wir eine enge Sackgasse hinauf, in deren Mitte leise ein grün-schwarzes Rinnsal hinab zur Hauptstraße floss. Oben angekommen stand ich vor einem alten und baufälligen Haus, in dem Said einst mit seinen acht Geschwistern aufwuchs. Hier wohnte nun Abu Ali mit seiner Frau und ihren damals sechs Kindern.
Als ich durch das schmiedeeiserne Tor ging, stieß ich mir den Kopf an einer Steinecke und bekam sogleich eine Beule. Nicht für Menschen über 1,80 Meter geeignet, dachte ich schmerzerfüllt, während ich meinen Kopf abtastete. Trotz Erschöpfung war ich sprachlos über die Gegensätze, die ich nun erlebte. Das hatte ich nicht erwartet. Selber in einer Familie mit zwei Geschwistern aufgewachsen, in der die Eltern keine Großverdiener waren, hatten wir doch alles, was wir zum Glücklich sein brauchten: Strom, sauberes Wasser und eine warme, trockene Wohnung ohne unerwünschte Haustiere. Wie anders hier doch alles ist, kam es mir in den Sinn, als ich ein paar Minuten mit mir allein war.
Die halbe Stadt wusste Bescheid, dass eine ausländische Frau eingereist war und zum Clan einer großen Familie gehörte. Sie alle kamen, um die Ehefrau von Said zu begrüßen. Da saß ich nun unter einer mit Wellblech überdachten, neonbeleuchteten Terrasse und wurde von einer lächelnden und immer größer werdenden Menschenmenge begrüßt. Ihre weiße Kleidung blendete mich förmlich. Während dieses Momentes, auf der Bastmatte mit angewinkelten Knien sitzend, wurde mir erstmals bewusst, wo ich mich tatsächlich befand: an einem ziemlich gefährlichen Ort, weit weg vom sicheren Heimatland. Ich umschlang meine Knie fester. Der Bruder von Said gab sich große Mühe, mir die anwesenden Familienmitglieder vorzustellen. Leider konnte ich mir nur einige ihrer Namen merken. An diesem Tag lernte ich aber meine ersten drei Wörter auf Arabisch: »Bdisch, schukran.« (Ich möchte nicht, danke.) und »Alhamdullah« (Gott sei es gedankt).
Selbstverständlich sollte ich im ehelichen Schlafzimmer des Hauses schlafen. Die Nacht war sehr unruhig, denn die gesamte Familie blieb noch lange wach. Es wurde leise gemurmelt, Plastikstühle wurden hin und her geschoben, Kinder lachten und der Fernseher lief – eben das volle Familienprogramm. Und das um Mitternacht! Fast wäre ich eingeschlafen, als ich plötzlich ein leises, schnelles Trappeln direkt auf meinem Kopfkissen hörte. Es war eine Maus, die in meinem Bett auf Entdeckungstour ging. Ich war fasziniert darüber, denn es war die erste Maus, die ich aus der Nähe sah. Es sollten aber noch viele weitere folgen.
Am nächsten Tag bekam ich Bauchschmerzen, kämpfte mit Durchfall und musste mich in einem fort übergeben. Abu Ali und der Rechtsanwalt der Familie brachten mich angesichts meines Zustandes in das hiesige Krankenhaus Jamal-Abdel-Nasser. Dort begegneten uns israelische Soldaten, die gerade das Krankenhaus nach flüchtigen Jugendlichen durchsuchten, weil sie zuvor deren Fahrzeuge mit Steinen beworfen hatten. Sie staunten nicht schlecht, als sie eine blonde Frau mit traditioneller, bodenlanger, paillettenbesetzter Bekleidung im Gang stehen sahen. Es war eine Ehre für meine Schwägerin Umm Ali, der Frau von Abu Ali, dass ich ihre schönste Jalabija trug. Während ich wegen meines Brechdurchfalles eine Infusion erhielt, kamen Patienten, Schwestern und Ärzte in das Zimmer, um die Deutsche zu besichtigen. Sie redeten auf mich ein und ich sah sie nur mit großen Augen an. Ich kam mir verloren vor, während die Infusion endlos langsam in meinen Arm tropfte. Wie sehr wünschte ich mich nach Hause zurück während dieser drei Stunden im Krankenhaus.
Alle Kinder gingen unregelmäßig zur Schule, da die Israelis oft Ausgangssperren verhängten. So saß ich mit den Frauen und älteren Kindern zusammen und unterhielt mich mit ihnen oder schaute mir ihre Schulbücher an. Daraus entstanden oft lustige Unterhaltungen, die uns untereinander halfen, uns emotional näher zu kommen. Abu Ali gab ich meine Kamera, damit er Fotos von den Familienmitgliedern machen konnte. Von jenen, die im Kiez der Stadt lebten, und denen, die draußen auf dem Lande ihre Häuser hatten. Und das in einem Auto, welches in Deutschland niemals mehr eine TÜV-Plakette bekommen hätte. Als Beifahrerin war ich ziemlich erstaunt, dass es keinen Gurt zum Anschnallen gab und warum die Fensterscheibe sich nicht hochkurbeln ließ, wurde mir auch bald klar: Es gab gar keine. Somit wehte mir der Fahrtwind ununterbrochen durch die Haare. Während unserer Foto-Session mit den Familienangehörigen entstanden Aufnahmen an Orten, die Said aus seiner Jugend kannte. Ich freute mich schon unbändig darauf, das Gesicht von Said und seine Reaktion beim Anblick der Menschen zu sehen, die er seit vielen Jahren vermisste, und beim Anblick der Stadt, die er vor so vielen Jahren verlassen hatte. Ich sollte mich an bedeutungsvolle Orte stellen, wie zum Beispiel auf ein Feld, auf dem Kartoffeln angepflanzt waren. Auch fand ich mich unter einem uralten, verknöcherten Maulbeerbaum wieder und kauerte danach vor einen Lehmofen, der in einer mit Ästen und Palmwedeln gebauten Hütte stand. Zuletzt wurden mir einige ältere ehrwürdige Herrschaften zur Seite gesetzt, die die Onkel der Familie waren. Welche Bedeutung das Kartoffelfeld oder der einfache Lehmofen für Said hatten, war mir dabei überhaupt nicht bewusst. Erst Jahre später würde ich verstehen, dass der Besitz von Ackerland der Nahrungsbeschaffung dient, finanzielle Sicherheit bietet und gleichzeitig den Status der Familie erhöht. Es waren außerdem die Orte seiner Kindheit, mit denen er sicher einzigartige Erinnerungen verband.
Abends kamen männliche Familienmitglieder, um zusammen zu musizieren. Sie sangen Volkslieder und Abu Ali begleitete sie mit seiner Oud, einer Art bauchiger Gitarre. Wir saßen dazu gemeinsam um das Kohlebecken und tranken süßen, heißen Salbeitee. Das waren sehr gelöste und entspannte Stunden, in denen viel gelacht und gescherzt wurde. Die Familie war glücklich über die Abwechslung, die ich ihnen mit meinem Besuch bescherte. Niemals spürte ich Ablehnung, Vorbehalte oder Misstrauen mir gegenüber. Dafür aber war die Neugier der jungen Mädchen überaus groß, wie und wo ich Said kennengelernt hatte. Das war ganz bedeutend für sie, da Ehen in ihrer Kultur immer noch sehr früh und von den Eltern arrangiert wurden. Ich war ja nun schon eine ältere Frischverheiratete und leider noch nicht schwanger.
Said wünschte sich landestypische Spezialitäten von mir mitgebracht zu bekommen, die er mir zuvor auf einem Blatt aufgelistet feierlich überreichte. Es waren: Hamasis, Dugga, Saata, Saralil, Fsich, Felfel machrut und Molocheya nashfa. Diese Lebensmittel herzustellen, war ungemein aufwändig, jedoch waren die Frauen sehr fleißig und freuten sich, ihrem geliebten Verwandten in der Ferne eine Freude machen zu können.
Am Tag der Abreise kam der engste Kreis der Familie, um sich von mir zu verabschieden. Morgens um drei Uhr fuhr mein Taxi nach Erez, dem Grenzübergang nach Israel. Es war immer noch Ausgangssperre und wir fuhren auf unserem Weg dorthin an vielen Panzern und anderen Militärfahrzeugen vorbei. Jahre später würde ich alle diese verschiedenen Fahrzeugtypen unterscheiden können. Zwei männliche Verwandte begleiteten mich auf meinem Weg durch die Dunkelheit, aber nur einer von ihnen durfte mich über den Grenzübergang Erez hinweg zum Flughafen Ben Gurion nach Tel Aviv bringen. Es war der Verheiratete. Der Grund war, dass die Israelis damit rechneten, dass verheiratete Männer normalerweise verantwortungsvoll für ihre Familie sorgen und keine Anschläge verüben. Am Grenzübergang angekommen, wollten die Soldaten unser Taxi nicht weiterfahren lassen. Durch das Mikrofon schallte es auf Hebräisch zu uns herüber: »Sofort stehen bleiben!« Ich spürte, wie der Taxifahrer nervös wurde und gleichzeitig sagte mein Begleiter zu mir, er könne mir nun leider nicht mehr helfen. Unser Taxi stand jetzt fünfzig Meter vor dem Kontrollpunkt im Scheinwerferlicht im Stillstand.
15 endlose Minuten vergingen. Was soll das hier? Ich darf meinen Flieger nicht verpassen, dachte ich und wurde immer nervöser. Kurz entschlossen stieg ich aus. Langsam näherte ich mich den Soldaten auf einem für mich endlos langen Weg auf der mit Scheinwerfern beleuchteten Straße des Checkpoints. Sechs Männer zählte ich beim Näherkommen mit klopfendem Herzen. Die Soldaten sahen mir entgegen und stießen sich dabei gegenseitig mit ihren Ellenbogen an. In meiner Unvoreingenommenheit ihnen gegenüber verlangte ich klar, ihren Chef zu sprechen, während ich einem von ihnen dabei fest in seine Augen schaute. Keine Reaktion. Könnt ihr kein Englisch, oder was?, dachte ich nun ärgerlich, während ich laut sagte: »Ich muss dringend zum Flughafen, um mein Flugzeug zu erreichen!« Sie schauten mich wortlos an und reagierten immer noch nicht. Weil ich nicht wusste, was ich machen sollte, drehte ich mich um und ging zurück zum Taxi. Minuten voller verzweifelter Gedanken vergingen. Endlich erscholl durch das Mikrofon ein lauter Ruf zum Weiterfahren. Wir durften die Grenze überqueren. Gerade noch rechtzeitig und innerlich aufgeregt erreichte ich den Flughafen, wurde von der Security von Kopf bis Fuß durchsucht, durfte einsteigen und kam, beladen mit vielen landesüblichen Spezialitäten und lebhaften Eindrücken, am Flughafen Berlin-Schönefeld an. Said erwartete mich mit einem Strauß tiefroter Rosen, bis über beide Ohren grinsend und mit überglücklichen Augen. Ich hatte das Gefühl, er wollte in mich hineinkriechen, um alle Erlebnisse und Begegnungen haarklein von mir zu erfahren. Als Erstes sah er sich alle Fotos an, die Abu Ali schon in Gaza entwickeln lassen hatte und das waren wirklich sehr viele. Ich beobachtete ihn, wie er von einem Begeisterungsausruf in den nächsten verfiel, bis er, von seinen Gefühlen überwältigt, schluchzte und zu weinen begann, während er dabei die Fotos allesamt an sein Gesicht drückte. Wie ich ihn liebte!
Im Dezember 1991 wurde ich schwanger. Endlich. Innerlich jubelnd und glücklich beobachtete ich beeindruckt, wie sich mein Körper veränderte. »Du wirst jetzt eine Mama«, sagte ich immer wieder stolz zu mir, während ich mich vor dem Spiegel betrachtete. Saids Augen glänzten, als er auf dem Ultraschallbild einen kleinen Penis schwimmen sah. Im August 1992 kam Andre auf die Welt. Er hob sofort, von der Hebamme auf meinen Bauch gelegt, sein Köpfchen und sah mich direkt an, als ich ihm liebevoll zuflüsterte: »Da bist du ja endlich!« Andre entwickelte sich zu einem pflegeleichten, gesunden, oft gut gelaunten Riesenbaby mit hellblonder Mähne und großen, blauen Augen.
Als ich nach 13 Monaten zur Frauenärztin ging, um mir vorsorglich die Pille verschreiben zu lassen, schwamm bereits Adrian im dritten Monat in meinem Bauch herum. Ein Überraschungsgast zwar, aber dafür mit ewigem Hausrecht. Als ich nach Hause kam, sah mir Said sofort an, dass etwas passiert sein musste. Mein Gesicht war kalkweiß, als ich Said vom erneuten unverhofften Familienzuwachs erzählte. Er sah mich zuerst besorgt, dann entgeistert, schließlich aber doch freudig an. Ende März 1994 war es dann so weit: Im selben Krankenhaus und zufällig von derselben Hebamme wurde mir Adrian in den Arm gelegt, der zuvor, kaum 30 Sekunden auf der kalten Welt, lauthals protestierend losgeschrien hatte. Augenblicklich war ich tief erfüllt von mütterlicher Liebe zu diesem Kleinen mit den großen, braunen Kulleraugen.
Am Anfang Juni 1994 rief Saids Vorgesetzter an und beorderte ihn in den Gazastreifen zurück. Er und viele seiner Landsmänner aus Berlin würden dort gebraucht, hieß es. Viele können sich sicher noch an das spektakuläre Bild vor dem Weißen Haus erinnern, vor dem sich Jitzchak Rabin und Yasser Arafat, initiiert durch Bill Clinton, die Hand gaben. Damit änderte sich die politische Lage von Grund auf: Der Weg in die Heimat stand Said und vielen anderen Palästinensern mit einem Male wieder offen. Eine völlig neue Situation entstand nun auch für uns privat. Said war natürlich, wie alle der in Deutschland lebenden Palästinenser, beseelt und erfüllt von Freude und Optimismus, endlich wieder nach Hause reisen zu können. Ich dagegen war unsicher und wollte nicht wahrhaben, was uns nun unweigerlich bevorstand, nämlich die Ausreise in den Gazastreifen. Der Plan war, dass er vorausfliegen würde und ich später nachkommen sollte. Ein verantwortungsvoller und gut bezahlter Posten erwartete ihn dort. So reiste er mit zwei Koffern ab.
Für die nächsten drei Monate allein, hatte ich genug Zeit, darüber nachzudenken, ob ich wirklich fliegen sollte. Für mich war klar, dass wir zusammen gehören. Unsere Kinder sollten niemals getrennt vom Vater aufwachsen müssen. Bei der Hochzeit habe ich nicht nur als Lippenbekenntnis »Ja« gesagt. Als ich über unseren Entschluss mit meinen Eltern sprach, fanden sie ihn gar nicht gut. Jedoch merkten sie bald, dass ich mich nicht umstimmen ließ, Deutschland und damit auch sie zu verlassen. Wie viel Kraft und welchen Zeitaufwand es für meine Eltern abschließend bedeutete, unsere Wohnung aufzulösen, inklusive der Abmeldung bei den Ämtern, darüber machte ich mir wenig Gedanken. Geschweige denn, wie sich Eltern fühlen, wenn sie ein Kind verlässt, um in die Dritte Welt auszuwandern.