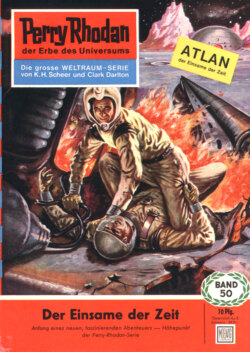Читать книгу Perry Rhodan 50: Der Einsame der Zeit - K.H. Scheer - Страница 5
Оглавление2.
Die Zusammenstellung meiner Ausrüstung war ein einfaches Rechenexempel gewesen. In einer Einöde benötigt man weder Angriffswaffen noch spezielle Mittel zur Abwehr.
Dagegen hatte ich aber für einen einwandfreien Schutz gegen radioaktive Strahlungen gesorgt und meinen Anzug-Reaktor voll aufgeladen. Energie würde ich wohl reichlich benötigen.
Der Zellschwingungsaktivator, mein kostbarster Besitz überhaupt, war von der positronischen Feinautomatik neu abgestimmt worden. Infolge des langen Bioschlafes hatten sich die Individualfrequenzen meiner Zellmoleküle etwas verändert.
Das eiförmige Kleingerät hing auf meiner nackten Brust. Darüber trug ich den schweren, unbequemen Strahlschutzanzug, mit dem ich die über mir lastende Wassermauer gut zu überwinden hoffte.
Mein einziges Verteidigungsgerät bestand aus einem harmlosen Psycho-Strahler, dessen hypnosuggestive Wirkung völlig ausreichen würde, um jeden eventuellen Gegner zur Aufgabe seines Angriffs zu bewegen. Mehr brauchte ich nicht.
Im Rückentornister des Hochdruck-Feldanzuges hatte ich konzentrierte Nahrungsmittel und strahlungsabsorbierende Medikamente verstaut. Notfalls würde ich leidende Überlebende des verrückten Krieges in meine kostbare Unterseekuppel bringen müssen, da ich Kranke auf der Oberfläche wahrscheinlich nicht mehr folgerichtig behandeln konnte.
Nun ja – was konnte es schon schaden, harmlose und wahrscheinlich etwas stumpfsinnig gewordene Kriegs-Nachkommen in meine Behausung einzulassen. Sie konnten mir bestimmt nicht mehr gefährlich werden.
Vor fünf Tagen war ich durch die Roboteinrichtungen aufgeweckt worden. Nun war ich wieder so gekräftigt, dass ich den Aufstieg wagen konnte.
Ich überprüfte die Flugfähigkeit meiner Ausrüstung. Die Antigravitationsschaltung funktionierte einwandfrei. Spielerisch leicht hob ich mich vom festen Boden der Kuppel ab.
Rico beobachtete mein Tun aus kühlglänzenden Mechanoaugen. Auf dem Bildschirm des Betrachters leuchteten noch immer die schriftlich und bildlich festgehaltenen Nachrichten, die vor runden 69 Jahren aktuell gewesen waren.
Ehe ich die Kuppel verließ, schritt ich nochmals zum Betrachter hinüber. Mit bitteren Gefühlen las ich die Nachrichten einer amerikanischen Zeitung, wonach die erste bemannte Rakete der Menschheit heil auf dem Mond gelandet war.
Kommandant des Schiffes war ein gewisser Perry Rhodan gewesen, Major und Risikopilot der US-Space-Force. Ehe dieser Mann gestartet war, hatte ich ihn persönlich getestet. Mein Eindruck war der allerbeste gewesen, nur hatte ich damals – es war am 15. Juni 1971 gewesen! – nicht ahnen können, dass eben dieser Space-Force-Major indirekt den längst befürchteten Atomkrieg verursachen könnte. Ich wusste nur noch, dass er auf dem Mond etwas gefunden hatte, was für alle irdischen Machtgruppen ungeheuer wertvoll war. Rhodan hatte sich geweigert, die Entdeckungen auszuliefern. Er war mit seinem Mondschiff in der menschenleeren Wüste Gobi gelandet, und da war es losgegangen.
Letzte Berichte hatten von energetischen Schutzschirmen gesprochen, die Major Rhodan über seinem Mondschiff errichtet hätte. Ich hatte durch den überstürzten Ablauf der Ereignisse keine Gelegenheit mehr, die teils kuriosen Zeitungs- und Fernsehberichte nachzuprüfen.
Ehe ich nach einer raschen Flucht aus meinem damaligen Entwicklungslabor für atomare Raumschiffsantriebe unter der Meeresoberfläche verschwand, waren in Asien bereits die ersten Kampfraketen gestartet. Man hatte die Nerven verloren und übereilt auf die Knöpfe gedrückt. Jede Partei war dabei der Meinung gewesen, dieser Rhodan würde eine entscheidende Rolle auf dem Weg der wissenschaftlichen Erkenntnisse spielen. Man hatte sich benachteiligt gefühlt und dem Nachbar misstraut. So war es zu einem Krieg gekommen, den niemand hatte verhindern können.
Ich hatte dagegen die Explosionen in sicherer Meerestiefe verschlafen. Nun stand ich vor dem Schirm des Betrachters und war dabei bemüht, mein instinktives Zögern logisch zu begründen. Ich schob meinen Ausflug nach oben hinaus, obwohl mir mein Gefühl sagte, dass ich schließlich doch nachschauen müsse.
Hinter mir läutete die Glocke der Hochdruckschleuse. Ich konnte gehen.
Ein letzter Blick galt einer Teleobjektiv-Aufnahme. Wahrscheinlich war das Bild von einer Raumstation aufgenommen worden. Mitten im glutenden Sandmeer der Gobi lag ein blitzender Körper, der von einem fluoreszierenden Leuchten überdeckt war.
Dieses Bild hatte ich oft betrachtet. Es war irgendwie rätselhaft. Wenigstens war es für meine Begriffe unvorstellbar, eine derart primitive Flüssigkeitsrakete unter einem hochwertigen Energieschirm liegen zu sehen.
Ich schaltete in Gedanken ab. Es war sinnlos, über längst vergangene Dinge nachzugrübeln. Die Menschheit hatte sich selbst ihr Grab gegraben. Auch Major Perry Rhodan, der wahrscheinlich völlig unwissend den Stein des Anstoßes ins Rollen gebracht hatte, musste längst verstorben sein. Er war damals etwas über 30 Jahre alt gewesen.
Der Betrachter lief aus. Ich gab noch einige Anweisungen an die Programmierungsschaltung durch und schritt dann schwerfällig zum aufgleitenden Schleusentor hinüber.
Rico sprach keinen Ton mehr. Ich war alleine in der unterseeischen Festung. Wahrscheinlich würde ich auch oben alleine sein. Hinter mir glitt das stabile Schott zu. Ich schaltete mein Anzug-Schirmfeld ein, wartete ab, bis die Synchronschaltung der Druckausgleichautomatik Grünwert zeigte und zog dann den Schalter der Flutventile und Schnellentlüfter nach unten.
Schäumend schoss das unter hohem Druck stehende Wasser aus den Bodenschlitzen der Flutkammer. Es dauerte nur Sekunden, bis die Schleuse völlig gefüllt war. Das helle Pfeifen der verdrängten Luft mäßigte sich. Schließlich vergingen auch die Wirbel und Strudel, die mich trotz aller Anstrengungen, meinen festen Stand zu behalten, in der Kammer umhergeworfen hatten. Eigentlich war dieser Raum ja nur als Notausstieg gedacht gewesen. Es fehlte jeder Komfort.
Mein Schutzschirm arbeitete einwandfrei. Ich bewegte mich ruhig und sicher innerhalb der kugelförmigen Hülle, deren Luftvorrat bequem ausreichen musste, um mich gemächlich nach oben gleiten zu lassen.
Ich war gezwungen, meinen Schwerkraftregulator auf höhere Gravowerte einzustellen, da ich infolge des natürlichen Auftriebs hilflos an der oberen Schleusendecke klebte.
Erst nach einigen Minuten vorsichtiger Justierungsschaltungen hing ich in der Waage. Lautlos glitt das Außentor zurück. Vor mir lag die finstere Tiefsee mit ihren rätselhaften Lebewesen.
Ich ging bedächtig hinaus. Da mein Schutzschirm starr und nicht flexibel war, wären Schwimmbewegungen sinnlos gewesen. Ich schritt praktisch über den an dieser Stelle flachen Meeresboden, wobei ich lediglich den Wasserwiderstand zu überwinden hatte.
Die Infrarotstrahler auf meinem wuchtigen Helm leuchteten auf. Mittels der Spezialbrille gewann ich auf einige hundert Meter einen so guten Überblick, als hätte auch hier unten die Sonne geschienen.
Langsam, auf die automatische Fortbewegung noch verzichtend, betrat ich das Felsplateau. Hinter mir ragte die Halbrundung meiner Stahlkuppel in die unergründliche Schwärze.
Alles war still – nervenzermürbend still. Wahrscheinlich hatte es nicht viele Menschen gegeben, die jemals so alleine gewesen waren wie ich. Ich verzichtete darauf, die widerstandsfähige Halbkugel näher zu begutachten. Ich hatte 69 Jahre lang in ihr geruht, das reichte!
Knapp 200 Meter von der Flutkammer entfernt, begann die große Unterseeschlucht. Ich trat bis zu ihrem Rande vor, beugte den Kopf nach vorn und ließ die vorderen Helmscheinwerfer nach unten strahlen.
Ein selbstleuchtender Tiefseefisch kam neugierig näher. Ich wusste längst, dass viele Wasserbewohner infrarotes Licht als Stimulans empfanden. Man konnte seine Freude daran haben, wenn die zumeist bizarr geformten Lebewesen wie im Rausch zu tanzen begannen. Alles geschah in völliger Lautlosigkeit. Kein Geräusch unterbrach die Stille, die man nach einiger Gewöhnung nicht mehr als unheimlich, sondern nur noch als feierlich empfinden konnte. Vielleicht lag es aber in meiner Art, auf solche Sinneseindrücke anders zu reagieren als die meisten Menschen.
Ein erstes Lächeln entstand auf meinen Lippen. Der Fisch kam noch näher, begann sich zu wiegen, bis er unter dem hellen Aufleuchten seiner blauroten Körperorgane bedächtig zu tanzen begann.
»Hallo, kleiner Freund!«, rief ich ihm zu.
Ich lauschte meinen Worten nach und bildete mir dabei ein, der schlanke, kleine Bursche hätte geantwortet. Schließlich musste ich ihn mit einigen Handbewegungen verscheuchen, da er sonst meinem hochgespannten Energieschirm zu nahe gekommen wäre. Ich wollte nicht töten; auch nicht einen Fisch. Auf einem verwüsteten Planeten ist nichts heiliger und wertvoller als der letzte Rest des Lebens.
Dieser Gedanke rüttelte mich aus meiner Versunkenheit. Die Kontrolle meiner Instrumente brachte nur positive Ergebnisse. Von einer Radiostrahlung zeigten die Messgeräte nichts an. Wahrscheinlich waren nur die Feintaster der Kuppel zur Ortung der Radioaktivität geeignet.
Ich schaltete das Wirbelfeld ein, ging um 0,025 Prozent mit dem Gravitationswert nach oben und gewann somit einigen Auftrieb. Leicht glitt ich über die breite Schlucht hinweg.
Ich wusste, dass ich einer kugeligen Leuchterscheinung von hoher Intensität glich. Immer mehr Fische kamen auf mich zu.
Ich schwebte um einige Meilen nach Norden, bis das steil nach oben ansteigende Felsfundament der Azoren auftauchte. Von da an begann ich mit fünf Meter pro Sekunde zu steigen.
Andere Fische erschienen. Hier und da erfassten meine I-Scheinwerfer einen Felsvorsprung. Die ersten Tiefseepflanzen tauchten auf. Es waren Arten, die der Wissenschaft niemals bekanntgeworden waren. Die Menschen waren in den Weltraum vorgestoßen, ohne die Geheimnisse ihres eigenen Planeten völlig ergründet zu haben.
Ich lächelte still vor mich hin, bis mich wieder die Vorstellung an die atomare Katastrophe überfiel und das Lächeln von meinen Lippen wegwischte. In diesem Moment begann die kleine Warnanlage meines eingebauten Ortungstasters zu summen.
Ultraschnelle Impulse trafen auf meinen Schutzschirm, der sie infolge seiner strukturellen Stabilität getreulich reflektierte. Während der ersten Momente lauschte ich verblüfft auf das stärker werdende Summen des Warngerätes. Dann dachte ich an Tiefseemonster, die die Fähigkeit besaßen, ihre Opfer mit breitstreuenden Ultraschallwellen anzupeilen. Es war typisch für jene Räuber, die in dieser finsteren Wasserwüste keine andere Möglichkeit besaßen, ihr zumeist beachtliches Nahrungsbedürfnis zu befriedigen.
Ich stellte mich auf die Abwehr ein, bis ich plötzlich bemerkte, dass diese harten Wellen niemals von einem Fisch herrühren konnten.
Nach einigen Augenblicken benötigte ich die Warnautomatik nicht mehr. Die auftreffenden Impulse eines ultraschnellen Unterwasser-Ortungsgerätes verursachten Geräusche, die wie ein helles Piiiiing – Piiing klingen. Genau das vernahm ich.
Sekundenlang hing ich wie erstarrt in meinem Kugelfeld. Etwas Unglaubliches geschah; etwas, was es überhaupt nicht mehr geben durfte! Der Erinnerungssektor meines Extrasinnes meldete sich. Leute von meiner Art vergessen niemals etwas.
In schockierender Klarheit wurde mir eine Tatsache bewusst, die ich bisher kaum beachtet hatte.
Atom-U-Boot, Überlebende, Vorsicht!, gab mein Extrasinn durch.
Völlig unsinnigerweise begann ich mit Armen und Beinen zu rudern. Mein schwaches Unterwasser-Wirbelfeld erlaubte eine Schwebefahrt von bestenfalls zehn Seemeilen pro Stunde. Das genügte für eine gemächliche Fortbewegung, niemals aber für eine Flucht vor einem Unterwasserschiff mit atomaren Hochleistungstriebwerken!
Salziges Augensekret rann über meine Wangen, ein Zeichen dafür, dass meine Sinne alarmiert worden waren. Die auftreffenden Impulse wurden noch härter. Ehe ich die nächste Schlucht erreichen konnte, wurde ich von aufblendenden Scheinwerfern erfasst. Das dunkle Rumoren eines starken Triebwerks wurde vernehmbar. Von da an gab es keinen Zweifel mehr, dass meine Ausrüstung doch nicht ausreichend war!
Ich stellte meine Schwimmbewegungen ein und schaute blinzelnd in die grelle Lichtflut.
Wahrscheinlich hielt man mich für ein Meerestier. Eigentlich konnte es gar nicht anders sein, denn außer mir gab es wohl auf der ganzen Erde niemand, der einen solchen Strahlenschutzanzug besäße.
Mein Gehirn arbeitete logisch und nüchtern. Kämpfen war sinnlos, zumal ich nichts besaß, womit ich diesen stählernen Fisch hätte angreifen können. Es lag auch nicht in meinem Interesse, Überlebende des Atomkrieges in irgendeiner Form zu schädigen. Eigentlich kam es nur noch darauf an, heil ins Innere des Bootes zu gelangen.
Ich reduzierte meine Geschwindigkeit, wohl wissend, dass mein Körper bestenfalls als verschwommener Schatten erkannt werden konnte. Die Hülle meines Kugelfeldes leuchtete zu grell, um einen einwandfreien Durchblick zu gestatten.
Mein Nervensystem arbeitete zufriedenstellend. Angst hatte ich nicht. Ich lauschte noch schärfer auf das abklingende Donnern des Triebwerks. Nach einigen Sekunden begann ich in der Art angelockter Fische zu tanzen, dabei immer hoffend, dass da drüben niemand auf den Gedanken kam, einen Unterwasser-Jagdpfeil in mein Feld zu schießen. Ich wusste sehr genau, wie man noch vor dem Krieg große Tiefseefische gefangen hatte. Harte Stromstöße waren für die Stabilität meines Schutzschirmes von Übel.
Sie jagten mich! Es gab keinen Zweifel mehr. Hier und da konnte ich die schattenhaften Konturen eines kleineren Tiefseebootes erblicken. Es geschah immer dann, wenn ich für den Bruchteil einer Sekunde dem grellen Scheinwerferlicht entrann.
Als ich bemerkte, dass ich mich einer engen, steil nach unten führenden Schlucht genähert hatte, war es zu spät. Jäger darf man nicht reizen oder misstrauisch machen. Man kann sie überlisten, aber nicht in der plumpen Form, wie ich es nun unbedacht getan hatte. Natürlich nahmen sie an, ich könnte jeden Augenblick in dem finsteren Riss verschwinden.
Ein helles, kurzes Zischen klang auf.
Pressluftabschuss!, signalisierte mein Extrasinn.
Reglos wartete ich auf den Einschlag. Es wäre sinnlos gewesen, einem selbstlenkenden Jagdgeschoss entweichen zu wollen.
Ein flammendes Phantom raste auf mich zu. Nach genau zweieinhalb Sekunden hatte es mich erreicht. Ich sah die Kontaktspitze des Hochspannungskopfes in mein Feld eindringen, abgleiten und zünden.
Ultrahelles Leuchten umwaberte meinen Schutzschirm. Der Mikroreaktor in meinem Rückentornister summte warnend auf. Die rote Gefahrenlampe an meinem rechten Handgelenk begann zu flimmern. Feldüberlastung!
Schmerzhafte Stromstöße peitschten durch meinen Körper. Ich krümmte mich schreiend zusammen und versuchte verzweifelt, die beginnende Nervenlähmung von mir abzuschütteln.
Mit dem letzten Rest meiner Kraft schob ich den Schalter des Unterwasser-Sprechfunks nach unten, um mit versagender Stimme ins Kehlkopfmikrofon zu rufen: »Lasst den Unsinn, lasst es sein. Ich komme freiwillig!«
Wahrscheinlich lagen sie mit ihren Empfängern auf einer anderen Frequenz. Wer konnte genau sagen, wie lange diese Menschen bereits in ihrem U-Boot weilten, mit dem sie wahrscheinlich der damaligen Vernichtung entgangen waren.
Ein zweiter Schocktorpedo traf mein Feld. Wieder entstanden überhelle Entladungen, und wieder verkrümmte sich mein Körper. Mein letzter Sinneseindruck übermittelte mir das Gefühl einer hohen Beschleunigung. Dazu brach mein Schirmfeld zusammen. Diese Belastung hatte es nicht mehr aushalten können.
Trostlose Schwärze begann vor meinen Augen zu wallen. Etwas rauschte wie ein Wasserfall.
Wasserfall? In der Tiefsee? Lächerlich!
Es war ein verwaschener Impuls, der von meinem Extrahirn an meinen bereits betäubten Geist durchgegeben wurde. Natürlich konnte es mitten im Meer keinen Wasserfall geben.
Mein Schirm erlosch mit einem letzten matten Aufleuchten.
Aus!, dachte ich, endgültig vorbei!