Описание книги
"Ein gutes Buch, das seinen Platz verdient hat." Tobias Windhorst, Jura Journal 2012, Nr. 3, 34.
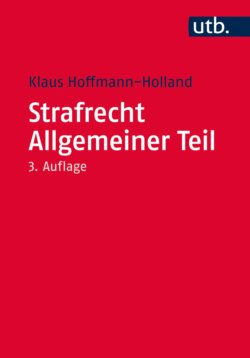
Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Inhaltsverzeichnis
|V|Vorwort zur 3. Auflage
|XXIII|Abbildungsverzeichnis
|XXIV|Tabellenverzeichnis
|XXV|Abkürzungsverzeichnis
|1|1. Kapitel Grundlagen und Grundbegriffe des Strafrechts. I. Strafrecht in der Rechtsordnung. 1. Strafrecht als eigenständiger Teil des öffentlichen Rechts
|2|2. Materielles und formelles Strafrecht
3. Systematik des Strafgesetzbuchs
4. Überblick: Einordnung des StGBAT
|4|II. Sinn und Zweck des Strafrechts. 1. Rechtsgüterschutz
2. Sinn der Strafe
a) Absolute Straftheorie
b) Relative Straftheorien
c) Vereinigungstheorie
III. Gesetzlichkeitsprinzip (Art. 103 Abs. 2GG; §§ 1, 2 StGB; Art. 7 Abs. 1EMRK)
1. Keine Strafe ohne (formelles) Gesetz
2. Bestimmtheitsgebot
3. Rückwirkungsverbot
4. Analogieverbot und zulässige Auslegung
5. Leitentscheidungen
IV. Aufbau der Straftat. 1. Grundlagen
2. Koinzidenzprinzip und Hinweis für die Fallbearbeitung
V. Einteilung und Erscheinungsformen der Straftaten
1. Verbrechen und Vergehen
2. Qualifikationen und Privilegierungen
3. Vorsatz- und Fahrlässigkeitsdelikte
4. Erfolgs- und Tätigkeitsdelikte
5. Verletzungs- und Gefährdungsdelikte
6. Begehungs- und Unterlassungsdelikte
|18|7. Vollendetes Delikt, versuchtes Delikt und Unternehmensdelikt
8. Allgemeindelikte und Sonderdelikte
9. Dauer- und Zustandsdelikte
10. Eigenhändige Delikte
VI. Geltungsbereich des deutschen Strafrechts
|20|1. Grundprinzip: Territorialitätsprinzip
a) Anwendung des Territorialitätsprinzips bei einzelnen Deliktsgruppen
b) Sonderprobleme
c) Anwendung des Territorialitätsprinzips bei mehreren Tatbeteiligten
2. Ausnahmen vom Territorialitätsprinzip
3. Leitentscheidungen
VII. Internationale Bezüge des Strafrechts
|26|1. Europarecht und Strafrecht
a) „Europäisches Strafrecht“
b) Beeinflussung des deutschen Strafrechts durch das Recht der EU
|28|2. Völkerstrafrecht
VIII. Strafrechtlich relevante Handlung
1. Handlungslehren
2. Leitentscheidungen
IX. Zusammenfassung
X. Übungsfälle
|33|2. Kapitel Tatbestand. I. Überblick
II. Kausalität
1. Kausalitätstheorien. a) Äquivalenztheorie
b) Lehre von der gesetzmäßigen Bedingung
|36|c) Adäquanztheorie
d) Relevanztheorie
2. Fallgruppen zum Kausalzusammenhang
a) Kausalität bei ungeklärtem Wirkungszusammenhang
|38|b) Nichtberücksichtigung hypothetischer Kausalverläufe
c) Abgebrochene bzw. überholende Kausalität
d) Alternative Kausalität
e) Kumulative Kausalität
f) Atypischer Kausalverlauf
|41|3. Leitentscheidungen
III. Objektive Zurechnung
1. Schaffung einer rechtlich missbilligten Gefahr. a) Fehlende Beherrschbarkeit des Kausalgeschehens und erlaubtes Risiko
b) Risikoverringerung
|45|c) Eigenverantwortliche Selbstgefährdung
2. Realisierung der Gefahr im tatbestandlichen Erfolg. a) Pflichtwidrigkeitszusammenhang
|49|b) Fehlender Risiko- bzw. Schutzzweckzusammenhang
c) Atypischer Kausalverlauf
d) Eigenverantwortliches Dazwischentreten eines Dritten
3. Leitentscheidungen
IV. Subjektiver Tatbestand, insbesondere der Tatbestandsvorsatz
1. Grundelemente des Vorsatzes
2. Zeitpunkt des Wissens: Simultaneitätsprinzip
3. Art des Wissens bei deskriptiven und normativen Tatbestandsmerkmalen
4. Arten des Vorsatzes, insbesondere bedingter Vorsatz
a) Absicht (dolus directus 1. Grades)
b) Direkter Vorsatz (dolus directus 2. Grades)
c) Bedingter Vorsatz (dolus eventualis)
5. Dolus cumulativus und dolus alternativus. a) Dolus cumulativus
b) Dolus alternativus
6. Leitentscheidungen
V. Tatbestandsirrtum. 1. Überblick: Tatbestandsirrtum und umgekehrter Tatbestandsirrtum
2. Irrtum über den Kausalverlauf
a) Früherer Erfolgseintritt
|65|b) Späterer Erfolgseintritt
3. Aberratio ictus
4. Error in persona vel obiecto
5. Leitentscheidungen
VI. Exkurs: HIV-Fälle und strafrechtlicher Tatbestand
VII. Tatbestandsannex: Objektive Bedingung der Strafbarkeit. 1. Bedeutung und Einordnung im Straftataufbau
2. Leitentscheidungen
|74|VIII. Zusammenfassung
IX. Übungsfälle
|76|3. Kapitel Rechtswidrigkeit. I. Grundlagen
|78|II. Notwehr (§ 32 StGB)
1. Notwehrlage
|79|a) Angriff. aa) Grundlagen
bb) Sonderproblem: Die Abwehr von „Scheinangriffen“
|82|b) Gegenwärtigkeit des Angriffs
c) Rechtswidrigkeit des Angriffs
|84|d) Leitentscheidungen
2. Notwehrhandlung
a) Verteidigung gegenüber dem Angreifer
b) Erforderlichkeit der Verteidigung
|87|c) Leitentscheidungen
3. Sozialethische Einschränkungen des Notwehrrechts („Gebotenheit“)
a) Bagatellangriffe und unerträgliche Unverhältnismäßigkeit
b) Angriffe von erkennbar Schuldunfähigen, insbesondere Kindern
c) Soziales Näheverhältnis zwischen Angreifer und Verteidiger
d) Art. 2 Abs. 1 S. 2, 2a EMRK
e) Notwehrprovokation
aa) Absichtsprovokation
bb) Unvorsätzlich-schuldhafte Provokation
cc) Abwehrprovokation
f) Erpressungsfälle
g) Leitentscheidungen
4. Verteidigungswille. a) Voraussetzungen
b) Auswirkungen des fehlenden subjektiven Rechtfertigungselements
|100|5. Notwehr und Nothilfe durch Hoheitsträger. a) Allgemeines
|101|b) „Rettungsfolter“
III. Notstand (§ 34 StGB)
1. Notstandslage
2. Notstandshandlung
a) Fehlende anderweitige Abwendbarkeit der Tat
b) Interessenabwägung
3. Angemessenheitsklausel
4. Rettungswille
|108|5. Leitentscheidungen
IV. Zivilrechtliche Notstandsregelungen (§§ 228, 904BGB)
V. Einwilligung
|111|1. Disponibilität des Rechtsgutes
2. Einwilligungslage
a) Einwilligung durch verfügungsbefugte Person
b) Einwilligungserklärung
c) Einwilligungsfähigkeit
d) Keine erheblichen Willensmängel
3. Subjektives Rechtfertigungselement
4. Speziell: Rechtfertigende Einwilligung im Fall der Sterbehilfe
5. Leitentscheidungen
|118|VI. Mutmaßliche Einwilligung
1. Einwilligungslage
a) Kein entgegenstehender Wille des Rechtsgutsinhabers bekannt
b) Erklärung des Rechtsgutsinhabers nicht rechtzeitig einholbar
c) Täterverhalten entspricht mutmaßlichem Willen
|120|2. Subjektives Rechtfertigungselement
3. Leitentscheidungen
|121|4. Exkurs: Die hypothetische Einwilligung
|122|VII. Vorläufige Festnahme (§ 127 Abs. 1 StPO)
1. Grundvoraussetzungen
2. Erlaubte Festnahmehandlungen
|124|3. Leitentscheidungen
VIII. Weitere Rechtfertigungsgründe. 1. Rechtfertigende Pflichtenkollision
2. § 241a BGB
3. §§ 229, 230BGB
4. Ablehnung eines Züchtigungs- und Erziehungsrechts
5. Leitentscheidung
|128|IX. Zusammenfassung
X. Übungsfälle
|130|4. Kapitel Schuld und Irrtum. I. Schuld: Grundlagen
II. Schuldfähigkeit
|131|1. Altersbedingte Schuldunfähigkeit
2. Schuldunfähigkeit wegen seelischer Störungen nach § 20 StGB. a) Einführung
b) Alkoholbedingte Rauschzustände
c) Hinweise für die Fallbearbeitung
3. Leitentscheidungen
III. Actio libera in causa
|137|1. Grundfall: Zur vorsätzlichen a.l.i.c. bei Erfolgsdelikten
a) Ausnahmemodell
b) Tatbestandslösung
c) Unvereinbarkeitstheorie
d) Abschließende Stellungnahme
e) Die a.l.i.c. in der Falllösung
2. Problemfall: Zur a.l.i.c. bei Fahrlässigkeits- und verhaltensgebundenen Delikten
a) Keine a.l.i.c. bei Fahrlässigkeitsdelikten
b) Keine a.l.i.c. bei verhaltensgebundenen Delikten
3. Leitentscheidungen
|146|IV. Entschuldigungsgründe
1. Überschreitung der Notwehr bzw. Notwehrexzess (§ 33 StGB)
a) Intensiver Notwehrexzess. aa) Grundlagen und Prüfungsschema
|148|bb) Problemfälle
b) Extensiver Notwehrexzess
c) Leitentscheidungen
2. Entschuldigender Notstand (§ 35 Abs. 1 StGB)
a) Notstandslage
b) Notstandshandlung
c) Zumutbarkeitsklausel
d) Rettungswille
e) Sonderfall: Der sogenannte „Nötigungsnotstand“
f) Leitentscheidungen
|156|3. Sonstige Entschuldigungsgründe. a) Übergesetzlicher entschuldigender Notstand
b) Art. 4 Abs. 1GG (Entschuldigende Gewissensnot)
V. Irrtum im Strafrecht
1. Verbotsirrtum. a) Gegenstand, Erscheinungsformen und Auswirkung des Verbotsirrtums
b) Leitentscheidungen
|160|2. Erlaubnistatbestandsirrtum
a) Vorsatztheorie
b) Strenge Schuldtheorie
c) Eingeschränkte Schuldtheorie
aa) Lehre von den negativen Tatbestandsmerkmalen
bb) Analogielösung
cc) Rechtsfolgenverweisende Schuldtheorie
d) Zusammenfassung und Hinweis für die Fallbearbeitung
e) Leitentscheidungen
f) Exkurs: Der „Doppelirrtum“
3. Entschuldigungstatbestandsirrtum und Entschuldigungsirrtum
VI. Zusammenfassung
VII. Übungsfälle
|173|5. Kapitel Täterschaft und Teilnahme. I. Abgrenzung von Täterschaft und Teilnahme
1. Rein subjektive Theorie
2. Tatherrschaftslehre
3. Modifizierte subjektive Theorie
|177|4. Hinweise für die Fallbearbeitung
5. Leitentscheidungen
|179|II. Täterschaft. 1. Unmittelbare Allein- und Nebentäterschaft
|180|2. Mittelbare Täterschaft. a) Einführung
|181|b) Tatherrschaftsbegründendes „Defizit“ beim Vordermann
aa) Objektiv tatbestandslos handelnder Tatmittler
bb) Unvorsätzlich handelnder Tatmittler
cc) Absichtslos-doloser Tatmittler
dd) Qualifikationslos-doloser Tatmittler
ee) Rechtmäßig handelnder Tatmittler
ff) Nicht schuldhaft handelnder Tatmittler
gg) Volldeliktisch handelnder Tatmittler
c) Subjektiver Tatbestand. aa) Anforderungen
|192|bb) Irrtumskonstellationen
d) Mittelbare Täterschaft durch Unterlassen
e) Leitentscheidungen
|196|3. Mittäterschaft. a) Einführung
b) Objektiver Tatbeitrag und funktionelle Tatherrschaft. aa) Grundlagen
bb) Sonderproblem: Mitwirkung im Vorbereitungsstadium
c) Gemeinsamer Tatplan. aa) Grundlagen
bb) Mittäterexzess
|202|cc) Error in persona eines Mittäters
d) Sonderfälle der Mittäterschaft. aa) Sukzessive Mittäterschaft
bb) Mittäterschaft bei erfolgsqualifizierten Delikten
|205|cc) Fahrlässige Mittäterschaft
e) Prüfungsaufbau bei Mittäterschaft
f) Leitentscheidungen
|209|III. Teilnahme. 1. Einführung. a) Akzessorietät der Teilnahme
b) Strafgrund der Teilnahme
c) Teilnahme im Prüfungsaufbau
2. Anstiftung (§ 26 StGB)
|212|a) Objektiver Tatbestand. aa) Grundlagen
bb) Bestimmen
cc) Auf-, Ab- und Umstiftung
b) Subjektiver Tatbestand. aa) Grundlagen
bb) Auswirkung des error in persona des Täters für den Anstifter
c) Agent provocateur
d) Leitentscheidungen
3. Beihilfe (§ 27 StGB) a) Objektiver Tatbestand. aa) Tathandlung, Taterfolg und Kausalität
bb) Sukzessive Beihilfe
cc) Beihilfe durch „neutrale“ Handlungen
b) Subjektiver Tatbestand
c) Leitentscheidungen
4. Besondere persönliche Merkmale (§ 28 StGB) a) Grundlagen
b) Anwendung von § 28 StGB auf §§ 211, 212 StGB
5. Versuch der Beteiligung (§ 30 StGB) a) Grundlagen und Anwendungsfälle
b) Prüfungsschema
c) Leitentscheidung
|230|6. Zusammenfassung
IV. Übungsfälle
|232|6. Kapitel Versuch und Rücktritt. I. Versuch. 1. Grundlagen: Stadien der Deliktsverwirklichung
2. Strafgrund des Versuchs
3. Prüfungsschema
a) Vorprüfung
b) Tatentschluss. aa) Grundlagen
bb) Abgrenzung zur bloßen Tatgeneigtheit
cc) Abgrenzung zwischen untauglichem Versuch und straflosem Wahndelikt
dd) Leitentscheidungen
c) Unmittelbares Ansetzen. aa) Grundlagen
bb) Abgrenzungsformeln
cc) Versuchsbeginn bei mittelbarer Täterschaft
dd) Versuch mit Opfermitwirkung
ee) Versuchsbeginn bei Mittäterschaft
ff) Versuch des unechten Unterlassungsdeliktes
gg) Versuchsbeginn bei der a.l.i.c
hh) Versuchsbeginn bei Qualifikationen und Regelbeispielen
ii) Leitentscheidungen
II. Rücktritt. 1. Grundlagen. a) Dogmatische Einordnung
b) Zweck der Rücktrittsregelung
c) Aufbau des § 24 StGB
2. Der Rücktritt nach § 24 Abs. 1 StGB
|255|a) Kein fehlgeschlagener Versuch
aa) Zeitpunkt der Bestimmung des Fehlgeschlagenseins: Ausgangsfall (BGHSt 34, 53)
bb) Lösung des Ausgangsfalls auf Grundlage der Einzelaktstheorie
cc) Lösung des Ausgangsfalls auf Grundlage der Gesamtbetrachtungslehre
|258|dd) Fallgruppen
ee) Leitentscheidungen
b) Abgrenzung von beendetem und unbeendetem Versuch
|263|c) Leitentscheidungen
d) Rücktrittsverhalten beim unbeendeten Versuch
aa) Aufgeben der Tatausführung trotz vorbehaltener Ausführungshandlungen
|266|bb) Sonderproblem: Das Erreichen außertatbestandlicher Handlungsziele
|267|cc) Leitentscheidung
e) Rücktrittsverhalten beim beendeten Versuch
aa) Rücktritt vom beendeten Versuch nach § 24 Abs. 1 S. 1 Var. 2 StGB
bb) Rücktritt vom beendeten Versuch nach § 24 Abs. 1 S. 2 StGB
|270|cc) Leitentscheidungen
f) Freiwilligkeit des Rücktritts
aa) Normative Bestimmung der Freiwilligkeit
bb) Empirisch-psychologische Betrachtung
cc) Leitentscheidung
g) Exkurs: Der Rücktritt vom Versuch des Unterlassungsdeliktes. aa) Grundlagen
bb) Leitentscheidung
3. Überblick über die Rücktrittsregelung in § 24 Abs. 2 StGB. a) Grundlagen
b) Leitentscheidung
III. Zusammenfassung
IV. Übungsfälle
|278|7. Kapitel Unterlassungsdelikte. I. Aufbau des vorsätzlichen unechten Unterlassungsdeliktes
|280|II. Abgrenzung von Tun und Unterlassen. 1. Grundlagen
|281|2. Lösung spezieller Fallgruppen
a) Abbruch eigener Rettungsbemühungen
b) Abbruch fremder Rettungsbemühungen
c) Omissio libera in causa
d) Abgrenzung bei Fahrlässigkeitsdelikten
|283|3. Unterlassen einer zur Erfolgsabwehr geeigneten und möglichen Handlung
III. Garantenstellung. 1. Grundlagen
2. Beschützergaranten
a) Enge Gemeinschaftsbeziehung auf familienrechtlicher Grundlage. aa) Grundlagen
bb) Anwendungsfall (BGHSt 48, 301)
b) Einverständliche Übernahme einer Schutzfunktion
c) Schutzpositionen aufgrund von Amtsträgerpflichten
d) Gefahrgemeinschaft
e) Speziell: Beschützergarantenstellung zur Verhinderung einer Selbsttötung
|291|f) Leitentscheidungen
3. Überwachergaranten
a) Gefährdendes Vorverhalten (Ingerenz) aa) Einführung
bb) Ingerenz bei rechtmäßigem Vorverhalten?
|295|cc) Ingerenzgarentenstellungen im Straßenverkehr
dd) Leitentscheidungen
b) Sachherrschaft über Gefahrenquellen
c) Garantenstellung durch Inverkehrbringen gefährlicher Produkte
|300|d) Leitentscheidungen
|302|IV. Kausalität und objektive Zurechnung beim Unterlassen. 1. Anforderungen an die Kausalität
2. Anforderungen an die objektive Zurechnung
3. Leitentscheidung
V. Entsprechensklausel
VI. Vorsatz und Irrtum beim Unterlassungsdelikt. 1. Anforderungen an den Vorsatz und Irrtumskonstellationen
2. Leitentscheidung
VII. Unzumutbarkeit normgemäßen Verhaltens
VIII. Täterschaft und Teilnahme beim unechten Unterlassen
1. Tatherrschaft beim Unterlassen
2. Subjektive Theorie und Unterlassen
3. Lehre von den Pflichtdelikten
4. Zwingende Annahme der Teilnahmestrafbarkeit
5. Funktionenlehre
6. Leitentscheidung
IX. Exkurs: Echte Unterlassungsdelikte. 1. Grundlagen
2. Leitentscheidungen
X. Zusammenfassung
XI. Übungsfälle
|316|8. Kapitel Fahrlässigkeit und Erfolgsqualifikation. I. Fahrlässiges Erfolgsdelikt. 1. Einführung und Prüfungsschema
|318|2. Erfolgseintritt und kausale Handlung
3. Objektive Fahrlässigkeit. a) Außerachtlassen der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt
b) Objektive Vorhersehbarkeit
|321|4. Objektive Zurechnung
a) Pflichtwidrigkeitszusammenhang
b) Schutzzweckzusammenhang
c) Eigenverantwortliche Selbstgefährdung und Pflichtverletzung Dritter
|323|5. Individuelle Fahrlässigkeit
6. Fahrlässige unechte Unterlassungsdelikte
7. Leichtfertige Deliktsbegehung
|325|8. Leitentscheidungen
II. Erfolgsqualifizierte Delikte. 1. Einführung und Prüfungsschema
2. Tatbestandsspezifischer Gefahrzusammenhang. a) Grundlagen
b) Tatbestandsspezifischer Gefahrzusammenhang bei § 227 Abs. 1 StGB
3. Erfolgsqualifikation und Versuch
a) Erfolgsqualifizierter Versuch. aa) Strafbarkeit des erfolgsqualifizierten Versuchs
bb) Rücktritt trotz Eintritt des qualifizierenden Erfolges?
b) Versuchte Erfolgsqualifikation
4. Teilnahme am erfolgsqualifizierten Delikt
5. Leitentscheidungen
III. Zusammenfassung
IV. Übungsfälle
|338|9. Kapitel Konkurrenzen. I. Grundlagen. 1. Einführung
2. Gesetzliche Regelungen und Grundbegriffe
II. Prüfungsreihenfolge
III. Handlungseinheit
|342|1. Handlung im natürlichen Sinne
2. Natürliche Handlungseinheit
|343|3. Tatbestandliche Handlungseinheit
4. Handlungseinheit durch Klammerwirkung
IV. Gesetzeskonkurrenz
1. Unechte Idealkonkurrenz
2. Unechte Realkonkurrenz
|346|V. Konkurrenzfragen in tatsächlichen Zweifelsfällen
1. In dubio pro reo
2. Wahlfeststellung
|349|3. Postpendenz und Präpendenz
4. Hinweise für die Fallbearbeitung
VI. Zusammenfassung
VII. Übungsfälle
|352|10. Kapitel Lösungen der Fälle. Antworten zu Kapitel 1. Zu Fall 1
Zu Fall 2
Antworten zu Kapitel 2. Zu Fall 1
Zu Fall 2
Antworten zu Kapitel 3. Zu Fall 1
Zu Fall 2
Zu Fall 3
Antworten zu Kapitel 4. Zu Fall 1
Zu Fall 2
Antworten zu Kapitel 5. Zu Fall 1
Zu Frage 2
Zu Frage 3
Zu Frage 4
Antworten zu Kapitel 6. Zu Frage 1
Zu Frage 2
Antworten zu Kapitel 7. Zu Fall 1
Zu Fall 2
|389|Antworten zu Kapitel 8. Zu Frage 1
|392|Zu Frage 2
Antworten zu Kapitel 9. Zu Fall 1
Zu Fall 2
|397|Stichwortverzeichnis
Fußnoten
Copyright / Impressum
Klaus Hoffmann-Holland
Strafrecht Allgemeiner Teil
.....
36BGHSt 39, 1, 6ff.; Zeitliche Anwendung des Strafgesetzes: Ein Grenzsoldat der DDR erschießt an der innerdeutschen Grenze vorsätzlich einen Grenzflüchtling. – Wird das Geschehen nach der Wiedervereinigung strafrechtlich verfolgt, so findet hierauf § 212 StGB über Art. 315 Abs. 1EGStGB i.V.m. § 2 StGB Anwendung. Zwar wäre nach § 2 Abs. 1 StGB grundsätzlich DDR-Strafrecht anwendbar, dies gilt jedoch nach § 2 Abs. 3 StGB dann nicht, wenn das bundesdeutsche Strafrecht eine mildere Rechtsfolge vorsieht, was |13|vorliegend aufgrund der in § 213 StGB enthaltenen (und im DDR-Strafrecht fehlenden) Milderungsmöglichkeit der Fall ist.
75BGHSt 46, 212, 220ff.; Erfolgsort bei abstrakt-konkreten Gefährungsdelikten: Ein australischer Staatsbürger stellt von Australien aus wiederholt Artikel ins Internet, in denen er den Holocaust leugnet. – Der BGH wendet deutsches Strafrecht nach § 3 i.V.m. § 9 StGB an. Der Eintritt des Erfolges im Sinne des § 9 StGB erfolge bei abstrakt-konkreten Gefährdungsdelikten dort, wo die Tat ihre Gefährlichkeit im Hinblick auf das im Tatbestand umschriebene Rechtsgut entfalten kann. Bei § 130 Abs. 1 und Abs. 3 StGB käme es insoweit auf die konkrete Eignung zur Friedensstörung in der BRD an, die bei Verbreitung der den Holocaust leugnenden Inhalte übers Internet zu bejahen sei.
.....