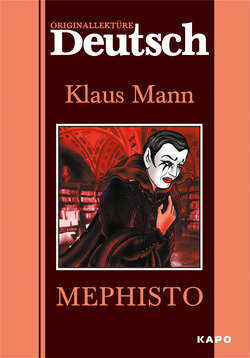Читать книгу Mephisto / Мефистофель. Книга для чтения на немецком языке - Клаус Манн - Страница 3
I
H. K
ОглавлениеIn den letzten Jahren des Weltkrieges und in den ersten Jahren nach der Novemberrevolution[14] hatte das literarische Theater in Deutschland eine große Konjunktur. Um diese Zeit erging es auch dem Direktor Oskar H. Kroge glänzend, den schwierigen Wirtschaftsverhältnissen zum Trotz. Er leitete eine Kammerspielbühne in Frankfurt am Main. In dem engen, stimmungsvoll intimen Kellerraum traf sich die intellektuelle Gesellschaft der Stadt und vor allem eine angeregte, von den Ereignissen aufgewühlte, diskussions- und beifallsfreudige Jugend, wenn es die Neuinszenierung eines Stückes von Wedekind[15] oder Strindberg[16] gab oder eine Uraufführung von Georg Kaiser[17], Sternheim[18], Fritz von Unruh[19], Hasenclever[20] oder Toller[21]. Oskar H. Kroge, der selbst Essays und hymnische ‘Gedichte’ schrieb, empfand das Theater als die moralische Anstalt: von der Schaubühne sollte eine neue Generation erzogen werden zu den Idealen, von denen man damals glaubte, dass die Stunde ihrer Erfüllung gekommen sei – zu den Idealen der Freiheit, der Gerechtigkeit, des Friedens. Oskar H. Kroge war pathetisch, zuversichtlich und naiv. Am Sonntagvormittag, vor der Aufführung eines Stückes von Tolstoi oder von Rabindranath Tagore[22], hielt er eine Ansprache an seine Gemeinde. Das Wort „Menschheit“ kam häufig vor; den jungen Leuten, die sich im Stehparkett drängten, rief er mit bewegter Stimme zu: „Habet den Mut zu euch selbst, meine Brüder!“ – und er erntete Beifallsstürme, da er mit den Schillerworten schloss: „Seid umschlungen, Millionen!“
Oskar H. Kroge war sehr beliebt und angesehen in Frankfurt am Main und überall dort im Lande, wo man an den kühnen Experimenten eines geistigen Theaters Anteil nahm. Sein ausdrucksvolles Gesicht mit der hohen, zerfurchten Stirn, der schütteren, grauen Haarmähne und den gutmütigen, gescheiten Augen hinter der Brille mit schmalen Goldrand war häufig zu sehen in den kleinen Revuen der Avantgarde; zuweilen sogar in den großen Illustrierten. Oskar H. Kroge gehörte zu den aktivsten und erfolgreichsten Vorkämpfern des dramatischen Expressionismus.
Es war ohne Frage ein Fehler von ihm gewesen – nur zu bald sollte es ihm klarwerden – sein stimmungsvolles kleines Haus in Frankfurt aufzugeben. Das Hamburger Künstlertheater, dessen Direktion man ihm im Jahre 1923 anbot, war freilich größer. Deshalb akzeptierte er. Das Hamburger Publikum aber erwies sich als längst nicht so zugänglich dem leidenschaftlichen und anspruchsvollen Experiment wie jener zugleich routinierte und enthusiastische Kreis, der den Frankfurter Kammerspielen treu gewesen war. Im Hamburger Künstlertheater musste Kroge, außer den Dingen, die ihm am Herzen lagen, immer noch den „Raub der Sabinerinnen“[23] und „Pension Schöller“[24] zeigen. Darunter litt er. Jeden Freitag, wenn der Spielplan für die kommende Woche festgesetzt wurde, gab es einen kleinen Kampf mit Herrn Schmilz, dem geschäftlichen Leiter des Hauses. Schmilz wollte die Possen und Reißer angesetzt haben, weil sie Zugstücke waren; Kroge aber bestand auf dem literarischen Repertoire. Meistens musste Schmilz, der übrigens eine herzliche Freundschaft und Bewunderung für Kroge hatte, nachgeben. Das Künstlertheater blieb literarisch – was seinen Einnahmen schädlich war.
Kroge klagte über die Indifferenz der Hamburger Jugend im besonderen und über die Ungeistigkeit einer Öffentlichkeit im allgemeinen, und Paul von Schönthan, in der es um ein Theaterstück geht, das Gymnasialprofessor Gollwitz als Student geschrieben hat – eine Jugendsünde, wie er es nennt. die sich allem Höheren entfremdet habe. „Wie schnell es gegangen ist!“ stellte er mit Bitterkeit fest. „Im Jahre 1919 lief man noch zu Strindberg und Wedekind; 1926 will man nur mehr Operetten.“ Oskar H. Kroge war anspruchsvoll und übrigens ohne prophetischen Geist. Hätte er sich beschwert über das Jahr 1926, wenn er sich hätte vorstellen können, wie das Jahr 1936 aussehen würde? – „Nichts Besseres zieht mehr“, grollte er noch. „Sogar bei den Webern[25] gestern ist das Haus halb leer gewesen.“
„Immerhin kommen wir doch zur Not noch auf unsere Rechnung.“ Direktor Schmilz bemühte sich, den Freund zu trösten: „Aber wie!“ Kroge wollte sich durchaus nicht trösten lassen. „Aber wie kommen wir denn auf unsere Rechnung! Berühmte Gäste aus Berlin müssen wir uns einladen – so wie heute abend —, damit die Hamburger ins Theater gehen.“
Hedda von Herzfeld – Kroges alle Mitarbeiterin und Freundin, die schon in Frankfurt Dramaturgin und Schauspielerin bei ihm gewesen war – bemerkte: „Du siehst wieder mal alles schwarz in schwarz, Oskar H.! Es ist ja schließlich keine Schande, Dora Martin gastieren zu lassen – sie ist wundervoll —, und übrigens kommen unsere Hamburger auch, wenn Höfgen spielt.“ Während sie Höfgens Namen aussprach, lächelte Frau von Herzfeld klug und zärtlich. Über ihr großes, matt gepudertes Gesicht mit der fleischigen Nase, den großen, goldbraunen, wehmütig intelligenten Augen ging ein bescheidenes Aufleuchten.
Kroge sagte brummig: „Höfgen wird überzahlt.“
„Die Martin übrigens auch“, fügte Schmilz hinzu. „Ihren ganzen Zauber in Ehren und zugegeben, dass sie ungeheuer zieht: aber tausend Mark Abendgage, das ist doch wohl ein bisschen toll.“
„Berliner Staransprüche“, machte Hedda spöttisch. Sie hatte in Berlin nie zu tun gehabt und behauptele, den Betrieb der Hauptstadt zu verachten.
„Tausend Mark im Monat für Höfgen ist auch übertrieben“, behauptete Kroge, plötzlich gereizt. „Seit wann hat er denn eigentlich tausend?“ fragte er herausfordernd Schmilz. „Es sind doch immer nur achthundert gewesen, und das war reichlich genug.“
„Was soll ich machen?“ Schmilz entschuldigte sich. „Er ist zu mir ins Büro gesprungen, und er hat sich mir auf den Schoß gesetzt.“ Frau von Herzfeld konnte mit Belustigung feststellen, dass Schmilz etwas rot wurde, während er dies erzählte. „Er hat mich am Kinn gekitzelt und hat immer wieder gesagt: ,Tausend Mark müssen es sein! Tausend, Direktorchen! Es ist eine so schöne runde Summe!’ Was sollte ich da machen, Kroge? Sagen Sie selbst!“
Es war Höfgens schlaue Gewohnheit, wie ein nervöser kleiner Sturmwind in Schmitzens Büro zu fahren, wenn er Vorschuss oder Gagenerhöhung wollte. Zu solchen Anlässen spielte er den übermütig Launischen und Kapriziösen, und er wusste, dass der ungeschickte dicke Schmilz verloren war, wenn er ihm die Haare zauste und den Zeigefinger munter in den Bauch stieß. Da es sich um die Tausend-Mark-Gage handelte, hatte er sich ihm sogar auf den Schoß gesetzt: Schmilz gestand es unter Erröten.
„Das sind Albernheiten!“ Kroge schüttelte ärgerlich das versorgte Haupt. „Überhaupt ist Höfgen ein grundalberner Mensch. Alles an ihm ist falsch, von seinem literarischen Geschmack bis zu seinem sogenannten Kommunismus. Er ist kein Künstler, sondern ein Komödiant.“
„Was hast du gegen unseren Hendrik?“ Frau von Herzfeld zwang sich zu einem ironischen Ton; in Wahrheit war ihr keineswegs nach Ironie zumute, wenn sie von Höfgen sprach, für dessen geübte Reize sie nur zu empfänglich war, „Er ist unser bestes Stück. Wir können froh sein, wenn wir ihn nicht an Berlin verlieren.“
„Ich bin gar nicht so besonders stolz auf ihn“, sagte Kroge. „Er ist doch nicht mehr als ein routinierter Provinzschauspieler, und das weiß er übrigens im Grunde selbst ganz genau.“
Schmilz fragte: „Wo steckt er denn heute abend?“ – worauf Frau von Herzfeld leise durch die Nase lachte: „Er hat sich in seiner Garderobe hinter einem Paravent versteckt – der kleine Bock hat es mir erzählt. Er ist immer furchtbar aufgeregt und eifersüchtig, wenn Berliner Gäste da sind. So weit wie die werde er es niemals bringen, sagt er dann – und versteckt sich hinter einem Paravent, vor lauter Hysterie. Die Martin bringt ihn wohl besonders aus der Fassung, das ist so eine Art von Hassliebe bei ihm. Heute abend soll er schon einen Weinkrampf gehabt haben.“
„Da seht ihr seinen Minderwertigkeitskomplex!“ rief Kroge und schaute triumphierend um sich. „Oder vielmehr: dass er im Grunde irgendwo die richtige Einschätzung hat für sich selber.“
Die drei saßen in der Theaterkantine, die, nach den Initialen des Hamburger Künstlertheaters, kurz „H. K.“ genannt wurde.
Drunten, im Theater, spielte Dora Martin, die mit ihrer heiseren Stimme, der verführerischen Magerkeit des ephebischen Körpers und den tragisch weiten, kindlichen und unergründlichen Augen das Publikum der großen deutschen Städte verhexte, einen Reißer zu Ende. Die beiden Direktoren und Frau von Herzfeld hatten nach dem zweiten Akt ihre Loge verlassen. Die übrigen Mitglieder des Künstlertheaters waren im Saal geblieben, um der Berliner Kollegin, die sie halb bewunderten und halb hassten, bis zum Schluss zuzusehen.
„Das Ensemble, das sie sich mitgebracht hat, ist ja wirklich unter jeder Kritik“, stellte Kroge verächtlich fest.
„Was wollen Sie?“ meinte Schmilz. „Wie soll sie jeden Abend ihre tausend Mark verdienen, wenn sie sich auch noch teure Leute mit auf die Reise nimmt?“
„Aber sie selber wird immer besser“, sagte die kluge Herzfeld. „Sie kann sich jede Manieriertheit leisten. Sie kann wie ein geisteskrankes Baby sprechen: Sie bezwingt.“
„Geisteskrankes Baby ist nicht schlecht“, lachte Kroge. „Man scheint unten fertig zu sein“, fügte er hinzu, mit einem Blick durchs Fenster. Die Leute kamen den gepflasterten Weg herauf, der vom Theater, an der Kantine vorbei, zu dem Tor führte, durch das man auf die Straße trat.
Nach und nach füllte sich die Kantine. Die Schauspieler grüßten mit einer respektvoll betonten Herzlichkeit den Direktorentisch und riefen dem Wirt, einem gedrungenen, kräftigen Greise mit weißem Knebelbart und blauroter Nase, kleine Scherze zu. Väterchen Hansemann, der Kantinenbesitzer, war für das Ensemble eine beinah ebenso bedeutungsvolle Persönlichkeit wie Schmilz, der geschäftliche Direktor. Von Schmilz konnte man Vorschuss bekommen, wenn er sich gerade in gnädiger Laune befand; bei Hansemann aber musste man anschreiben lassen, wenn in der zweiten Monatshälfte die Gage aufgebraucht und ein Vorschuss nicht genehmigt worden war. Alle standen bei ihm in der Kreide; man behauptete, dass Höfgen ihm mehr als hundert Mark schuldig war.
Alle sprachen über Dora Martin, jeder hatte seine eigene Ansicht über den Rang ihrer Leistung; nur darüber, dass sie entschieden zuviel Geld verdiente, waren alle sich einig.
Die Motz erklärte: „An dieser Starwirtschaft geht das deutsche Theater zugrunde“ – wozu ihr Freund Petersen grimmig nickte. Petersen war Väterspieler mit dem Ehrgeiz zum Heroischen; er bevorzugte Könige oder adlige alte Haudegen in historischen Stücken. Leider war er etwas zu klein und dick für diese Partien – was er auszugleichen suchte durch eine stramme und kampfeslustige Haltung. Zu seinem Gesicht, das den Ausdruck falscher Biederkeit zeigte, hätte ein grauer Schifferbart gepasst; da er fehlte, wirkte seine Miene ein wenig kahl, mit der langen, rasierten Oberlippe und den sehr blauen, ausdrucksvoll blitzenden, zu kleinen Augen. Die Motz liebte ihn mehr als er sie: das wussten alle. Da er genickt hatte, wandte sie sich nun direkt an ihn, um in einem intimen und bedeutungsvollen Ton zu sagen: „Nicht wahr, Petersen: über diese Misswirtschaft haben wir schon häufig miteinander gesprochen?“ Er bestätigte treuherzig: „Gewiss doch, Frau!“ und blinzelte Rahel Mohrenwitz zu, die aufgemacht war als das perverse und dämonische junge Mädchen: mit schwarzen Ponys bis zu den rasierten Augenbrauen und einem großen, schwarzgerandeten Monokel im Gesicht, das übrigens kindlich, pausbäckig und völlig ungeformt war.
„In Berlin wirken die Martinschen Mätzchen vielleicht“, sprach die Motz resolut. „Aber unsereinem kann sie nichts vormachen, wir sind schließlich lauter alte Theaterhasen.“ Sie blickte beifallheischend um sich. Ihr Fach war die komische Alte; zuweilen durfte sie auch reife Salon-damen spielen. Sie lachte gern, viel und laut, wobei sie scharfe Falten um den Mund bekam, in dessen Innerem Gold funkelte. Im Augenblick freilich zeigte sie eine würdevoll ernste, beinah zornige Miene.
Rahel Mohrenwitz sagte, wobei sie hochmütig mit ihrer langen Zigarettenspitze spielte: „Niemand kann schließlich leugnen, dass die Martin irgendwo eine enorm starke Persönlichkeit ist. Was sie auf der Bühne auch macht: immer ist sie unerhört intensiv da – ihr versteht, was ich meine…“ Alle verstanden es; die Motz aber schüttelte missbilligend den Kopf, während die kleine Angelika Siebert mit ihrem hohen, schüchternen Stimmchen erklärte: „Ich bewundere die Martin. Es geht eine zauberhafte Kraft von ihr aus, finde ich…“ Sie wurde sehr rot, weil sie einen so langen und gewagten Satz vorgebracht hatte. Alle sahen mit einer gewissen Rührung zu ihr hin. Die kleine Siebert war reizend. Ihr Köpfchen mit dem kurzgeschnittenen, links gescheitelten blonden Haar glich dem eines dreizehnjährigen Buben. Ihre hellen und unschuldigen Augen wurden dadurch nicht weniger anziehend, dass sie kurzsichtig waren: manche fanden, dass gerade die Art, auf die Angelika beim Schauen die Augen zusammenkniff, ihren besonderen Charme ausmache.
„Unsere Kleine schwärmt wieder einmal“, sagte der schöne Rolf Bonetti und lachte etwas zu laut. Er war jenes Mitglied des Ensembles, das die meisten Liebesbriefe aus dem Publikum erhielt: daher sein stolzer, müder, vor lauter Blasiertheit beinah angewiderter Gesichtsausdruck. Der kleinen Angelika gegenüber jedoch war er der Werbende: schon seit längerem bemühte er sich um sie. Auf der Bühne durfte er sie oft in den Armen halten, das brachte sein Rollenfach mit sich. Im übrigen aber blieb sie spröde. Mit einer wunderlichen Hartnäckigkeit verschenkte sie ihre Zärtlichkeit nur dorthin, wo nicht die mindeste Aussicht bestand, dass man sie erwiderte oder auch nur wünschte. Rührend und begehrenswert, wie sie war, schien sie ganz dafür gemacht, viel geliebt und sehr verwöhnt zu werden. Der sonderbare Eigensinn ihres Herzens aber ließ sie kühl und spöttisch bleiben vor Rolf Bonettis stürmischen Beteuerungen, und ließ sie bitterlich weinen über die eisige Geringschätzung, die Hendrik Höfgen ihr gegenüber an den Tag legte.
Rolf Bonetti sagte kennerhaft: „Als Frau kommt diese Martin jedenfalls gar nicht in Frage: ein unheimlicher Zwitter – sicher hat sie so etwas wie Fischblut in den Adern.“
„Ich finde sie schön“, sagte Angelika, leise aber entschlossen. „Sie ist die schönste Frau, finde ich.“ Schon standen ihr die Augen voll Tränen: Angelika weinte häufig, auch ohne besonderen Anlass. Träumerisch sagte sie noch: „Es ist merkwürdig – ich spüre irgendeine geheimnisvolle Ähnlichkeit zwischen Dora Martin und Hendrik…“ Dies erregte allgemeine Verwunderung.
„Die Martin ist eine Jüdin.“ Es war der junge Hans Miklas, der sich unvermittelt so vernehmen ließ. Alle schauten betroffen und etwas angewidert zu ihm hin. – „Der Miklas ist köstlich“, sprach die Motz in ein betretenes Schweigen hinein und versuchte zu lachen. Kruge runzelte die Stirne, verwundert und degoutiert, während Frau von Herzfeld nur den Kopf schütteln konnte; übrigens war sie blass geworden. Da die Pause lang und peinlich wurde – der junge Miklas stand bleich und trotzig an die Theke gelehnt —, sagte Direktor Kruge schließlich ziemlich scharf: „Was soll denn das?“ und machte ein Gesicht, so böse, wie es ihm eben möglich war. Ein anderer junger Schauspieler, der sich bis dahin leise mit Vater Hansemann unterhalten hatte, sagte forsch und versöhnlich: „Hoppla, das ist danebengegangen! Lass nur, Miklas, so was kann vorkommen, du bist sonst ein ganz braves Kind!“ Dabei klopfte er dem Übeltäter auf die Schulter und lachte so herzlich, dass alle einstimmen konnten; sogar Kroge entschloss sich zu einer Heiterkeit, die freilich krampfhaften Charakter hatte: er schlug sich, mit der flachen Hand auf den Schenkel und warf den Oberkörper nach vorne, so heftig schien er sich plötzlich zu amüsieren. Miklas aber blieb ernst; er drehte das verstockte, bleiche Gesicht zur Seite, die Lippen böse aufeinandergepresst. „Sie ist doch eine Jüdin.“ Er sprach so leise, dass fast niemand es hören konnte; nur Otto Ulrichs, der gerade erst durch seine Unbefangenheit die Situation gerettet hatte, hörte es, und nun strafte er ihn mit einem ernsten Blick.
Nachdem Direktor Kroge durch sein Gelächter ausführlich bekundet hatte, dass er die Entgleisung des jungen Miklas durchaus von der komischen Seite nahm, winkte er Ulrichs. „Ach, Ulrichs, kommen Sie doch bitte mal einen Augenblick!“ Ulrichs setzte sich an den Tisch zu den Direktoren und Frau von Herzfeld.
„Ich will mich nicht in Ihre Angelegenheiten mischen, wirklich nicht.“ Kroge ließ es sich anmerken, dass die Sache ihm äußerst peinlich war. „Aber es kommt jetzt immer häufiger vor, dass Sie in kommunistischen Versammlungen auftreten. Gestern haben Sie schon wieder irgendwo mitgemacht. Das schadet Ihnen doch, Ulrichs, und uns schadet es auch.“ Kroge sprach leise. „Sie wissen doch, wie die bürgerlichen Zeitungen sind, Ulrichs“, sagte er eindringlich. „Suspekt sind wir den Leviten[26] ohnedies. Wenn eines unserer Mitglieder sich nun politisch exponiert – es kann verhängnisvoll für uns sein, Ulrichs.“ Kroge trank sehr hastig seinen Kognak aus, er war sogar etwas rot geworden.
Ulrichs antwortete ruhig; „Es ist mir sehr erwünscht, Herr Direktor, dass Sie von diesen Dingen zu mir sprechen. Natürlich habe ich auch schon über sie nachgedacht. Vielleicht ist es besser, wir trennen uns, Herr Direktor – glauben Sie mir, dass es mir nicht leichtfällt, diesen Vorschlag zu machen. Aber auf meine politische Betätigung kann ich nicht verzichten. Ihr müsste ich sogar mein Engagement opfern, und das wäre ein Opfer; denn ich bin gerne hier.“ Er sprach mit einer angenehmen, dunklen und warmen Stimme. Während er redete, schaute Kroge mit einer väterlichen Sympathie auf sein intelligentes, kraftvolles Gesicht. Otto Ulrichs war ein gut aussehender Mann. Seine hohe, freundliche Stirn, von der das schwarze Haar weit zurückwich, und die engen, dunkelbraunen, gescheiten und lustigen Augen flößten Vertrauen ein. Kroge mochte ihn sehr. Deshalb wurde er jetzt beinahe zornig.
„Aber Ulrichs!“ rief er aus. „Davon kann doch gar keine Rede sein. Sie wissen ganz genau, dass ich Sie niemals fortlassen würde!“
„Wir können Sie gar nicht entbehren!“ fügte Schmilz hinzu – der dicke Mensch überraschte zuweilen durch eine merkwürdig vibrierende, helle und hübsche Stimme —; wozu die Herzfeld ernst bestätigend nickte.
„Es ist doch nur ein klein bisschen Zurückhaltung, worum ich Sie bitte“, versicherte Kroge.
Ulrichs sagte mit Herzlichkeit: „Ihr seid alle sehr nett zu mir – wirklich sehr nett – und ich werde mir Mühe geben, dass ich euch nicht gar zu sehr kompromittiere.“ Die Herzfeld lächelte ihm vertraulich zu. „Es ist Ihnen ja wohl nicht ganz unbekannt“, sagte sie leise, „dass wir politisch weitgehend mit Ihnen sympathisieren.“ – Der Mann, mit dem sie in Frankfurt verheiratet gewesen war und dessen Namen sie führte, war Kommunist. Er war viel jünger als sie und hatte sie verlassen. Zur Zeit arbeitete er in Moskau als Filmregisseur.
„Weitgehend!“ betonte Kroge mit lehrhaft erhobenem Zeigefinger. „Wenngleich nicht ganz, nicht in allen Stücken. Nicht alle unsere Träume haben sich in Moskau erfüllt. Können die Träume, die Forderungen, die Hoffnungen der Geistigen sich erfüllen unter der Diktatur?“
Ulrichs antwortete ernst, wobei seine engen Augen noch schmaler wurden und einen beinahe drohenden Blick bekamen: „Nicht nur die Geistigen – oder die, welche sich so nennen – haben ihre Hoffnungen und Forderungen. Noch dringlicher sind die Forderungen des Proletariats. Diese waren, so wie die Welt heute ist, nur zu erfüllen mittels der Diktatur.“ Hier zeigte Direktor Schmilz ein bestürztes Gesicht. Ulrichs, um dem Gespräch eine leichtere Wendung zu geben, sagte lächelnd: „Übrigens wäre auf der Versammlung gestern das Künstlertheater beinah durch sein prominentestes Mitglied repräsentiert worden. Hendrik wollte eigentlich auftreten – im letzten Augenblick ist er dann leider verhindert gewesen.“
„Höfgen wird immer im letzten Augenblick verhindert sein, wenn es sich um Angelegenheiten handelt, die bedenklich für seine Karriere werden könnten.“ Kroge hatte verächtlich den Mund verzogen, während er dies sagte. Hedda von Herzfeld sah ihn flehend und kummervoll an. Als aber Otto Ulrichs mit Überzeugung äußerte: „Hendrik gehört zu uns“, wiederholte Ulrichs. „Und er wird das durch die Tat beweisen. Seine Tat wird das Revolutionäre Theater sein. In diesem Monat soll es eröffnet werden.“
„Noch ist es nicht eröffnet.“ Kroge lächelte boshaft. „Zunächst ist nur das Briefpapier da, mit der schönen Überschrift ‘Revolutionäres Theater’. Nehmen wir aber sogar einmal an, es kommt zur Eröffnung: Glauben Sie, Höfgen wird sich heraustrauen mit einem wirklich revolutionären Stück?“
Ziemlich heftig erwiderte Ulrichs: „In der Tat glaube ich das! Übrigens ist das Stück ja schon ausgesucht – man kann wohl sagen, dass es ein revolutionäres ist.“
Kroge machte, mit der Miene und Gebärde eines müden und verächtlichen Zweifels: „Wir werden ja sehen.“ Hedda von Herzfeld, die bemerkte, dass Ulrichs rot wurde vor Ärger, fand es geraten, nunmehr das Thema zu wechseln.
„Was war das eigentlich vorhin für eine fantastische kleine Äußerung von diesem Miklas? Stimmt es also doch, dass der Bursche Antisemit ist und mit den Nationalsozialisten zu tun hat?“ Bei dem Wort „Nationalsozialisten“ verzerrte sich ihr Gesicht vor Ekel, als hätte sie eine tote Ratte berührt. Schmilz lachte verächtlich, während Kroge sagte: „So einen können wir gerade gebrauchen!“ Ulrichs versicherte sich durch einen Seitenblick, dass Miklas ihnen nicht zuhörte, ehe er mit gedämpfter Stimme erklärte:
„Hans ist im Grunde ein guter Kerl – ich weiß das, denn ich habe mich oft mit ihm unterhalten. Mit so einem Jungen muss man sich viel und nachsichtig beschäftigen – dann gewinnt man ihn vielleicht noch für die gute Sache. Ich glaube nicht, dass er für uns schon ganz verloren ist. Seine Aufsässigkeit, seine allgemeine Unzufriedenheit sind falsch gelandet – verstehen Sie, was ich meine?“ Frau Hedda nickte; Ulrichs flüsterte eifrig: „In so einem jungen Kopf ist alles wirr, alles ungeklärt – es laufen ja heute Millionen herum wie dieser Miklas. Bei denen gibt es vor allem einen Hass, und der ist gut, denn er gilt dem Bestehenden. Aber dann hat so ein Bursche Pech und fällt den Verführern in die Hände, und die verderben seinen guten Hass. Sie erzählen ihm, an allem Übel seien die Juden schuld, und der Vertrag von Versailles[27], und er glaubt den Dreck und vergisst, wer eigentlich die Schuldigen sind, hier und überall. Das ist das berühmte Ablenkungsmanöver, und bei all diesen jungen Wirrköpfen, die nichts wissen und nicht richtig nachdenken können, hat es Erfolg. Da sitzt dann so ein Häufchen Unglück und lässt sich Nationalsozialist schimpfen!“
Sie schauten alle vier zu Hans Miklas hin, der an einem kleinen Tisch in der entferntesten Ecke des Raumes, bei der dicken alten Souffleuse, Frau Efeu, bei Willi Bock, dem kleinen Garderobier, und bei dem Bühnenportier, Herrn Knurr, Platz genommen hatte. Von Herrn Knurr wurde behauptet, dass er ein Hakenkreuz unter dem Rockaufschlag versteckt trage und dass seine Privatwohnung voll sei von den Bildern des nationalsozialistischen „Führers“, die er in der Portiersloge denn doch nicht aufzuhängen wagte. Herr Knurr hatte heftige Diskussionen und Streitigkeiten mit den kommunistischen Bühnenarbeitern, die ihrerseits nicht im H. K. verkehrten, sondern ihren eigenen Stammtisch in einer Kneipe gegenüber hatten – wo sie zuweilen von Ulrichs besucht wurden. Höfgen wagte sich beinah nie an den Stammtisch der Arbeiter; er fürchtete, die Männer würden über sein Monokel lachen. Andererseits pflegte er zu klagen, das H. K. sei ihm durch die Anwesenheit des nationalistischen Herrn Knurr ganz verleidet. „Dieser verfluchte Kleinbürger“, sagte Höfgen von ihm, „der auf seinen Führer und Erlöser wartet wie die Jungfer auf den Kerl, der sie schwängern soll! Mir wird immer heiß und kalt, wenn ich an der Portiersloge vorbeigehen muss und an das Hakenkreuz unter seinem Rockaufschlag denke…“
„Natürlich hat er eine ekelhafte Kindheit gehabt“, sagte Otto Ulrichs, der noch bei Hans Miklas war. „Er hat mir einmal davon erzählt. Aufgewachsen ist er in irgend so einem finsteren niederbayrischen Nest. Der Vater ist im Weltkrieg gefallen, die Mutter scheint eine aufgeregte, unvernünftige Person zu sein; machte den verrücktesten Krach, als der Junge zum Theater gehen wollte – man kann sich das ja alles vorstellen. Er ist ehrgeizig, fleißig, auch begabt; er hat enorm viel gelernt, mehr als die meisten von uns. Ursprünglich wollte er Musiker werden, er hat den Kontrapunkt gelernt, und er kann Klavier spielen, und er kann Akrobatik und Steptanzen und Ziehharmonika und überhaupt alles. Er arbeitet den ganzen Tag, dabei ist er wahrscheinlich krank, sein Husten klingt scheußlich. Natürlich findet er, dass er zurückgesetzt wird und nicht genügend Erfolg hat, und schlechte Rollen. Er glaubt, wir sind verschworen gegen ihn, von wegen seiner so-genannten politischen Gesinnung.“ Ulrichs schaute noch immer, aufmerksam und ernst, zum jungen Miklas hinüber. „95 Mark Monatsgehalt“, sagte er plötzlich und blickte drohend auf Direktor Schmilz, der sofort unruhig auf seinem Stuhl zu rücken begann, „es ist schwer, dabei ein anständiger Mensch zu bleiben.“ Nun schaute auch die Herzfeld aufmerksam zu Miklas hinüber.
Zum Garderobier Bock, zur Souffleuse Efeu und Herrn Knurr pflegte Hans Miklas sich stets dann zu setzen, wenn er sich recht niederträchtig benachteiligt fand von der Direktion des Künstlertheaters, die er vor seinen politischen Freunden als „verjudet“ und „marxistisch“ bezeichnete. Vor allem hasste er Höfgen, diesen „ekelhaften Salonkommunisten“. Höfgen war, wenn man Miklas glauben durfte, eifersüchtig und eitel; Höfgen war größenwahnsinnig und wollte alles spielen, besonders aber spielte er ihm, Miklas, die Rollen weg. „Es ist eine Gemeinheit, dass er mir den Moritz Stiefel nicht gelassen hat“, äußerte der Verbitterte. Miklas schaute zornig auf seine eigenen Beine, die mager und sehnig waren.
Garderobier Bock, ein dummer Bursche mit wässrigen Augen und sehr blonden, sehr harten Haaren, die er kurz geschoren wie eine Bürste trug, kicherte über seinem Bierglas: niemand wusste, ob über Hendrik Höfgen, der als Gymnasiast komisch aussehen würde, oder über den machtlosen Zorn des jungen Hans Miklas. Die Souffleuse Efeu hingegen zeigte Entrüstung; sie bestätigte Miklas, dass es eine Gemeinheit sei. Das mütterliche Interesse, das die dicke alte Person an dem jungen Menschen nahm, brachte für diesen praktische Vorteile mit sich. Übrigens sympathisierte sie auch politisch mit ihm. Sie stopfte ihm seine Socken, lud ihn zum Abendessen ein; schenkte ihm Wurst, Schinken und Eingemachtes. „Damit du dicker wirst, Junge“, sagte sie und schaute ihn zärtlich an. Dabei gefiel ihr gerade die Magerkeit seines trainierten, nicht sehr großen, elastischen, schmalen Körpers. Wenn sein dichtes dunkelblondes Haar am Hinterkopf gar zu widerspenstig in die Höhe stand, sagte die Efeu: „Du siehst aus wie ein Gassenjunge!“ und holte einen Kamm aus dem Beutel.
Wie ein Gassenjunge sah Hans Miklas wirklich aus, freilich wie einer, dem es nicht besonders gut geht und der seine Angegriffenheit trotzig bezwingt. Sein Leben war anstrengend; er trainierte den ganzen Tag, mutete seinem schmalen Körper vieles zu, wahrscheinlich kamen daher seine Reizbarkeit und der finster abweisende Ausdruck seines jungen Gesichtes. Dieses Gesicht hatte üble Farben; unter den starken Backenknochen gab es schwarze Löcher, so eingefallen waren die Wangen. Um die hellen Augen waren die Ränder auch beinah schwarz. Hingegen war die reine, kindliche Stirne wie beschienen von einer bleichen und empfindlichen Helligkeit; auch der Mund leuchtete, aber auf ungesunde Art, viel zu rot; in den abweisend vorgeschobenen Lippen schien sich alles Blut zu sammeln, von dem das Gesicht sonst leer war. Unter den starken und verführerischen Lippen, von denen die Souffleuse Efeu oft den Blick nicht lassen konnte, enttäuschte das zu kurze, schwächlich abfallende Kinn.
„Heute früh, auf der Probe, hast du wieder ganz zum Fürchten ausgesehen“, sprach die Efeu besorgt. „So schwarze, tiefe Löcher in den Backen! Und der Husten! Dumpf hat der geklungen – zum Erbarmen!“
Miklas konnte es nicht ausstehen, wenn man ihn bemitleidete; nur die Gaben, in die solches Mitleid sich umsetzte, nahm er gerne, wenngleich wortkarg entgegen. Das klagende Gerede der Efeu überhörte er einfach. Hingegen wollte er von Bock wissen: „Stimmt es, dass der Höfgen sich heute den ganzen Abend in seiner Garderobe hinter dem Paravent versteckt hat?“
Bock konnte es nicht in Abrede stellen. Miklas fand Höfgens Betragen derartig albern, dass es ihn geradezu in Heiterkeit versetzte, „Ich sage doch, ein kompletter Narr!“ Dabei lachte er triumphierend. „Und das alles wegen einer Jüdin, der der Kopf bis dahin zwischen den Schultern steckt!“ Er machte sich bucklig, um anzudeuten, wie die Martin aussehe: die Efeu amüsierte sich herzlich. „Und so etwas will ein Star sein!“ Mit seinem höhnischen Ausruf konnte er ebensowohl die Martin meinen wie Höfgen. Beide gehörten, nach seinem Urteil, in dieselbe bevorzugte, undeutsche, tief verwerfliche Clique. „Die Martin!“ redete er weiter, das böse, leidende, reizvolle junge Gesicht in die mageren, nicht ganz sauberen Hände gestützt. „Sie soll ja auch immer diese salonkommunistischen Phrasen dreschen, mit ihren tausend Mark jeden Abend. Eine Bande ist das! Aber es wird aufgeräumt werden mit denen – der Höfgen wird auch noch dran glauben müssen!“
Das enge Lokal war voll Rauch. „Die Luft ist ja dick zum Schneiden“, klagte die Motz. „Das hält doch der stärkste Mann nicht aus. Und meine Stimme! Kinder, morgen könnt ihr mich wieder beim Halsarzt sitzen sehen.“ Niemand hatte Lust, sie sitzen zu sehen. Rahel Mohrenwitz machte sogar ironisch: „Huch, unsere Koloratursängerin!“ – wofür sie einen fürchterlichen Blick von der Motz bekam, die sowieso etwas gegen Rahel hatte: Petersen wusste, warum. Erst gestern wieder hatte man ihn in der Garderobe des dämonischen Mädchens gefunden, und die Motz hatte weinen müssen. Heute aber schien sie entschlossen, sich keinesfalls die Stimmung verderben zu lassen von einer dummen Gans, die sich vielleicht auf ihr Monokel und ihre lächerliche Frisur noch was einbildete. Vielmehr faltete sie die Hände vor dem Bauch und markierte gemütliche Stimmung. „Aber nett ist es hier“, sagte sie herzlich. „Was, Vater Hansemann?“ Sie blinzelte dem Wirt zu, dem sie noch 27 Mark schuldete und der deshalb nicht zurückblinzelte. Gleich danach entsetzte sie sich, weil Petersen sich ein Beefsteak servieren ließ, noch dazu mit Spiegelei. „Als ob ein Paar Würstchen nicht genügt hätten!“ Ihr standen Tränen des Zorns in den Augen. Zwischen Motz und Petersen gab es viel Streit und Hader, weil der Väterspieler, nach dem Dafürhalten seiner Freundin, zur Verschwendungssucht neigte. Immer bestellte er sich teure Sachen, und die Trinkgelder, die er spendierte, waren auch zu hoch. „Natürlich: Steak mit Ei muss es sein!“ jammerte die Motz. Petersen murmelte, dass ein Mann sich doch anständig ernähren müsse. Die Motz aber, ganz außer Fassung, fragte plötzlich mit zornigem Sarkasmus die Mohrenwitz, ob Petersen ihr vielleicht eine Flasche Sekt angeboten habe. „Veuve Cliquot, extrafein!“ schrie die Motz und sprach, bei aller Gehässigkeit, den Namen der Sektmarke mit jener Delikatesse aus, welche sie als Salondame legitimierte. Hierüber war die Mohrenwitz nun ernsthaft beleidigt. „Ich muss doch sehr bitten!“ rief sie schrill. „Soll das ein Witz sein?!“ Das Monokel fiel ihr aus dem Auge, ihr pausbäckiges, vor Ärger rot gewordenes Gesicht sah plötzlich gar nicht mehr dämonisch aus. Kroge blickte schon verwundert auf; Frau von Herzfeld lächelte ironisch. Der schöne Bonetti aber klopfte der Motz auf die Schulter; gleichzeitig auch der Mohrenwitz, die kampfeslustig näher getreten war. „Zankt euch nicht, Kinder!“ riet er ihnen, um den Mund besonders müde und angewiderte Falten. „Dabei kommt doch nichts raus. Spielen wir lieber Karten.“
In diesem Augenblick wurden gedämpfte Rufe laut, und alles drehte sich der Türe zu, die sich geöffnet hatte. Dora Martin stand auf der Schwelle. Hinter ihr drängte sich, wie auf der Bühne das Gefolge hinter der Königin, das Ensemble, mit dem sie reiste.
Dora Martin lachte und winkte allen Mitgliedern des Hamburger Künstlertheaters zu; dabei rief sie mit ihrer heiteren Stimme, auf jene berühmte Alt, die von tausend jungen Schauspielerinnen im ganzen Lande kopiert wurde, in jedem Satz einige Worte zerdehnend: „Kinder, wir sind eingeladen, ein ganz langweiliges Bankett, furchtbar schade, aber wir müssen hingehen!“ Sie schien ihre eigene Sprechweise parodieren zu wollen, so eigenwillig verfuhr sie mit der Länge der Silben. Aber allen klang es lieblich in den Ohren, auch denen, welche die Martin nicht leiden konnten, zum Beispiel dem jungen Miklas. Es war nicht zu leugnen: Ihr Auftritt hatte großen Effekt gemacht.
Da geschah es, dass jemand hinter ihr sich durchs Gefolge drängte. Es war Hendrik Höfgen, der unvermittelt hervorkam. Er hatte den Smoking an, den er in mondänen Rollen auf der Bühne trug und der, aus der Nähe betrachtet, schon recht abgetragen und fleckig wirkte. Über den Schultern lag ihm ein weißes Seidentuch. Sein Atem flog; Wangen und Stirne waren hektisch gerötet. Einen recht beunruhigenden Eindruck machte das nervöse Lachen, das ihn schüttelte, während er sich in gehetzter Eile, umflattert vom Seidentuch, tief über die Hand der Diva bückte, und das nicht ohne eine gewisse irrsinnige Herzlichkeit schien. „Entschuldigen Sie“, brachte er hervor. „Es ist ja fantastisch: ich bin viel zu spät – was müssen Sie von mir denken – eine fantastische Sache…“ Das Lachen beutelte ihn, sein Gesicht wurde immer röter. „Aber ich wollte Sie doch nicht gehen lassen“, dabei richtete er sich endlich auf, „ohne Ihnen gesagt zu haben, wie sehr ich diesen Abend genossen habe – wie wunderschön es gewesen ist!“ Plötzlich schien die ungeheuer komische Angelegenheit, über die er fast zersprungen war vor Lachen, nicht mehr zu existieren; er zeigte nun ein ganz ernstes Gesicht.
Dafür war es jetzt an Dora Martin, ein wenig zu lachen, und das tat sie denn auch, besonders heiser und zauberhaft.
„Schwindler!“ rief sie, und von dem eigensinnig gedehnten „i“ kam sie gar nicht mehr weg. „Sie sind gar nicht im Theater gewesen! Sie haben sich ja versteckt!“ Dabei schlug sie ihn leicht mit dem gelben, schweinsledernen Handschuh. „Aber das macht nichts“, strahlte sie ihn an. „Sie sollen ja so begabt sein.“
Über diese Feststellung, die überraschend kam, erschrak Höfgen zunächst so stark, dass die helle Röte von seinem Gesicht wich, welches fahl wurde. Dann aber sagte er, mit einer Stimme, die schmelzend klang: „Ich? Begabt? Das ist doch ein ganz unbewiesenes Gerücht…“
Die Vokale konnte auch er zerdehnen, nicht nur Dora Martin brachte dies fertig. Seine Sprachkoketterie hatte eigenen Stil, er war keineswegs darauf angewiesen, irgend jemanden zu kopieren. Dora Martin girrte; er aber sang vor Manieriertheit. Dabei zeigte er jenes Lächeln, das er auf den Proben den Damen vorzumachen pflegte, wenn sie verfängliche Szenen zu spielen hatten: Es entblößte die Zähne und war ziemlich gemein. Er bezeichnete es als das „aasige“ Lächeln. („Aasiger – verstehst du, meine Liebe? —, aasiger!“ mahnte er auf den Proben Rahel Mohrenwitz oder Angelika Siebert, und er machte es vor.)
Ihre Zähne zeigte auch Dora Martin; er während der Mund „babytalk“ sprach und der Kopf kokett zwischen den hochgezogenen Schultern steckte, forschten ihre großen, klugen, unbetrügbaren und traurigen Augen in Höfgens Gesicht. „Sie werden es schon noch beweisen, Ihr Talent!“ sagte sie leise, und eine Sekunde lang war nicht nur ihr Blick ernst, sondern auch ihr Gesicht. Ernsten Gesichtes, beinah drohend, nickte sie ihm zu. Höfgen, der sich noch vor einer Viertelstunde hinterm Paravent versteckt hatte, hielt ihren Blick aus. Dann lachte die Martin wieder; girrte: „Wir sind viel zu spät!“; winkte und entschwand mit Gefolge. Höfgen war in die Kantine getreten.
Die Begegnung mit Dora Martin hatte ihn auf wunderbare Art aufgeheitert; er schien jetzt in einer geradezu festlichen Laune zu sein. Von seinem Antlitz kam ein gnädiger Glanz. Alle schauten auf ihn, nun beinah ebenso bezwungen, wie sie vorhin auf die Berliner Diva geschaut hatten. – Ehe Höfgen Direktor Kroge und Frau von Herzfeld begrüßte, war er zu Garderobier Bock getreten. „Hör mal, mein Böckchen“, sang er und stand verführerisch da: Hände in die Hosentaschen vergraben, Schultern hochgezogen, und auf den Lippen das aasige Lächeln. „Du musst mir mindestens sieben Mark fünfzig leihen. Ich will anständig zu Abend essen, und ich habe so ein Gefühl: Väterchen Hansemann verlangt heute Barbezahlung.“ Aus den schillernden Edelsteinaugen warf er einen misstrauisch schiefen Blick auf Hansemann, der mit blauroter Nase unbewegt hinter der Theke saß. Bock war aufgesprungen; aus Schreck über Höfgens einerseits ehrenvolles, andererseits grausiges Ansinnen waren seine Augen noch wässriger, seine Wangen dunkelrot geworden. Während er stumm erregt in den Taschen wühlte und Hans Miklas mit gehässig gespanntem Blick den ganzen Vorfall beobachtete, war die kleine Angelika eilig hinzugetreten. „Aber Hendrik!“ sagte sie schnell und schüchtern. „Wenn du Geld brauchst – ich kann dir doch fünfzig Mark bis zum Ersten leihen!“ Sofort bekam Höfgen fischig kalte Augen. Er sagte hochmütig über die Schulter: „Mische dich nicht in unsere Männergeschäfte, meine Kleine. Bock gibt gerne.“ Der Garderobier nickte aufgeregt, während sich die Siebert mit nassen Augen zurückzog. Höfgen ließ, ohne sich zu bedanken, Bocks Silbermünzen nachlässig in seine Tasche gleiten. Miklas, Knurr und die Efeu schauten finster, Bock fassungslos und Angelika weinend hinter ihm drein, während er wiegenden Ganges, immer noch das weiße Seidentuch über den Schultern, das Lokal durchschritt. „Väterchen Schmilz lässt mich nämlich verhungern“, erklärte er, das sieghaft lächelnde Gesicht dem Direktorentisch zugewandt.
Dort wurde er mit einigem Hallo empfangen; sogar Kroge zwang sich zu einer etwas lärmenden und nicht ganz echten Herzlichkeit. „Na, alter Sünder, wie geht’s? Haben Sie den Abend gut überstanden?“ Er bekam scharfe Falten um den Katermund, fast wie die Motz, und falsche Augen hinter den Brillengläsern; plötzlich war ihm anzumerken, dass er nicht nur kulturpolitische Essays und hymnische Lyrik schrieb, sondern seit über dreißig Jahren mit dem Theater zu tun hatte. – Höfgen und Otto Ulrichs schüttelten sich vertraut, stumm und ausführlich die Hände. Direktor Schmilz sagte etwas belanglos Scherzhaftes, mit seiner überraschend weichen, angenehmen Stimme; Frau von Herzfeld aber lächelte grundlos ironisch, wobei ihre goldbraunen Augen, feucht vor Innigkeit und fast flehend, auf Hendrik gerichtet waren. Er ließ sich von ihr bei der Auswahl seines Abendessens beraten, was ihr Anlass gab, an ihn heranzurücken und ihren schweratmenden Busen in seine Nähe zu bringen. Sein aasiges Lächeln schien sie nicht abzuschrecken: Sie war es gewohnt, und es gefiel ihr.
Als Väterchen Hansemann die Bestellung entgegengenommen hatte, fing Höfgen an, von seiner „Frühlings Erwachen“[28] – Inszenierung zu sprechen. „Es wird anständig werden, glaube ich“, sagte er ernst; dabei glitten seine prüfenden Augen durch das Lokal, über die Schauspieler hin, wie die Augen eines Feldherrn über Truppen. „An der Wendla kann die Siebert nichts verderben; Bonetti ist kein idealer Melchior Gabor, aber er schafft es; unsere dämonische Mohrenwitz legt eine erstklassige Ilse hin.“ – Es geschah nicht sehr häufig, dass er ohne Mätzchen redete, sondern ernsthaft und um der Sache willen wie eben jetzt. Kroge lauschte ihm achtungsvoll, nicht ohne Überraschung. Es war die Herzfeld, welche die Stimmung wieder verdarb, indem sie sarkastisch-schmeichlerisch, ihr großes, flaumiggepudertes Gesicht ziemlich nahe bei Höfgen, bemerkte: „Nun, und was den Moritz Stiefel betrifft – da wurde ja gerade von berufenster Seite, von Dora selber, festgestellt, dass der junge Schauspieler, dem wir diese Rolle anvertraut haben, nicht ganz unbegabt ist…“ Kroge runzelte missbilligend die Stirne; Höfgen seinerseits schien die Neckerei zu überhören. „Und wie werden Sie eigentlich als Frau Gabor, meine Teure?“ fragte er die Herzfeld ins Gesicht. Dies war offener und derber Hohn. Dass Frau Hedda eine unbegabte Schauspielerin war, gehörte zu den bekannten Tatsachen; auch wusste jeder, dass sie darunter litt. Man spottete gern darüber, dass die kluge Dame es nicht lassen konnte, aufzutreten, und sei es auch nur in bescheidenen Mütterrollen. Auf Hendriks Ungezogenheit hin versuchte sie, gleichgültig die Achseln zu zucken; dabei aber zog eine ins Violette spielende Röte über die große Fläche ihres unjungen Gesichts. Kroge sah es, und sein Herz zog sich zusammen in einem Mitleid, das nicht weit von Zärtlichkeit war. Kroge hatte vor vielen Jahren ein Verhältnis mit Frau von Herzfeld gehabt.
Um das Thema zu wechseln oder um auf das einzige Thema zu kommen, das ihn wirklich beschäftigte, begann Ulrichs ohne Übergang vom Revolutionären Theater zu sprechen.
Das Revolutionäre Theater war geplant als eine Serie von Sonntag-Vormittag-Veranstaltungen, die unter der Leitung Hendrik Höfgens und dem Protektorat einer kommunistischen Organisation stehen sollten. Ulrichs, für den die Bühne zunächst und vor allem ein politisches Instrument bedeutete, hing mit zäher Leidenschaft an diesem Projekt. Das Stück, das man für die Eröffnungsvorstellung ausgesucht habe, eigne sich glänzend, sagte er nun, er habe es noch einmal genau durchgearbeitet. „Man interessiert sich in der Partei sehr ernsthaft für unsere Sache“, erklärte er und schaute mit einem bedeutungsvollen Verschwörerblick auf Höfgen, an Kroge, Schmilz und der Herzfeld vorbei, aber doch stolz darauf, dass sie es hörten und dass es sie beeindrucken würde. – „Nun, die Partei wird mir keinen Schadenersatz zahlen, wenn die guten Hamburger mir dann mein Haus boykottieren“, brummte Kroge, den der Gedanke an das Revolutionäre Theater immer skeptisch und verdrießlich stimmte. „Ja“, sagte er noch, „1918 – da konnte man sich solche Experimente leisten. Aber heute…“ Höfgen und Ulrichs tauschten einen Blick, der ein hochmütiges und geheimes Einverständnis enthielt und viel Geringschätzung für die kleinbürgerlichen Bedenken ihres Direktors. Der Blick dauerte ziemlich lange, Frau von Herzfeld bemerkte ihn und litt. Schließlich wendete sich Höfgen, etwas väterlich herablassend, an Kroge und Schmilz. „Das Revolutionäre Theater wird uns nicht schaden – sicher nicht – glauben Sie es nur, Väterchen Schmilz! Was wirklich gut ist, kompromittiert einen niemals. Das Revolutionäre Theater wird gut, es wird glänzend! Eine Leistung, hinter der ein echter Glaube, ein wirklicher Enthusiasmus steht, überzeugt alle – auch die Feinde werden verstummen vor dieser Manifestation unserer glühenden Gesinnung.“ Seine Augen schillerten, schielten ein wenig und schienen verzückt in Fernen zu schauen, wo die großen Entscheidungen fallen. Das Kinn hielt er stolz gereckt; auf dem fahlen, nach hinten geneigten, empfindlichen Antlitz lag ein siegesgewisser Glanz. ,Das ist wirkliche Ergriffenheit’, dachte Hedda von Herzfeld. ,Das kann er nicht spielen – so begabt er auch ist.’ Triumphierend sah sie Kroge an, der eine gewisse Bewegtheit nicht verbergen konnte. Ulrichs machte eine feierliche Miene.
Während alle noch gebannt saßen von den Effekten seines rührenden Enthusiasmus, änderte Höfgen plötzlich Haltung und Ausdruck. Er begann überraschend zu lachen und deutete auf die Fotografie eines „Heldenvaters“, die über dem Tisch an der Wand hing: die Arme drohend verschränkt, biederer Blick unter finsterer Braue, breiter Vollbart, sorgfältig ausgebreitet auf einem phantastischen Jägerwams. Hendrik konnte sich gar nicht darüber beruhigen, wie drollig er den alten Burschen fand. Unter vielem Gelächter, nachdem Hedda ihm den Rücken geklopft hatte, weil er am Salat zu ersticken drohte, brachte er hervor, dass er selber ganz ähnlich, ja, fast genauso ausgesehen habe – als er nämlich noch die Väterrollen gespielt hatte, an der Norddeutschen Wanderbühne.
„Als ich noch ein Knabe war“, jubelte Hendrik, „da sah ich doch so phantastisch alt aus. Und auf der Bühne ging ich immer gebückt vor lauter Verlegenheit. In den ,Räubern’[29] ließ man mich den alten Moor spielen. Ich war ein hervorragend guter alter Moor. Jeder von meinen Söhnen war zwanzig Jahre älter als ich.“
Da er so laut lachte und von der Norddeutschen Wanderbühne sprach, eilten von allen Tischen die Kollegen herbei: Man wusste, dass nun Anekdoten kommen würden, und zwar keine abgestandenen alten, sondern neue, und wahrscheinlich ziemlich gute – es geschah selten, dass Hendrik sich wiederholte.
Es wurde ein reizender Abend. Höfgen war blendend in Form. Er bezauberte, er brillierte. Als hätte er ein großes Publikum vor sich, anstatt nur die paar geringen Kollegen, verschwendete er, großmütig-übermütig, Witz, Charme und Anekdotenschatz. Was war nicht alles an dieser Wanderbühne passiert, wo er die Väterrollen hatte spielen müssen! Die Motz bekam schon Atemnöte vor Lachen. „Kinder, ich kann nicht mehr!“ schrie sie, und da Bonetti ihr drollig-galant mit dem Tüchlein fächelte, übersah sie, dass Petersen sich schon wieder Schnaps bestellte. Als Höfgen aber dazu überging, mit schriller Stimme, flatternden Gesten und unheimlich schielenden Augen die jugendliche Sentimentale der Wanderbühne nachzuahmen, da verzog sogar Vater Hansemann die starre Miene, und Herr Knurr musste sein Grinsen hinter dem Taschentuch verbergen. Mehr Triumph war nicht herauszuholen aus der Situation. Höfgen brach ab. Auch die Motz wurde ernst, da sie feststellte, wie besoffen Petersen war. Kroge gab das Zeichen zum Aufbruch. Es war zwei Uhr morgens. Zum Abschied schenkte die Mohrenwitz, die immer originelle Einfälle hatte, Hendrik ihre lange Zigarettenspitze, ein dekoratives, übrigens wertloses Stück. „Weil du heute abend so enorm amüsant gewesen bist, Hendrik.“ Ihr Monokel blitzte sein Monokel an. Man sah, dass Angelika Siebert, die neben Bonetti stand, vor Eifersucht eine weiße Nase bekam, und dazu Augen, die tränenvoll und gleichzeitig ein wenig tückisch waren.
Frau von Herzfeld hatte Hendrik aufgefordert, noch eine Tasse Kaffee mit ihr zu trinken. Im leeren Lokal machte Vater Hansemann schon die Lampen aus. Für Hedda war das Halbdunkel vorteilhaft: Ihr großes, weiches Gesicht mit den sanften, klug beseelten Augen erschien nun jünger, oder doch alterslos. Dieses war nicht mehr das betrübte Antlitz der alternden, intellektuellen Frau. Die Wangen wirkten nicht mehr flaumig, sondern glatt. Das Lächeln um die orientalisch trägen, halbgeöffneten Lippen war nicht mehr ironisch, sondern fast verführerisch. Still und zärtlich schaute Frau von Herzfeld auf Hendrik Höfgen. Sie dachte nicht daran, dass sie selber reizvoller aussah als sonst; nur dass Hendriks Gesicht mit dem angestrengten Leidenszug an den Schläfen und dem edlen Kinn blass und deutlich in der Dämmerung stand, merkte sie und genoss sie.
Hendrik hatte seine Ellenbogen auf den Tisch gestützt und die Fingerspitzen seiner ausgestreckten Hände gegeneinander gelegt. Diese anspruchsvolle Haltung leistete er sich wie einer, der besonders schöne, gotisch spitze Hände hat. Höfgens Hände waren aber keineswegs gotisch; vielmehr schienen sie den Leidenszug der Schläfen durch ihre unschöne Derbheit widerlegen zu wollen. Die Handrücken waren sehr breit und rötlich behaart; breit waren auch die ziemlich langen Finger, die in eckigen, nicht ganz sauberen Nägeln endeten. Gerade diese Nägel waren es wohl, die den Händen ihren unedlen, beinah unappetitlichen Charakter gaben. Sie schienen aus minderwertiger Substanz zu sein: bröckelig, spröde, ohne Glanz, ohne Form und Wölbung.
Diese Schadhaftigkeiten und Mängel aber verbarg die vorteilhafte Dämmerung. Hingegen ließ sie das träumerische Schielen der grünlichen Augen rätselhaft und reizend wirken.
„Woran denken Sie, Hendrik?“ fragte die Herzfeld, nach langem Schweigen, mit einer innig gedämpften Stimme.
Ebenso leise antwortete Höfgen: „Ich denke daran – dass Dora Martin unrecht hat…“ Hedda ließ ihn, über seine aneinandergelegten Hände hinweg, ins Dunkel reden, ohne zu fragen oder zu widersprechen. „Ich werde mich nicht beweisen“, klagte er in die Dämmerung. „Ich habe nichts zu beweisen. Niemals werde ich erstklassig sein. Ich bin provinziell.“ Er verstummte, presste die Lippen aufeinander, als erschräke er selber vor den Erkenntnissen und Bekenntnissen, zu denen die sonderbare Stunde ihn brachte.
„Und weiter?“ fragte Frau von Herzfeld mit sanftem Vorwurf. „Und weiter denken Sie nichts? Immer nur daran?“ Da er stumm blieb, dachte sie: ,Ja – dieses ist wohl das einzige, was ihn wirklich beschäftigt. Das mit dem politischen Theater vorhin und sein Enthusiasmus für die Revolution – das war also auch nur Komödie.’ Diese Entdeckung erfüllte sie mit Enttäuschung; irgendwo fühlte sie sich aber auch auf eine merkwürdige Art von ihr befriedigt. Er ließ mysteriös die Augen schillern; eine Antwort hatte er nicht.
„Merken Sie denn nicht, wie Sie die kleine Angelika quälen?“ fragte die Frau neben ihm. „Spüren Sie denn nicht, dass Sie – andere leiden machen? Irgendwo müssen Sie doch für all das bezahlen.“ Sie ließ den klagenden und suchenden Blick nicht von ihm. „Irgendwo müssen Sie doch büßen – und lieben.“
Nun war es ihr doch peinlich, dass sie dies gesagt hatte. Es war entschieden zuviel, sie hatte sich gehen lassen. Schnell entfernte sie ihr Gesicht von seinem. Zu ihrem Erstaunen bestrafte er sie durch kein böses Grinsen, durch kein höhnisches Wort. Vielmehr blieb sein Blick schielend, schillernd und starr, ins Dunkel gerichtet, als suchte er dort Antwort auf dringliche Fragen, Stillung seiner Zweifel und das Bild einer Zukunft, deren eigentlicher Sinn es war, ihn groß zu machen.
14
Novemberrevolution: deutsche Revolution im November 1918. Sie begann am 30.10. mit dem Marinenaufstand in Kiel, führte am 7.11. zum Sturz der bayerischen Monarchie und am 9.11. zur Abdankung Kaiser Wilhelms II. Alle deutschen regierenden Fürsten wurden enttrohnt, in Deutschland wurde die Republik ausgerufen.
15
Wedekind, Frank (*1864, †1918), deutscher Dichter, satirischer Dramatiker, suchte die konventionelle bürgerliche Moral als Unmoral zu enthüllen.
16
Strindberg, August (*1849, †1912), schwedischer Dichter; nahm den Weg vom Naturalismus über den Individualismus zur Mystik; gestaltete den Kampf der Geschlechter und die seelische Zerrissenheit.
17
Kaiser, Friedrich Carl Georg (* 1878, † 1945), der erfolgreichste Dramatiker der expressionistischen Generation. Aus seinem Wirken als Autor gingen 60 Dramen hervor, von denen aber viele in Vergessenheit geraten sind.
18
Sternheim, Carl (*1878, †1942), deutscher Dramatiker; schrieb satirische Komödien.
19
Unruh, Fritz von (*1885, †1970), deutscher Schriftsteller; Pazifist.
20
Hasenclever, Walter (*1890, †1940), deutscher Dichter; schrieb expressionistische Dramen, Lustspiele, Lyrik.
21
Toller, Ernst (*1893, †1939), deutscher Schriftsteller; 1919 Mitglied der Münchener Räteregierung; Pazifist, emigrierte 1933 in die USA.
22
Tagore, Rabindranath (*1861, †1941), indischer Dichter, Philosoph; schrieb in Bengali und Englisch Romane, Dramen und Gedichte. Nobelpreis für Literatur 1913.
23
„Raub der Sabinerinnen“: eine Komödie von Franz
24
„Pension Schöller“: ein Lustspiel von Wilhelm Jacobi und Carl Laufs. Die Uraufführung fand am 7. Oktober 1890 in Berlin statt.
25
„Die Weber“: ein soziales Drama in fünf Akten von Gerhart Hauptmann, das am 26. Februar 1893 im neuen Theater Berlin privat und am 25. September 1894 im Deutschen Theater Berlin öffentlich uraufgeführt wurde. Es behandelt den Weberaufstand von 1844.
26
Leviten, A.T.: die Tempeldiener aus dem Stamm Levi.
27
der Vertrag von Versailles: der am 28.6.1919 in Versailles von den Ententemächten und dem Deutschen Reich zur Beendigung des ersten Weltkrieges unterzeichnete Friedensvertrag.
28
„Frühlings Erwachen“: ein Drama von Frank Wedekind.
29
„Die Räuber“: ein Drama von Friedrich Schiller.