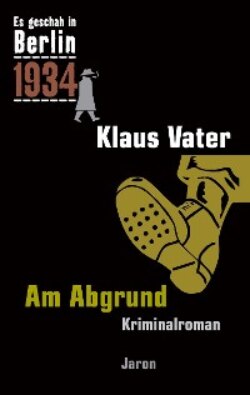Читать книгу Am Abgrund - Klaus Vater - Страница 6
TAG ZWEI
ОглавлениеDAS JAHR 1934 hatte miserabel für Kappe angefangen, es konnte nur besser werden. Zum einen war ihm zu warm. Westeuropa hatte vom ersten Tag des Jahres an fortwährend Wolken und Regen mit Temperaturen über null Grad geschickt. Kappe brauchte im Winter aber Kälte, die in die Ohren biss, Schnee auf den Wegen, Eisschollen auf der Spree und einen Ostwind auf der Jannowitzbrücke, der nur so durchs gusseiserne Geländer pfiff. Statt eines frischen Aprilwetters hatte es weiterhin Schmuddel gegeben, darauf folgte ein regnerischer, stürmischer und zugleich warmer Mai. Fliederblüten im Straßendreck statt an den Zweigen, Schweiß auf der Haut und Regen auf der Jacke.
Das Schmuddelwetter hatte zur Folge, dass Kappes Kreislauf Achterbahn fuhr. Rauf und runter. Er fühlte sich schlapp wie ein nasser Waschlappen.
Zum anderen gab es endlos viel Arbeit. Diese hinderte ihn daran, abends mit Klara am Küchentisch im Lichtkegel des Lampenschirms zu sitzen und ihrer Stimme zu lauschen, die irgendetwas vom Tag erzählte, bis sie abbrach, um sich vollständig auf die Näharbeit zu konzentrieren. Kappe genoss die wenigen Augenblicke der Stille. Dann fühlte er sich wohl, etwa wie ein gutgenährter, aber kurzatmig gewordener, schläfriger Kater.
Wenige Tage nach Neujahr wurden ihm die Ermittlungen im Fall einer ermordeten Hausangestellten in Steglitz übertragen. Einer der typischen Fälle, die auf dem Schreibtisch eines führenden Kriminalisten bei der Berliner Mordinspektion landen.
Während er sich noch mit den Ermittlungen zu diesem Fall beschäftigte, landete der nächste auf seinem Schreibtisch. Ein Apotheker hatte offenbar seine Familie mit Blausäure umgebracht, um sich dann selber dieses Gift zu verabreichen. Warum er das getan hatte, war partout nicht zu ergründen. Kein Ehedrama, keine Eifersucht, keine Schulden, kein Hass – nichts, was auf eine verletzte Seele hätte schließen lassen. Der Fall machte ihm dennoch eine Zeitlang zu schaffen.
In Schöneberg hatte ein Tapezierer seine Frau mit dem Beil erschlagen. Ein versehrter Weltkriegsveteran, rot, verschuldet, vom Rausschmiss bedroht. Seine Frau hatte gedroht, ihn zu verlassen.
Dieser Fall beschäftigte ihn am längsten. Er wurde zu einem Tiefpunkt seiner Karriere. Denn Kappe, diese gute Seele, hatte versucht, dem armen Kerl aus Schöneberg einen «Jagdschein» zu verpassen – ihn also nach Paragraph 51 des Strafgesetzes für nicht zurechnungsfähig erklären zu lassen.
Das hätte sogar funktioniert, wenn Kappe nicht zwei schwer- wiegende Fehler unterlaufen wären. Er hatte in der Akte des Tapezierers nicht vermerkt, dass der auf der «Roten Insel» in Schöneberg wohnte, wo Gerüchten zufolge nicht nur die schönsten jungen Frauen Berlins daheim waren, sondern auch die härtesten Roten – diejenigen, die den Nationalsozialisten den stärksten Widerstand entgegensetzten. Dass der Tapezierer dort wohnte, hatte Kappe also verschwiegen, aber einem jungen Polizisten aus Schöneberg mit einem SA-Mitgliedsbuch fiel es auf. Der leitete diese Erkenntnis dem Kriminalpolizeirat Brettschieß zu, nebst einem denunzierenden Hinweis. Flugs fand sich Kappe herbeizitiert. Der Oberkommissar wurde von Brettschieß hart gerügt und an seine nationalen Pflichten erinnert. «Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass Sie national nur bedingt zuverlässig sind. So etwas schaue ich mir nicht lange an!» Einem solchen «Kretin» wie dem Tapezierer wohlwollend zu begegnen, so Brettschieß, passe nicht ins neue Verständnis von Verbrechensbekämpfung. Kappe hatte schwer zu schlucken.
Wenige Tage danach war Kappe abends mit einigen Kollegen zu einem der seltenen Kegelabende aufgebrochen. An jenem Abend vertilgten Kappe, Galgenberg, Kniehase und die anderen größere Mengen Bier und Schnaps. In dieser lockeren Stimmung fing irgendjemand an, Witze zu reißen über Kappes Versuch, den armen Tapezierer aus Schöneberg vor dem Fallbeil zu retten. Kappe ärgerte sich darüber und trank mehr als üblich.
«Was hast du dir eigentlich dabei gedacht, einen Roten ausgerechnet in einer Mordakte für Brettschieß verstecken zu wollen?» Ein dicker Kollege aus der Abteilung D – Betrug, Schwindel und Falschmünzerei – sah sich beifallheischend um. «Hast wohl Tapezierer mit Anstreicher verwechselt!»
Brüllendes Gelächter.
Kappe strich sich über sein verschwitztes Gesicht. Sein Freund und Kollege Gustav Galgenberg schaute ihn über den Tisch hinweg aufmerksam an, als wolle er sagen: Nimm dich in Acht! Kappe war aber nicht mehr zu bremsen. «Was wollt ihr? Muss doch möglich sein, in Deutschland einen Tapezierer vor der Hölle zu bewahren, wenn Anstreicher bei uns auf den Olymp kommen.» Sprach’s und trank sein Glas aus. Er merkte nicht, dass sich nicht nur bei dem dicken Kollegen die Lider verengten.
Wenige Tage darauf wurde er zu Brettschieß zitiert. Dort erwartete ihn eine ganze Reihe höherer Kriminaler. In Anwesenheit des Berliner Polizeipräsidenten Magnus von Levetzow wurde Kappe zurückgestuft, vom Oberkommissar zum einfachen Kommissar. Damit verbunden waren ein geringeres Gehalt und später eine entsprechend niedrigere Pension. Das war eine Seltenheit wie Degradieren beim Militär. Der Hochleistungsbürokrat Dr. Brettschieß durfte persönlich den Beschluss erläutern. Es werde ein Signal gesetzt: Wer nicht bereit sei, das Verbrechen mit aller Härte zu bekämpfen, habe in der Berliner Polizei nichts zu suchen. Es müsse Schluss sein mit liberalem Schlendrian und mit dem Ungeist der Altparteien. Man habe Kappe auch hinauswerfen können, aber dann gnädig darauf verzichtet, weil er als Kriminalist unbestreitbare Erfolge vorzuweisen habe. Eine letzte Chance der Bewährung.
Kappe riskierte während dieser Worte einen ersten Blick auf die Versammlung, vor der er stand. Seine Sorge war, dass man sein leichtes Zittern in den Beinen erkennen könnte. Aber offenbar interessierte dies niemanden. Kriminalrat Gennat, seiner voluminösen Gestalt wegen «der volle Ernst» genannt, überragte in der zweiten Reihe alle anderen. Er hatte ein verkniffenes Grinsen im Gesicht.
Tags darauf begriff Kappe, warum Gennat so verkniffen aus der Wäsche geschaut hatte. Der hünenhafte Kriminalpolizeirat eröffnete ihm, dass er künftig seine Arbeit mit ihm, Gennat, zu besprechen habe. Das habe der Polizeipräsident angeordnet. Wenn sich ein erfahrener Kriminalist um ihn kümmere, sei die Chance größer, ihn auf den neuen nationalen Weg der Bekämpfung von Schwerstkriminalität zurückzuführen, habe der erläutert. Gennat presste wieder die Lippen zusammen, zog die Mundwinkel hoch und zwinkerte mit den Augen. «Keinen Unfug mehr!», befahl er.
«Wenn Sie weitere solcher Klöpse abliefern wie bei dem armen Tapezierer von der ‹Roten Insel›, reißen Sie mich mit rein. Haben Sie das verstanden?»
Das hatte Kappe verstanden. Gennat steckte in einer Zwickmühle. Brachte er ihn im Sinne der Braunen zur Räson, verlor er das Vertrauen der altgedienten Kripobeamten. Brachte er Kappe nicht zu einer braun eingefärbten «Vernunft», galt er in der Augen der Machthabenden rasch als unzuverlässig. Eine schier ausweglose Situation für Gennat. Aber da der sich schon öfter aus solchen Situationen befreit hatte, machte sich Kappe keine große Sorge um ihn. Gennat war ein Phänomen.
Der Tapezierer bekam einen kurzen Prozess und die Henkersmalzeit. Hermann Kappe machte sich während der folgenden Wochen möglichst klein.
Dann folgte der Fall einer jungen Frau, die in einem Hotel in der Friedrichstraße erschossen worden war. Der Täter war flüchtig. Offenkundig hatte er sie verführt und dann ausrauben wollen. Die Stadt, eine Vier-Millionen-Einwohner-Bestie, verschlang jedes Jahr auf diese oder ähnliche Weise so manche junge Frau. Doch Kappe hatte mit Glück und Können den Fall rasch gelöst. Daher wich langsam die Scham wegen der Degradierung, und sein Selbstbehauptungswille rührte sich wieder. Während der vergangenen Wochen hatte er öfter über die Zeitläufte nachgedacht. Immer häufiger hatte er mit Verbrechen zu tun, deren Auslöser nicht allein Gier oder Mordlust waren. Hass auf eine andere Herkunft und Neid auf Wohlhabende kamen hinzu. Tritte mit genagelten Schuhen, Knüppel, Mauser. Wieder ein Volksfeind weniger.
Schließlich hatte ein Oberwachtmeister im Osten der Stadt einen betrunkenen Mann erschossen, der zuvor einen anderen Gast niedergeschlagen hatte. Dieser Fall war der leichteste, denn der Betrunkene hatte gedroht, mit seiner Eisenstange die Herrschaften am Tresen zu Brei zu schlagen. Der zufällig anwesende Polizist, ins Gespräch mit Bekannten vertieft und die Nase im Bier, war aufmerksam geworden, als der Betrunkene eine kurze Eisenstange aus der Tasche zog und sie einem Mann auf den Kopf schlug, um sich dem Nächsten zuzuwenden. Der Oberwachtmeister war aufgestanden und hatte den Betrunkenen angeschrien, er solle einhalten. Als der sich darauf mit der Eisenstange in den Fäusten dem Polizisten zuwandte, zog dieser die Pistole und gab drei Schüsse auf den Mann ab, um sich dann wieder an seinen Tisch zu setzen. Der Niedergeschossene war binnen weniger Minuten verblutet.
Kappe hatte die Ergebnisse der Gerichtsmedizin studiert, die Zeugen einbestellt und vernommen, die Aussagen verglichen. Nichts Neues. Der Mann hatte gewarnt, geschossen und andere wie sich selber vor Schaden bewahrt. Stutzig machte ihn die Tatwaffe: keine neue Walther PPK, sondern eine Sauer Modell 24, eigentlich ausgemustert, aber bei manchen noch im Gebrauch.
«Wo tragen Sie die alte Sauer?», hatte Kappe den Oberwachtmeister gefragt.
Der hatte die Brauen hochgezogen und geantwortet: «Im Gürtel, wie alle im Sturm.»
Kappe hatte seine Antworten notiert, den Aktendeckel geschlossen und den ganzen Vorgang weitergeleitet. Der Fall schien eindeutig. Und dennoch blieb bei Kappe ein saures Gefühl zurück – das Gefühl, dass etwas an der Geschichte des Oberwachtmeisters nicht stimmen konnte.
Jetzt lag der Fall eines Zimmermanns auf Kappes splittrigem Schreibtisch. Leiblein, Kaspar Michael. Merkwürdiger Name. Er legte eine Mordakte an. Sichtete, was zu diesem Fall vorlag: ein Umschlag mit Unterlagen über Leibleins Beruf und Werdegang, sichergestellt in dessen Zimmer in der Michaelkirchstraße. Ein Protokoll zweier Polizeibeamter. Einige lose beschriebene Seiten Papier. Sonst nichts. Kein Beschluss über eine Einweisung Leibleins in ein Gefängnis, nichts von der Gerichtsmedizin.
Kappe begann zu lesen. Leiblein hat wissentlich und mit Absicht den Tod mehrerer Zimmerleute herbeigeführt. Sie sind wegen seiner Machenschaften in fließendem Sand erstickt. Das Papier war unterschrieben von einem Gießwein, Polier stand ergänzend darunter. Und vom Bauleiter. Dessen Unterschrift, offenbar eilig gesetzt, war unleserlich.
Leiblein habe dafür gesorgt, dass eine Wand der Baugrube am Stettiner Bahnhof einstürzte und Arbeiter unter sich begrub, hieß es weiter. Kappe wusste, dass am Stettiner Bahnhof die neue Nord-Süd-Bahn durch die Stadt gebaut wurde. Die ersten Pläne zu dieser Strecke stammten noch aus der Kaiserzeit. Nun hatte sich der Führer des Vorhabens angenommen.
Kappe blickte zu Galgenberg hinüber, mit dem er sich seit kurzem ein Zimmer teilte. «Leiblein, ein ungewöhnlicher Name, oder?» Der grunzte, stand auf und ging zu einem Schrank, dem er zwei Bücher entnahm. «Schauen wir mal in unserem Wörterbuch der Familiennamen in zwei Bänden.» Er blätterte, las, rieb sich die Nase.
«Da haben wir den Namen. Leiblein. Aha – Landfahrer. Hier steht: Im fahrenden Volk des Rheinlandes und Württembergs anzutreffender Familienname. Die Sippen der Leiblein zählen zu den Zigeunern. Der Name ist ebenfalls in der Schweiz und in Österreich nachge- wiesen.» Er brummte. «So, also Roma soll der Leiblein sein.»
«Roma?»
«Ja, Roma», erwiderte Galgenberg. «So nennen die sich selber.» Kappe schüttelte den Kopf und las weiter in den losen Blättern. Mit blauem Kopierstift war in einer anderen Handschrift hinzugefügt: Die Arbeitsschlacht in Berlin muss gewonnen werden! Wir vermuten, dass Leiblein Deutschland gegenüber feindlich eingestellt ist. Oder dass er im Auftrag von Leuten gehandelt hat, die einen störungsfreien Bau der S-Bahn durch Berlin in Richtung Süden und Anhalter Bahnhof verhindern wollen. Der Mann ist schlau und aalglatt.
So ein Blödsinn, dachte er. Ein Zimmermann – in wessen Auftrag sollte der ein Verbrechen begehen?
Kappe überlegte kurz. Dann griff er zum Hörer, um einen der Kriminalassistenten der Mordinspektion anzurufen. «Wo ist dieser Leiblein … Noch in Moabit? Schaff ihn her. Aber flott!» Er legte auf und widmete sich wieder dem Schreiben.
Auf einem anderen Blatt war zu lesen, Leiblein habe am Abend zuvor mit einigen Arbeitern Streit gehabt. Sie hätten sich gegenseitig voller Wut angeschrien. Der Bauleiter habe dem Streit mit einigen scharfen Worten ein Ende bereitet. Wodurch diese Streiterei ausgelöst worden war, wisse man nicht.
Aufmerksam schaute Kappe sich das Papier an. Ein Blatt wie aus einem Heft gerissen, ein wenig fleckig, liniert, einseitig beschrieben. Mehrere Handschriften standen untereinander, ohne Datum und Ortsangabe. Ebenfalls mit blauem Kopierstift hatte jemand hinzugefügt: Schutzhaft ist anzuordnen. Unterschrieben von einem Maretzke, Obertruppführer. Er stutzte. Ein SA-Feldwebel. Das fehlte noch! Die Braunen mischten bei dieser Ermittlung mit. Das passte Kappe überhaupt nicht.
Er legte die Blätter beiseite und griff zum offiziellen Protokoll. Unterschrieben von Hauptwachtmeister Schneider und Wachtmeister Neufeld.
Am 20. Juni gegen fünf Uhr am Nachmittag ereignete sich auf der S-Bahn-Baustelle am Stettiner Bahnhof eine schwere Verschüttung, der mehrere Arbeiter zum Opfer fielen. Trotz sofortigen Herbeieilens der Polizei aus dem Abschnitt 31, der Feuerlöschpolizei und mehrerer Sanitäter aus der Charité konnten zwei, möglicherweise noch mehr Arbeiter nicht gerettet werden. Die exakte Zahl der Opfer konnte nicht festgestellt werden. Ein weiterer Arbeiter starb an den Folgen seiner Verletzung noch am Unfallort. Die Namen der bisher bekannten Opfer lauten: Paul Schnicke, Ewald Karnovski, Herbert Kaschke.
Der auf der Baustelle anwesende Zimmerer Kaspar Michael Leiblein wird von verschiedenen Zeugen beschuldigt, den Tod dieser Bauarbeiter in die Wege geleitet zu haben. Heimtückisch habe er seine Kollegen in die Baugrube gelockt, nachdem er diese unsachgemäß abgesichert hatte. Der Unglücksablauf: Die Arbeiter kamen in einer Tiefe von rund zehn Metern um. Aufgrund einer Erschütterung ist die Wand der Grube beschädigt worden. Fließsand schoss mit so viel Druck ein, dass der Boden der Grube einsank. Mehrere Männer verschwanden. Der Bauleiter beschrieb die Situation als vergleichbar mit einem Waschbeckenabfluss, der in einen Siphon mündet. So, wie das abfließende Wasser alles mit in den Siphon zieht, reiße Fließsand alles mit in den Untergrund.
Anschließend wurde umständlich beschrieben, was einzelne Personen gesagt hatten. Auch hier wurde der Zimmerer Leiblein noch einmal beschuldigt – offenkundig vom Polier. Leiblein selbst war offensichtlich nicht befragt worden. Eigenartig, dachte Kappe.
Säuberlich war vermerkt, wer an den Rettungsarbeiten beteiligt gewesen war und wo man gesucht hatte. Während der Rettungsarbeiten habe Leiblein sich teilnahmslos gezeigt und nicht mitgeholfen.
Das Protokoll führte die Namen des Poliers und des Bauleiters sowie mehrerer Arbeiter auf, die den Hergang erläutert hatten.
Welch ein Durcheinander! Hier jede Kleinigkeit aufgeführt, dort Wichtiges nicht gefragt. Das Werk von Anfängern? Kaum. Auch unter diesem Papier stand in blauem Kopierstift: Maretzke, Obertruppführer. Und: Muss in Schutzhaft!
Auch das Protokoll wanderte auf die Seite. Kappe schüttelte die Papiere aus dem braunen Umschlag. Galgenberg hatte seinen Stuhl herangezogen, um zuzuschauen. Leibleins Ausweispapiere: Am 6. Juni 1887 in einem Ort in der Eifel mit dem seltsamen Namen Bleibuir geboren. Verheiratet mit Anna Leiblein, geborene Busch. Drei Kinder. Von Beruf Zimmerer. Der Vater hieß Caspar Leiblein, geboren in Stotzheim bei Euskirchen. Als Beruf war Scherenschleifer angegeben. Die Mutter stammte aus Bleibuir. Geburtsname Laufenberg.
Mitglied Nummer 105 496 im Zentralverband der Zimmerer und verwandter Berufsgenossen Deutschlands, später Mitglied im Nachfolgeverband Baugewerksbund. Beide Gewerkschaftsbücher waren mit Wachskordel zusammengebunden. Eine Reiselegitimation war vom Vorstand der Zimmerer für die Jahre 1912 und 1913 erteilt worden. Die Stationen waren Hamburg, Bremen, Leipzig, Goslar und Straßburg. In Bremen war der Mann Spezialist für Bauen im Sand geworden. Abonniert die Arbeiterpresse , stand im Mitgliedsheft. Stärkt die Kampforganisation der Arbeiter.
Kappe brummte. Das Kerlchen aus der Eifel war ganz schön viel herumgekommen. Er griff nach einigen Schriftstücken, über denen jeweils das Wort Zeugnis stand. Ein Zeugnis der Bremischen Baubehörde und eines der Firma Gewerkschaft Mechernicher Werke. Welch ein komischer Name, dachte Kappe. Und ein Zeugnis aus Sachsen. Ausnahmslos wurden Leibleins Kenntnisse und Fähigkeiten als Zimmermann hervorgehoben. Sein Meisterbrief und ein Vermerk, wonach er selbständig Bauzeichnungen anlegen und lesen könne, ergänzten die Zeugnisse.
Außerdem befand sich in der Mappe Leibleins Militärpass: Vier Jahre Krieg im Westen, Feldwebel in einem elsässischen Regiment, Träger des EK I und der Georgsmedaille. Ein knappes Jahr vor Verdun, im Herbst 1918 vom Soldatenrat entlassen. Im Militärpass lag ein Heiligenbildchen. Eine Frau mit einem Kind auf dem Arm, beide gekrönt und in gesteiften Kleidern. Kappe las die Widmung über dem Bild: Consolatrix afflictorum ora pro nobis. Er war sich nicht schlüssig, was das zu bedeuten hatte. Ob ihn diese Inschrift weiterbringen konnte?
Er wählte den Apparat von Professor Brüning in der Gerichtschemie an. «Verzeihen Sie, Herr Professor. Sie sprechen doch die alten Sprachen, oder nicht?»
Brüning lachte. «Aramäisch, Latein und Griechisch. Was wollen Sie denn übersetzt haben?»
Kappe las ihm die Worte langsam vor.
Es gluckste in der Leitung. «Kappe, werden Sie auf Ihre alten Tage gläubig? Das ist ein Spruch der Katholiken. Er bedeutet: Trösterin der Betrübten, bete für uns!»
«Kein versteckter Hinweis? Keine Geheimsprache?», wollte Kappe wissen.
«Nee, Herr Kollege. Katholikengewäsch, sonst nichts.» Kappe bedankte sich.
Auf einer Photographie war ein Grabstein zu sehen. Der Name Caspar Leiblein war in den Stein gemeißelt. Unter den Namen hatte der Steinmetz eine Art Planwagen in den Block gestemmt.
Kappe schüttelte wieder den Kopf. Daheim war Leiblein Feuerwehrmann. Kappe zog andere Photographien aus dem Stapel Papiere hervor, eine dunkelhaarige Frau mit feinem Gesicht blickte ihn aus resoluten Augen an – offenbar Anna Leiblein. Ein weiteres Bild von ihr und drei Kindern. Eine Photographie von zwei bärtigen Männern in Uniform. Mehrere Briefe Anna Leibleins an ihren Liebsten, aus denen ein feiner Duft aufstieg. Etwa wie die Erinnerung an Sommer, an das Kitzeln des Gräserdufts in der Nase. Hitze, träges Wandern durch Kornfelder. Der erste Tag mit Klara …
Polizeilich gemeldet war Leiblein in der Michaelkirchstraße bei Familie Gehrcke. Über Gehrcke, der als Reichsbanner-Mitglied bekannt sei, gebe es eine Akte, war handschriftlich auf einem Zettel hinzugefügt worden. Leibleins Arbeitserlaubnis für Berlin war vorhanden, die Firma Polensky und Zöllner hatte ihn eingestellt. Er erhielt 55 Pfennige die Stunde, eine Arbeiterwochenkarte zu acht Mark.
Kappe war unschlüssig, was er von dieser Geschichte halten sollte. Er griff zum Hörer, um die Nummer von Karl Bresser anzuwählen, den er von einem früheren Fall kannte. Den Baurat der Höheren Technischen Staatslehranstalt für Hoch- und Tiefbau hatte es vor einigen Jahren aus Köln nach Berlin verschlagen.
«Guten Tag, Herr Baurat. Lange nichts mehr voneinander gehört. Was macht die Gesundheit, alles bestens? Das freut mich. Herr Bresser, ich bin bei laufenden Ermittlungen über den Namen Leiblein gestolpert. Der dazugehörige Arbeiter stammt aus dem Rheinland, aus einem Ort namens Bleibuir …»
«Ein kleiner Ort zwischen Euskirchen und Schleiden», unterbrach ihn Bresser. «Das Dorf kenne ich. Und der Mann heißt Leiblein? Woher stammen die Eltern? … Ach, aus Stotzheim. Na, so was! Eine Rarität.»
«Wieso eine Rarität?», wollte Kappe wissen. «Im Namenslexikon steht, die Leibleins würden den Zigeunern zugerechnet, pardon, den Roma.»
«Werfen Sie das Lexikon weg! Leiblein ist wie Kreitz ein durchaus geläufiger Familienname der Jenischen.»
«Jenische? Nie gehört.»
«Das kann ich mir denken. Es gibt in Deutschland zwischen einhundert- und zweihunderttausend Jenische. In Österreich und in der Schweiz gibt es die auch. Und in Belgien. Es ist eine kleine Volksgruppe. Woher sie kommen, weiß niemand so richtig. Es gab sie schon vor Hunderten von Jahren. Sie sind fahrendes Volk, ernähren sich vom Besenbinden, Bürstenherstellen, Kesselflicken, Korbflechten, Scherenschleifen. Sie leben wie in einer Nische. Oder besser gesagt wie hinter einem Vorhang. Es gibt sie aber. Ihre überkommene Lebensweise gerät freilich immer mehr ins Hintertreffen. Kessel sind so billig geworden, dass sich ein Flicken nicht mehr lohnt. Wer braucht noch Körbe? Daher wandern viele Jenische jetzt ab in die Betriebe.»
«Woher wissen Sie das?»
«Tja, während meiner Zeit im Rheinland bin ich ziemlich viel herumgereist. In der Gegend um Euskirchen fielen mir die vielen Landfahrer auf. Mit denen habe ich mich unterhalten. Ein Jenisch namens Kreitz, ein Gipser, hat meine Wohnung in Köln gestrichen und den Stuck an der Decke erneuert. Der hat mir eine ganze Menge erzählt. Unter anderem, dass sie sich dagegen wehren, mit Zigeunern verwechselt zu werden.»
«Wie reden die miteinander?», wollte Kappe wissen. «Auf Deutsch?»
«Nein. Die Sprache ist eine Art Geheimdialekt. Ein bisschen mittelalterliche Gaunersprache, Jiddisch, manches stammt aus den Roma-Dialekten, hinzu kommen deutsche Begriffe und eigene Wortschöpfungen. Ich ziehe zum Beispiel jetzt an meiner Schmogal , an meiner Zigarette.»
«Also doch mehr oder weniger Zigeuner … ich meine, Roma», hakte Kappe nach.
«Eben nicht. Weder Sinti noch Roma. Leiblein ist Vertreter einer kleinen, fast völlig unbekannten Volksgruppe. Ich glaube, deren Lebensmotto lässt sich auf den Satz einkochen: Arm macht schlau! Überlebenskampf im fahrenden Gewerbe macht wissbegierig und entwickelt alle Fähigkeiten. Arm macht nicht dumm.»
«Das würde erklären, warum unser Leiblein so ein tüchtiger Zimmermann ist.»
«Genau, Herr Kappe.»
«Und Sie sind sicher, dass dieser Leiblein kein Roma ist, kein Pole oder aus sonst einem anderen Volk?»
«Mit nahezu hundertprozentiger Sicherheit. Jenische sind tüchtig. Die stecken unendlich viel Sorgfalt in die Erziehung ihrer Kinder. Ich fürchte aber, dass es den Jenischen unter der neuen Regierung nicht gutgehen wird. Auf Wiederhören!» Damit legte Bresser auf.
«Was hältst du von dem Leiblein?», fragte Kappe den Kollegen Galgenberg.
Der hatte sich inzwischen die Photos angeguckt, den Militärpass, den Mitgliedsausweis des Zimmererverbands und die anderen Papiere. «Tja, da hast du die freie Auswahl, Hermann. Das ist entweder ein perfider Mörder oder ein anständiger Kerl, dem man etwas anhängen will. Wie siehst du die Sache?»
Kappe überlegte eine Weile. «Leiblein kommt aus einem Kaff, wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf, denn reiche Leute schicken ihre Söhne nicht auf die Walz. Er arbeitet offenbar nicht mehr daheim, weil er hier in Berlin besser verdienen kann. 55 Pfennige die Stunde sind nicht berauschend, aber immerhin mehr als in der Eifel. Außerdem hat er sich hochgearbeitet. Ist Zimmermann, Spezialist für Bauen im Sand. Meister. Er hat sehr sorgfältig im Mitgliedsbuch eintragen lassen, wann er die Versammlungen seiner Gewerkschaft besucht hat. Einträge über Arbeitslosenunterstützung gibt es nicht. Es scheint Ordnung in seinem Leben zu herrschen. Im Krieg war er Feldwebel. Das ist einer, der weiter nach oben will …»
«Aber vielleicht bald mit Madame Guillotine Bekanntschaft macht», fügte Galgenberg hinzu. «Er lag fast ein Jahr vor Verdun. Ein Jahr Fleischwolf. Als Festungspionier. Das sind Leute mit Nerven wie Drahtseile, sag ich dir. Die wurden nach vorne beordert, wenn nix mehr ging. Der Krieg hat die merkwürdigsten Typen hervorgebracht. Er ist katholisch, gläubig. Er wohnt nicht feudal im Adlon, sondern zur Untermiete in der Nähe der Köpenicker Straße. Keine schlechte Gegend, aber auch nichts zum Prahlen. Schau dir mal die beiden Männer auf der Photographie an, wie ähnlich die sich sehen. Der links ist Feldwebel mit dem EK I, der andere ist Obergefreiter. Das sind Brüder, und der Linke ist dein Mann, wetten?» Er zeigte auf einen länglichen Kopf mit Schirmmütze. Das Gesicht war eingerahmt von einem Bart mit sich teilenden Enden.
«Wenn Brettschieß oder ein anderer Brauner spitzkriegt, dass der Leiblein ein Jenisch ist, hat der nichts mehr zu lachen. Für die ist der Mann dann von vornherein Abschaum. Für die ist nur noch ein richtiger Mensch, wer eine nationalsozialistische Gesinnung hat. Die würden am liebsten braune Geranien züchten, sag ich dir.»
«Was hat das denn mit der S-Bahn zu tun? Das ist sehr weit hergeholt.»
«Vergiss nicht», erwiderte Galgenberg, «dass die Braunen jetzt auf Teufel komm raus die Arbeitslosenzahl senken wollen. Die drängen die Arbeitslosen aufs Land, auf die Bauernhöfe, damit die nicht mehr das Stadtbild versauen. Es heißt ja auch immer öfter ‹arbeitsscheu› statt ‹arbeitslos›. Und sie wollen ihre Arbeitsschlacht gewinnen. Für die Berliner Arbeitsschlacht brauchen sie Fachleute wie deinen Eifeler. In der Morgenpost stand neulich: Das Wunderwerk der Nord-Süd-Bahn. Das nationalsozialistische Wunderwerk soll fertig sein, wenn die Jugend der Welt in zwei Jahren in Berlin vorturnt.» Kappes Telefon rasselte. Es war der Kriminalassistent, den er beauftragt hatte, sich um Leiblein zu kümmern. Aus der Vernehmung werde heute nichts mehr, erklärte er, weil der Zimmerer auf der Krankenstation sei. Er habe Blessuren im Gesicht und könne erst am nächsten Tag vernommen werden.
Seit Anfang 1933 ärgerte sich Kappe schwarz und wünschte einigen im Präsidium die Krätze an den Hals, wenn er einen Fall zu bearbeiten hatte, in dem die SA eine Rolle spielte. Er hatte sich sein Bild von den Mitgliedern dieser NS-Organisation gemacht. Man kam daran einfach nicht vorbei. Wie viele seiner Kollegen schaute auch Kappe nur noch verlegen zur Seite, wenn es um die SA ging. Hunderte von denen waren nach Hitlers Ernennung zum Reichskanzler und nach dem Putsch der Reichsregierung gegen die preußische Landesregierung zu sogenannten Hilfspolizisten ernannt worden. Die Männer blieben SA-Mitglieder, wurden aber notdürftig als Polizisten verkleidet. Die SA-Feldpolizei war eine Sondereinheit, die die reguläre Polizei bei ihrem Kampf gegen die «staatsfeindlichen Kräfte» verstärken und unterstützen sollte.
Tatsächlich machte die SA, was sie wollte. Sie richtete Gefängnisse und Folterlager ein. Zum Beispiel in der General-Pape-Straße. Das Pankower Gefängnis war von der SA kurzerhand umfunktioniert worden. Seitdem hieß es Karl-Ernst-Haus, nach dem sadistischen Berliner SA-Chef benannt. Das Columbiahaus in Kreuzberg wurde die schlimmste SA-Folterstätte. Später übernahm die SS das Haus und setzte fort, was die SA begonnen hatte. Daneben existierten in Kneipen und anderen SA-Treffpunkten viele kleinere Folterstätten. Die SA verhaftete zeitweise, wen sie wollte, quälte ihre Opfer, wo und wann sie wollte, ermordete sie schließlich und verscharrte sie irgendwo. Die Schutzpolizei konnte nichts tun. Die Mordkommission der Berliner Polizei stand am Ende oft vor dem, was äußerlich kaum noch einem Menschen glich.
Offiziell durfte die SA das alles natürlich nicht. Nicht einmal mehr verhaften durfte sie. Reichsinnenminister Frick hatte am 12. April 1934 angeordnet, dass die SA selbst keine Verhaftungen mehr vornehmen, sondern nur noch Schutzhaft anregen dürfe. Vor allem dann, wenn ein Verdächtiger durch staatsfeindliche Äußerungen die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährde. Kappe grunzte. So ein Quatsch! Und was war mit der SS? Nur Dumme ließen sich durch einen Frick-Erlass täuschen.
Anfangs war Kappe nur neugierig stehengeblieben, wenn SA-Mitglieder, ihre Lieder grölend, auf Lastwagen durch die Stadt fuhren. Er konnte vom Rand der Straße her riechen, dass viele besoffen waren – so besoffen, dass sie Vater und Mutter nicht mehr erkannt hätten. Grinsend saßen sie auf den schaukelnden Ladeflächen, ihre Gewehre zwischen den Schenkeln, die Sturmriemen festgezogen. Wenn der Wagen hielt und die Männer heruntersprangen, wichen die Menschen unwillkürlich zurück. Kinder wurden von der Straße geholt, Rollläden runtergelassen. Das Straßenleben erstarb. Später bog Kappe sofort ab, wenn er solche Wagen kommen hörte.
Manchmal hatte er den unbestimmten Eindruck, dass neben den aufmarschierenden Scharen der SA, neben denen der Jungen und Mädchen, der Lehrer mit dem Parteiabzeichen, der braunen Beamten, der Landwirte und Krämer noch eine andere Armee marschierte. Wenn der offizielle NS-Staat die Berliner Wilhelmstraße hinauf- oder hinuntergezogen war, über den Horst-Wessel-Platz zum Fehrbelliner Platz, glaubte Kappe ein leises Echo auf deren Tschingderassabum zu hören. Das drang aus irgendeiner Parallelstraße, auf der schweigend, grau und lautlos eine andere Schar zog: die SS und der Sicherheitsdienst, auch SD genannt.
Es schüttelte Kappe, wenn er denen begegnete. Die Mitarbeiter des SD waren meist arbeitslose NSDAP-Mitglieder, die der SS beigetreten waren. Judenhasser aus dem Staatsdienst, auch aus dem Polizeikorps, die sich das Parteiabzeichen der Braunen hatten anstecken lassen. «Arische» Jünglinge. Sadisten. Hasser der Republik. Gegner jeglicher Verständigung mit anderen Völkern. Bedenkenlose Aufsteiger. Viele gingen keinem Dreck aus dem Weg, weil sie mit den Nationalsozialisten aufsteigen wollten. Manche von denen waren ebenso intelligent wie gewissenlos und besaßen geschliffene Umgangsformen. Und allmählich wuchs dieses Volk in die reguläre Polizei hinein.
Die Beamten der Mordinspektion waren Fußsoldaten. Sie kamen aus allen Schichten des Volkes – mit und ohne Latinum. Es kam in den Mordkommissionen auf Ausdauer, auf Intelligenz, auf Menschenkenntnis an. Wer seinen Kopf wie ein Lexikon der menschlichen Natur zu gebrauchen wusste, der war hier richtig. Das war keine Arbeit für Menschen, die ihre Füße lieber in Schühchen für den Sonntagnachmittag-Ausflug steckten statt in Stiefel mit dicken Sohlen.
Der SD, das war Angst und Schrecken, Schweiß und Erbrochenes, Blut und lädierte Knochen. Alles versteckt hinter dicken Mauern. Der Satz «Kommen Sie mit!» wirkte am besten nachts, wenn man jemanden aus dem Schlaf gerissen hatte. Wer solch einem Befehl nicht freiwillig folgte, den erwartete die Hölle.
Auf diesem Terrain musste sich Kappe nun bewegen. Er tat das, was ein guter Kriminalist tat, wenn er in unklare Situationen Klarheit bringen wollte: nachschauen, was die Akten hergeben. Also rief er Trude Steiner an, Sekretärin der Mordinspektion und Vertraute von Ernst Gennat. Er schilderte ihr die Situation und bat darum, ihm die Fälle zukommen zu lassen, in deren Ermittlungen sich die SA eingemischt hatte.
«Diese Informationen können Sie haben», antwortete Trude Steiner. «Sie brauchen lediglich vorbeizuschauen. Es liegt alles bereits parat.»
Kappe zögerte. Wieso lagen solche Informationen schon bereit?
«Nur zu. Das hat Herr Gennat bereits vor Wochen veranlasst.
Der ist ja nicht von gestern. Und Sie stehen auf der sehr kurzen Liste der Leute, die Einblick haben dürfen. Sie fertigen keine Abschriften an, geben nichts aus der Hand. Sie bestätigen mir durch Ihre Unterschrift bei der Rückgabe, dass Sie keine Regel verletzt haben. Kann ich mich darauf verlassen?»
«Selbstverständlich», antwortete Kappe.
Wenige Minuten später hatte er einen Aktendeckel in der Hand, der zugeklebt war. Auf dem Verschlussstreifen standen Name und Datum. Kriminalrat Arthur Nebe hatte diese Unterlagen zuletzt in der Hand gehabt. Im Präsidium wurde erzählt, Hermann Göring halte die Hand über den gelernten Berliner Polizisten. Nebe sei für die Geheime Staatspolizei, für die preußische Gestapo tätig. Welche Aufgaben er im Einzelnen hatte, das wusste offenbar keiner.
Kappe löste den Streifen und öffnete die Mappe, um einige der Fälle zu entnehmen.
Fall eins: Mord an einem kommunistischen Bezirksverordneten. Das Bild des Ermordeten zeigte ein mageres Gesicht, volles Haar, eindringliche Augen. Er trug ein knautschiges Hemd und eine Jacke in einem undefinierbaren Grau. Motorenschlosser in einem Flugzeugwerk der AEG. Ein Allerweltsgesicht. Auch die Mörder waren auf Photopapier gebannt worden. Alle trugen die obligatorische Kappe, Hemd und den kurzen Schlips. Der Sturmriemen lief quer über die Brust.
Der Bezirksverordnete war aus dem Haus getreten, in dem er mit seiner Familie wohnte. Vor dem Haus hatte sich ein SA-Mann aufgepflanzt, eine Holzlatte mit einem daran genagelten Schild in der Hand. Darauf stand: Hier wohnt ein Volksfeind. Ein kurzer Wortwechsel – und dann mehrere Schüsse, die den Bezirksverordneten töteten. Zufällig waren Schutzpolizisten in der Nähe. Sie verhafteten die beiden SA-Männer. Die kamen in Zellen des Präsidiums, der sogenannten roten Burg. Zwei Tage später wurden sie auf schriftliche Anweisung des preußischen Innenministers Göring wieder aus der Haft entlassen.
Fall zwei: Mord an einem Betriebsrat. Wieder waren Opfer und Mörder photographiert worden. Die Mörder hatten gestanden. Dennoch waren sie auf Veranlassung des preußischen Innenministeriums aus der Haft entlassen worden.
So reihte sich ein Fall an den anderen. Wie elektrisiert las Kappe schließlich folgende Schilderung:
Mehrere SA-Mitglieder des Spandauer Sturms hatten sich derart zerstritten, dass sie schließlich ihren Konflikt handgreiflich lösten. Dabei kamen zwei SA-Männer um. Da die Spandauer SA-Mitglieder ihre Gelage stets in Gesellschaft von Gästen abhielten, kam ein Obertruppführer auf den Gedanken, die Tötung der beiden SA-Kollegen einem völlig betrunkenen Gast anzuhängen. Dieser wurde mit Kaltwassergüssen aus seinem Rausch gerissen und mit dem Vorwurf konfrontiert, er habe zwei SA-Leute erschlagen. Als der Beschuldigte sich zu wehren begann, wurde er erschossen. In einem Schriftstück wurde festgehalten, dass er sich gegen seine Festsetzung gewehrt habe. Als er die Flucht ergreifen wollte, sei er von aufmerksamen Hilfspolizisten erschossen worden.
Das Schriftstück war vom Kollegen Teichmüller unterzeichnet. Der arbeitete für die Politische Polizei und war Kappe von einem früheren Fall bekannt.
Er rief Teichmüller an.
Der war nur mäßig überrascht, dass der Kollege ihn auf den Spandauer Fall ansprach. Die Schlüsselrolle habe offenkundig ein gewisser Gießwein gespielt, erklärte er Kappe. Der sei in der SA und führe beruflich als Polier eine Kolonne, welche für den S-Bahn-Bau tätig sei. Da er in Spandau wohne, treffe er sich zum Saufen öfter mit Leuten des dortigen Sturms. «Die Idee, den Tod der beiden einem Unbeteiligten anzuhängen, stammt von Gießwein, darauf würde ich wetten. Alles andere verschwimmt in einem Dunst aus Gerüchten, Schnaps und natürlich aus Beziehungen. Weshalb interessiert Sie der Fall?»
Kappe erzählte, was am Stettiner Bahnhof vorgefallen war.
«Da kann Ihr Mann aus der Eifel aber von Glück sagen, dass er noch lebt. Viel Glück bei Ihrer Untersuchung! Aber an die wahren Täter werden Sie nicht herankommen.»
Am interessantesten waren für Kappe die Personendaten zu den gesammelten Fällen: Beruf, Alter, Werdegang. Sogar handgeschriebene Lebensläufe lagen bei. Da war der Polizist, bereits 1927 der SA beigetreten. Der Postbote. Der Angestellte einer Bank. Der Hausmeister. Der ehemalige Offizier. Der Werkzeugmacher. Kappe war erstaunt, wie viele SA-Mitglieder zuvor in einem Freikorps tätig gewesen waren. Freikorps waren Soldatenbünde gewesen, die sich in der frühen Weimarer Republik die Ermordung roter Revolutionäre und die Unterminierung der Demokratie zum Ziel genommen hatten. Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht gehörten ebenso zu ihren Opfern wie Matthias Erzberger und Walther Rathenau. Ein Attentat auf Philipp Scheidemann, der die Republik ausgerufen hatte, war gescheitert. Ab 1930 hatten sich diese Menschen oft der SA angeschlossen. Darunter hatten sich manche gemischt, die in der Zeit der Wirtschaftskrise kriminell geworden waren.
Kappe verschloss den Aktendeckel und eilte nach Hause. Sein Bruder Oskar hatte seinen Besuch angekündigt.
Oskar Kappe ließ sich ächzend in der Küche nieder. Das tägliche Stehen im Geschäft war Gift für seine Bandscheiben. «Im nächsten Leben komm ich als Kassenrendant auf die Welt. Da kann ich den lieben langen Tag sitzen.»
«Wie läuft denn das Geschäft?», wollte Klara wissen. Sie kannte seine Klagen schon.
«Es kann nicht besser laufen. Die Kackbraunen rauchen, weil Tabak braun ist. Die anderen rauchen, weil das braune Kraut dabei zu Asche wird. So braucht jeder meine Tabakwaren.»
Klara schloss rasch das Fenster zum Hof, damit niemand die Sprüche ihres Schwagers hörte.
«Doktor Kappe rät: Raucht, bis Berlin im Dunst versinkt! Das hält die Nation zusammen.»
Das Gespräch plätscherte dahin. Klara genoss seine Flachsereien, schenkte ihm einen Märkischen Landmann ein und setzte sich schließlich ihm gegenüber an den Küchentisch.
«Ich muss mit Hermann reden», sagte Oskar Kappe.
«Der müsste ausnahmsweise mal pünktlich nach Hause kommen, denn er freut sich auf deinen Besuch», entgegnete sie. «Er hat den Fall eines Zimmermanns auf dem Tisch, der einige Arbeitskollegen in den Tod geschickt hat.»
Oskar Kappe nickte. «Weiß ich. Als die Braunen heute ihre Stumpen bei mir gekauft haben, haben sie über einen Zimmerer gesprochen, der deutsche Arbeiter ermordet haben soll. Die wussten sogar, dass Hermann für den Fall zuständig ist. Einen Roten haben die ihn genannt. Hermann muss aufpassen. Die werden immer dreister. Als ich sie bat, etwas weniger laut zu sein, weil andere Kunden sich gestört fühlen könnten, sagte einer zu mir: ‹Männeken, Männeken, nicht dass dir dein vorlautes Maul mal leidtut. Denn wer mal auf dem Pflaster saß, der weiß, wie weh das tut, sagt man in Altona.› Dabei hat er gegrinst.»
In diesem Moment betrat Kappe die Wohnung. «Klara, wo ist mein Besuch?»
«Dein Besuch ist auch mein Besuch», rief sie laut. «Dein Bruder ist hier.»
«Schön, dass du Zeit hattest, mal vorbeizukommen, Oskar. Was treibt dich denn hierher?», fragte Kappe.
Oskar schaute ihn nachdenklich an. Dann erzählte er ihm die Begebenheit mit der SA.
Kappe nahm den Vorfall nicht auf die leichte Schulter. «Dieser Tage ist ein Zeuge vor Gericht zu drei Tagen Haft verurteilt worden, weil er es abgelehnt hat, im Gerichtssaal den Arm zum Deutschen Gruß zu heben. Stand in der Mottenpost.»