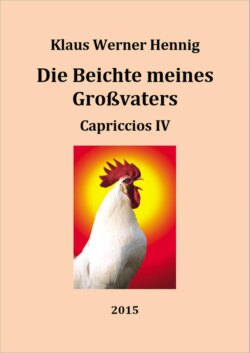Читать книгу Die Beichte meines Großvaters - Klaus Werner Hennig - Страница 3
Die Beichte meines Großvaters
ОглавлениеWährend seiner schweren Krankheit habe ich meinen Großvater täglich besucht. Ich spürte, er wollte sich mir anvertrauen. Er ahnte, bald sterben zu müssen und hatte sich durchgerungen, auf niemanden mehr Rücksicht zu nehmen, am wenigstens auf sich selbst. Ich gebe zu, von meiner Seite waren sowohl Neugier als Wissbegierde im Spiel, letztere vornehmlich, denn Vergangenes von Zeitzeugen zu erfahren, schien mir für meinen Werdegang wichtig. Weshalb sollte es mich nicht interessieren, was sich früher wie, wo und warum mit oder ohne die Beteiligung meines Großvaters zugetragen hatte.
Meine Eltern, beruflich unterwegs, baten mich, meinen Großvater zu besuchen. Er lag im Krankenhaus auf der Intensivstation an Schläuchen und Elektroden. In zyklischen Kurven flimmerte sein messbares Befinden mehrfarbig über den Bildschirm, von rhythmischen Tönen begleitet. Ich mochte da gar nicht hinschauen, verspürte mit einem Mal den eigenen Herzschlag, was mich beträchtlich ängstigte. Schließlich war ich heilfroh, mich nach einer halben Stunde anständig verabschiedet zu haben. Er bat mich, bald wiederzukommen. Ich versprach es. Sonderlich wohl war mir dabei nicht, aber was sollte ich tun? Schließlich war er mein Großvater, meine Eltern waren beide im Ausland unterwegs, meine Geschwister auch nicht am Ort und Freunde oder nahe Verwandte hatte mein Großvater sonst keine mehr, das heißt, sie waren bereits verstorben oder selber krank und bettlägerig.
Am nächsten Tag ging es ihm scheinbar besser. Der Arzt benannte mir seinen Zustand als ernst aber stabil. Die Ausschläge auf dem Bildschirm und die damit verbundenen Piep-Töne wirkten gleichmäßiger. Das beruhigte mich. Ich entnahm einer Tüte, die ich ihm mitgebracht hatte, kernlose Weintrauben, süß und saftig, wusch sie ab und reichte sie auf einem Teller. Er zupfte davon einige Beeren, die er wie Bonbons im Mund behielt.
„Weißt du, mein Kleiner, was mir jetzt alles durch den Kopf schwirrt? An die Schläuche und Drähte gekettet kann ich ja kaum schlafen, dazu müsste ich mich auf den Bauch drehen können.“ Er schaute mich aus wässrigen Augen unbeholfen an, sprach verhalten, aber ich hatte das Gefühl, seine Gedanken waren so klar wie selten zuvor. Als wäre alles in seinem Leben nun bilanziert. Ich wurde verlegen, wusste nicht, was er meinte. Mein Kleiner hatte er zu mir gesagt, so wie in frühen Kindertagen. Da war ich der Kleine. Heute kommt es mir merkwürdig, fast komisch vor, so von ihm Kleiner genannt zu werden, wo ich doch nahezu einen halben Kopf größer bin als alle anderen unserer Familie. Aus Verlegenheit begann ich selbst von den Trauben zu naschen.
„Was ist dir denn durch den Kopf gegangen, Opa?“, fragte ich, um überhaupt etwas zu sagen.
„Lange, lange Geschichten“, winkte er mit der Hand ab. Um ihn abzulenken, erzählte ich, wo sich die Eltern zur Zeit aufhalten, aber er hörte kaum hin, schien mit seinen Gedanken weit weg zu sein. Als ich ging, hatte ich die Weinbeeren nahezu restlos selber vertilgt. Dafür schämte ich mich.
Über Nacht schien sich mein Großvater gemausert zu haben. Er war frisch rasiert und hatte nachgerade auf meinen Besuch gelauert. Er richtete sich sogar ein wenig auf, als er mich freudig begrüßte.
„Es muss während der Weltwirtschaftskrise Ende der zwanziger Jahre gewesen sein, ich ging noch zur Schule“, erzählte er mir sogleich, als habe er sich sorgfältig vorbereitet. „Da war ich mit meinem Vater im ehemaligen Scheunenviertel. Du weißt, die Gegend in Berlin, gleich hinterm Alex, in der Tante Maria seit dem Krieg wohnt. Er hatte dort geschäftlich zu tun. Uns liefen Männer in schwarzen Mänteln mit hohen Hüten auf dem Kopf und langen Locken an den Schläfen über den Weg, für mich seltsam und gruselig anzuschauen. Die mir eingeimpfte Kinderangst vorm schwarzen Mann wirkte. Ich wollte wissen, was das für merkwürdige Gestalten seien. Da sagte mein Vater, das wären streng orthodoxe Juden aus dem fernen Osten, die murmelten ständig rituelle Gebete, sprächen nicht unsere Sprache, hätten nicht unsere Gebräuche und mauschelten in betrügerischen Geschäften. Das Beste sei, mit denen nichts zu schaffen zu haben, sie nähmen letztendlich uns alles, würden immer kecker, heirateten stets ihresgleichen, heckten wie die Karnickel, bauten frech aufwändige Gebetshäuser vor unsere Kirchen und überhaupt, ich hatte das beklemmende Gefühl, von ihren stechenden Blicken, rauschenden Bärten und dem unverständlichen Gelaber bedroht zu sein. Mein Vater bestärkte mich in meinem Schauder und später las ich in einer Zeitung, wie berechtigt meine Furcht wäre, dann stand es bald in jeder Zeitung: Die Juden sind unser Unglück und an die Schaufenster wurde geschmiert: Kauft nicht bei Juden! Juda verrecke!“
Mein Großvater schien außer Atem, röchelte sogar, nahm meinen Arm mit beiden Händen, zog sich daran leicht nach oben und flüsterte in mein Ohr: „Ich war dabei, als auf die Schaufenster der Obst- und Gemüseläden in der Bölschestraße Kauft nicht bei Türken gesprüht worden ist. Darunter ein Halbmond und Kanake verrecke.“ Kraftlos sank er auf das Kissen zurück. Seine Augen flackerten flehentlich, als erbitte er von mir Absolution, und ich fragte mich, ob es nicht angemessen wäre, einen Priester zu holen, wenn ich nicht genau gewusst hätte, mein Großvater wäre sicher der Letzte, an einen Gott zu glauben, geschweige an sich ein religiöses Zeremoniell zu erdulden.
Die Schwester kam herein. Eine strenge, dunkelhaarige Schönheit. Auf meine besorgte Frage schüttelte sie beruhigend den Kopf und ihre schwarzen Augen strahlten in mildem Glanz. Nein, seit seiner Einlieferung sei mein Großvater fieberfrei. Warum war ich von ihrer Stimme so berührt? Trotzdem, sie beruhigte mich nicht, denn in einem solchen Zustand kannte ich meinen Großvater nicht. Schließlich bin ich weder Arzt noch Seelsorger. Ich befürchtete, sein letztes Stündlein sei gekommen. Ich überlegte, meine Eltern zu alarmieren, sie umgehend an sein Krankenbett zu bitten. Aber zu Hause war ich wieder gefasst, sah keinen Grund, in Panik zu verfallen. Sicherlich belastete meinen Großvater das vorhin Geschilderte furchtbar, wenn man bedenkt, wie alles mit den Juden in Deutschland angefangen und wohin es geführt hatte und nun das Gleiche in Grün mit den Moslems? Die Juden fressen mittags Neugeborene, pissen abends in die Taufbecken, behaupten, wir seien nicht koscher und vergiften nachts unsere Brunnen. Die Türken nehmen uns die Arbeit, beschimpfen uns als Ungläubige, unterstellen uns Fremdenfeindlichkeit, basteln an monströsen Kofferbomben, möchten einen Gottesstaat errichten, verschachern ihre Töchter, schlagen ihre Frauen und wickeln sie lebenslang in graue Tücher ein.
Am nächsten Tag hätte ich einen guten Grund gehabt, meinen Großvater nicht zu besuchen. Ich sollte auf Dienstreise in eine andere Stadt, bat aber meinen Chef, für einige Zeit nur am Ort tätig sein zu dürfen, denn auf meine Art war ich meinem Großvater sehr verbunden. Mein erstes Angelzeug habe ich von ihm, den Unterschied zwischen Knüttepfriem und Knüttespune zum Netzflicken, sowie zwischen Flügelreuse und Ballreuse für den örtlichen Fang von ihm gelernt, einen Fischhälterkasten aus Eichenholz hat er mir gebaut und aus Weidenruten einen Aalkorb geflochten, mit dem ich allerdings niemals auch nur einen Aal erwischte. Der Wels, den mein Großvater einst aus dem Wasser gezogen haben wollte, wurde in seinen Erzählungen von Jahr zu Jahr größer und schwerer. Trotzdem, vom Angeln und Fischen wusste er eine Menge von seinem Großvater wiederum, der noch Fischer in Ketzin im Havelland gewesen war. Außerdem hat mein Großvater mir Rad fahren, Skat dreschen, Pokern und, was meine Eltern bis heute nicht wissen sollten, vorzeitig Auto fahren beigebracht. Schließlich hatten wir gemeinsam eine richtige Höhle gebaut, in der ich fast aufrecht stehen konnte. Davor kauernd las er mir aus Robinson Crusoe und aus Der Schatz im Silbersee vor, und wenn ich etwas in der Nachbarschaft ausgefressen oder in der Schule verpatzt hatte, war mein Großvater die von mir bevorzugte Anlaufstelle. Immer stand er mit Rat und Tat für seinen Kleinen parat.
Erleichtert stellte ich fest, meinem Großvater ging es entschieden besser. Er war sogar guter Laune und zu Scherzen aufgelegt. Trotzdem fragte ich ihn unvermittelt, warum er mitgetan habe, türkische Geschäfte in Friedrichshagen zu beschmieren.
„Wie kommst du darauf?“, empörte er sich und richtete sich ruckartig auf. Fast hätte er sämtliche Schläuche und Elektroden abgerissen. Die Kurven auf dem Bildschirm tanzten über die Grenzwerte hinaus, und aus dem Lautsprecher quiekte ein durchdringender Alarmton, der mir gewaltig auf die Nerven ging.
„Ich habe doch dabei nicht mitgetan, nie im Leben!“, ereiferte er sich. „Ich habe lediglich beobachtet, wie Rowdys sich an den Läden zu schaffen machten.“ Versöhnlich legte er sich auf das Bett zurück, atmete aber vergleichsweise unruhig. „Dein Großvater ist doch kein Fassadensprayer!“
„Dann habe ich dich missverstanden, entschuldige Opa“, versuchte ich ihn zu beruhigen. Aus dem Überwachungssystem tönte kein Alarm mehr.
„Du hast ja recht“, gestand mein Großvater reumütig ein. „Ich habe nichts dagegen unternommen, weder mit meinem Krückstock dazwischen gehauen, noch die Polizei verständigt. Vielleicht habe ich sogar gedacht, weshalb müssen diese Türken den gesamten Obst- und Gemüsehandel an sich reißen und die einheimischen Händler aus dem Markt drängen? Ist das nötig, habe ich gedacht. Und das Bürgerbegehren gegen den Bau einer Moschee in Pankow“, beichtete er kleinlaut und blickte beschämt zur Seite, „habe ich auch unterschrieben.“
Dem wird sowieso nicht stattgegeben, davon war ich überzeugt, es verstieße ja gegen das Grundrecht der Glaubens- und Bekenntnisfreiheit. Zu meinem Großvater aber bemerkte ich bloß: „Pankow? Wann kommst du denn nach Pankow?“
„Wann komme ich schon nach Pankow“, druckste er schuldbewusst. „Erst missfällt einem das Äußere, wie sie sich kleiden, dann ihr Gehabe, wie sie sich geben, dass sie nach Knoblauch riechen, unter sich bleiben wollen, nur ihre Sprache sprechen, ihre Geschäfte machen, ihresgleichen bevorzugen, sich Gotteshäuser wie Paläste bauen – dann sollen sie runter von den Bürgersteigen, dürfen in kein Kino, kein Theater mehr hinein, nicht mit der Straßenbahn fahren, nicht in den Parkanlagen sitzen, die Wälder nicht mehr betreten, und schließlich“, mein Großvater richtete sich auf und hob warnend die Hand, „brennen ihre Bücher, ihre Läden, ihre Moscheen und schlussendlich sie selbst am eigenen Leib. Genauso ist es gewesen, ich habe das erlebt! Und so käme alles wieder, wenn nicht ...“
„Aber Opa, was redest du da?“ Ich schaute ihn vorwurfsvoll an.
„Wie neulich in Rheinsberg“, fuhr er unbeirrt fort. „Eine Gruppe Jugendlicher vorm Dönerstand, der Rädelsführer beißt in sein Döner Kebap, greift sich zum Mund und zieht einen Rattenschwanz an zwei Fingern zwischen seinen Zähnen hervor. ‘Der Türke verfüttere Rattenfleisch an uns Deutsche!’, schrie der Taschenspieler den Passanten zu, beugte den Oberkörper weit nach vorn und schien sich zu erbrechen. Seine Kumpane machten die Wurstbude binnen Minuten platt, schlugen den armen Mann, der eine Frau, vier Kinder, seine Mutter und eine Schwester zu versorgen hat, krankenhausreif! Die Leute starrten vernarrt, als sähen sie einen Kinofilm und keiner rief die Polizei!“
Jetzt dreht er völlig durch, befürchtete ich, legte ihm meine Hand leicht auf den Mund, gebot ihm zu schweigen. Das Überwachungssystem flackerte und gellte in einer Tour. Kommt denn hier keiner?, wollte ich aus dem Zimmer über den Flur schreien.
„Du siehst zu schwarz, Opa“, versuchte ich ihn zu beruhigen, gab ihm zu trinken. Er schluckte gierig, als wäre er am Verdursten. „Mit Gammelfleisch wird heutzutage allerorten Schindluder getrieben“, gab ich zu bedenken.
„Nein“, flüsterte er ermattet, „eine alte Frau bezeugte bei der Polizei, der Rechtsradikale habe sich den Rattenschwanz aus seinem Ärmel gezogen.“ Ich spürte, mein Großvater wollte mir so viel sagen, aber mir wäre lieber, er bliebe gelassen im Bett liegen und spräche jetzt über nichts, was ihn aufregen könnte.
„Nimm Schwester Ayrun, die mich betreut, eine Kurdin aus der Türkei, als Beispiel.“ Sein Blick verschleierte sich, als verstiege er sich in jugendlicher Schwärmerei zu einer Madonna, die ihn bekehrt habe. „Eine so klare und reine Seele“, himmelte er weiter. Mein Großvater, ein alter Mann, wie peinlich.
„Ist das nicht ein christliches Krankenhaus?“ – Ich wollte seinen Enthusiasmus dämpfen. – „Schließlich liegt auf deinem Nachttisch das Neue Testament, über deinem Bett hängt ein Kreuz, im Flur sind Sprüche aus der Bergpredigt und dich betreut eine Muslima? Das glaubst du doch selber nicht?“
„Aber sicher! Wahrscheinlich arbeitet sie kostengünstiger, kriegt womöglich nur den halben Lohn“, vermutete mein Großvater und versuchte mir zu verdeutlichen, wie liebe- und hingebungsvoll nur sie alte Menschen bei aller Hektik und Routine dieses Hauses pflege und behandle.
Da kam die besagte Schwester Ayrun zur Tür herein. Na klar, die gestrenge, dunkelhaarige Schönheit. Ich sah sie nun mit anderen Augen. Sie entschuldigte sich, es wären zwei Neuzugänge zu versorgen gewesen. Sie wusch meinen Großvater im Gesicht, am Hals, unter den Achseln; die Brust, den Bauch, zwischen den Beinen, alles sehr behände, trotzdem gründlich und trocknete ihn sorgfältig ab; auch die Füße. Er gab sich willig der Behandlung hin, als genösse er sie nahezu erotisch, ließ sich ohne Gezeter die Zahnprothese aus dem Munde nehmen, die restlichen Zähne putzen, die Haare bürsten, die Ohren säubern, den Rücken mit Franzbranntwein abreiben. Ich wollte ihr dabei helfen. Sie wies mich dankbar lächelnd ab, es sei ihr Job, aber sie lobte mich sehr, weil ich täglich meinen Großvater besuchte. Das wäre in Deutschland leider nicht alltäglich, sagte sie ohne Häme. Ich nickte und hatte die Hoffnung, mein Großvater werde bei dieser Pflege das Krankenhaus baldigst verlassen können. Fast bedauerte ich dies.
Nach Mitternacht klingelte das Telefon. Schwester Ayrun teilte mir mit, mein Großvater sei soeben verstorben. Allah war ihm gnädig, sagte sie so selbstverständlich, dass ich nicht widersprach.
Er lag friedlich im Bett, die Schläuche und Elektroden waren entfernt, die Augen geschlossen, die Hände mit dem Kreuz von der Wand über der Brust gefaltet. Ich schob eine weiße Rose aus unserem Garten unter die Hände. Als ich ihn andächtig auf die Stirn küsste, sah ich auf dem Nachttisch neben der Bibel den Koran in deutscher Übersetzung. Hinter mir stand Schwester Ayrun. Ich hatte sie nicht hereinkommen hören. Sie erzählte mir, mein Großvater habe gestern Abend noch lange mit ihr gesprochen. Er habe von ihr alles über die Kurden in der Türkei, in Syrien, im Irak und wie sie in Deutschland lebten wissen wollen, und sie um einen Koran gebeten. Ob er darin gelesen habe, wisse sie nicht. Ich bat sie, mir das Buch auszuleihen.
Bis zur dritten Sure las ich aufmerksam, danach habe ich bloß geblättert. Ich verabredete mich mit Schwester Ayrun, um ihr das Heilige Buch zurückzugeben. Wir trafen uns in einem Café und sprachen stundenlang über Gott und die Welt, von Abraham bis Madonna, schauten uns lange in die Augen, ich versank in den ihren, hing wie gebannt an ihren Lippen.
Ich habe ... Sie hat ...
Wir haben ein halbes Jahr später geheiratet, standesamtlich. Ob und wie meine Eltern, ihre Eltern, ihre Geschwister, meine Geschwister das verdaut haben, ist eine andere Geschichte.
Nur eins ist gewiss, mein Großvater wäre in höchstem Maße beglückt gewesen.