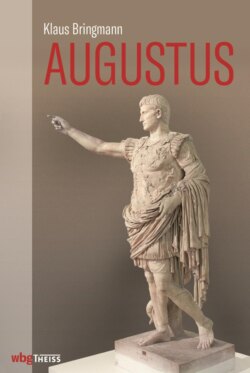Читать книгу Augustus - Klaus Bringmann - Страница 10
I. Kindheit und Jugend 1. Der familiäre und zeitgeschichtliche Hintergrund
ОглавлениеDer Mann, der unter dem Ehrennamen Augustus (der Verehrungswürdige) in die Geschichte einging, wurde am 23. September 63 v. Chr. als Gaius Octavius in Rom geboren. Die Familie des Vaters1 stammte aus Velitrae, einer am Südhang der Albanerberge gelegenen Landstadt.2 Die ursprünglich volskische Gemeinde, deren Sprache nicht das Lateinische war, wurde am Ende des Latinerkrieges (340–338 v. Chr.) von den Römern erobert. Die führenden Familien der Stadt wurden deportiert, und auf ihren Ländereien wurden römische Kolonisten angesiedelt, die dem im Jahre 332 v. Chr. gegründeten Stimmbezirk der tribus Scaptia angehörten. Velitrae wurde eine sich selbst verwaltende Gemeinde im römischen Bürgerverband, ein municipium civium Romanorum, dessen politisch führende Klasse, ganz so wie der Senatorenstand in Rom, eine landbesitzende Aristokratie war. Zu ihr gehörten von Alters her die Octavier. Im Zweiten Punischen Krieg brachte es ein Mitglied der Familie bis zum Praetor, dem zweithöchsten Amt des römischen Staates.3 Der gleichnamige Sohn dieses Gnaeus Octavius wurde, nachdem er als Flottenbefehlshaber im Dritten Makedonischen Krieg nach der Schlacht bei Pydna (168 v. Chr.) König Perseus auf Samothrake gefangengenommen hatte, im Jahre 165 v. Chr. sogar Konsul.4 Damit war dieser Zweig der Octavier in den inneren Machtzirkel der Senatsaristokratie, die so genannte Nobilität, die aus den Familien ehemaliger Konsuln bestand, aufgestiegen, und seine Nachkommen hatten so gute Chancen, dass sie, immer vorausgesetzt, dass sie willens und in der Lage waren, sich den harten Anforderungen der Ämterlaufbahn zu stellen, ebenfalls den Konsulat erreichten. Tatsächlich gelang dies insgesamt viermal, nämlich in den Jahren 128, 87, 76 und 75 v. Chr.5 Der letzte Octavier aus diesem Zweig der Familie kämpfte auf Seiten der Republikaner gegen Caesar und fand in Nordafrika den Tod, ohne die höchsten Ämter, Praetur und Konsulat, erreicht zu haben.6
Die jüngere Linie, aus der Augustus stammte, blieb in Velitrae. Dort gehörte sie zu den führenden Familien, begnügte sich mit den lokalen Ehren und mehrte ihren Reichtum. Von Augustus’ Großvater ist überliefert, dass er in Velitrae die Munizipalämter bekleidete und bei großem Reichtum in zurückgezogener Behaglichkeit ein hohes Alter erreichte.7 Der Vater war der erste, der den Sprung auf die Bühne der stadtrömischen Politik wagte. Wie üblich erleichterten Geld, lokaler Einfluss, Beziehungen zur stadtrömischen Aristokratie und die Ehe mit der Tochter eines Senators den Aufstieg des Neulings in die regierende Klasse. Gaius Octavius heiratete in zweiter Ehe Atia, die Tochter des aus dem benachbarten Aricia stammenden Marcus Atius Balbus und der Iulia, einer Schwester Caesars.8 Aus dieser Ehe gingen zwei Kinder hervor: Gaius Octavius, der spätere Augustus, und als Erstgeborene die jüngere Octavia. Aus einer ersten Ehe des Vaters stammte noch eine weitere Tochter, die ältere Octavia. Um das Jahr 70 v. Chr. wurde Augustus’ Vater zum Quaestor gewählt, und mit dem Erreichen dieser ersten Stufe der Ämterlaufbahn wurde er lebenslanges Mitglied des Senats. Spätestens im Jahre 64 v. Chr. bekleidete er das Amt eines Aedilen und im Jahre 61 v. Chr. die Praetur, das Amt der obersten Gerichtsherren Roms. Dann folgte die Statthalterschaft der Provinz Macedonia, wo er nach einem Sieg über den thrakischen Stamm der Bessi von seinen Soldaten zum Imperator ausgerufen wurde.9 Damit erfüllte er die Voraussetzung für die Zuerkennung eines Triumphs, der höchsten Ehre, die der Senat für seine siegreichen Feldherren zu vergeben hatte, und auch bei der Erfüllung seiner zivilen Aufgaben in Rechtsprechung und Verwaltung hat er sich offenbar bewährt. Als Cicero an seinen Bruder Quintus, der als Propraetor die Provinz Asia verwaltete, eine lange Denkschrift richtete, wies er ihn auf das Vorbild hin, das Gaius Octavius als Praetor und Statthalter gegeben hatte.10 Der Lohn für die Bewährung, Triumph und Konsulat, blieb ihm freilich vorenthalten. Bei der Rückkehr aus seiner Provinz starb er plötzlich und unerwartet im kampanischen Nola (Sommer 59 v. Chr.).
Die Mutter heiratete ein Jahr später einen Angehörigen der Nobilität, Lucius Marcius Philippus, der im Jahre 56 v. Chr. den Konsulat bekleidete.11 In dessen Haus wuchs der junge Octavius zusammen mit Mutter und Schwester, vielleicht auch mit einem seiner beiden Stiefbrüder, dem jüngeren Sohn seines Stiefvaters aus erster Ehe,12 auf. Seinen leiblichen Vater kann er kaum gekannt haben. Dieser hinterließ dem Sohn ein stattliches Vermögen – und über die Großeltern mütterlicherseits verwandtschaftliche Beziehungen zu den beiden Politikern und Feldherren, die zu Totengräbern der römischen Republik werden sollten, zu Pompeius und Caesar. Der junge Octavius war Caesars Großneffe, seine Großmutter Iulia, Caesars Schwester, hatte in die Familie der Atii Balbi eingeheiratet, und ihr Schwiegervater, der ältere Atius Balbus, war über seine Frau Lucilia, eine Nichte des berühmten Dichters Lucilius, mit Pompeius’ Vater verschwägert. Sie alle gehörten der Klasse reicher Grundbesitzer an, die mit Ausnahme der Familie Caesars erst im zweiten beziehungsweise in der ersten Hälfte des ersten Jahrhunderts v. Chr. in die römische Senatsaristokratie aufgestiegen waren. Was Caesars Familie anbelangt, gehörte sie zwar einem Geschlecht des uralten Geburtsadels der Patrizier an, hatte aber, nach langer Bedeutungslosigkeit, erst wieder in der Generation seines Vaters damit begonnen, einen Platz in dem engeren Machtzirkel der Nobilität zurückzugewinnen. Caesars Onkel Sextus war im Jahre 91 Konsul, ein anderer Verwandter, Lucius Caesar, spielte ein Jahr später, ebenfalls als Konsul, eine bedeutende Rolle bei der Beendigung des Bundesgenossenkriegs, indem er das Gesetz einbrachte, das den Bundesgenossen den Zugang zum römischen Bürgerrecht öffnete.13 Drei Jahre später krönte er seine Karriere mit der Zensur. Caesars Vater hatte es allerdings nur bis zum Praetor gebracht. Durch die Verheiratung seiner Schwester, der Tante Caesars, hatte er ein Familienbündnis mit Gaius Marius geschlossen, der als Sieger über den numidischen König Jugurtha und den germanischen Wanderverband der Kimbern und Teutonen einen kometenhaften Aufstieg nahm. Aber dem Aufstieg folgte im Jahre 100, Caesars Geburtsjahr, Marius’ tiefer Absturz. Als er sich dann im Jahre 87 im Bündnis mit Lucius Cornelius Cinna gewaltsam die Rückkehr zur Macht bahnte, gehörten Lucius Caesar, der es bis zum Konsul und Zensor gebracht hatte, und sein Bruder Gaius Caesar mit dem Beinamen Strabo zu den ersten blutigen Opfern des Umsturzes. Gleichwohl wurde der junge Caesar, der spätere Diktator, mit Cornelia, der Tochter des Lucius Cornelius Cinna, verheiratet. Aber dieser starb bereits im Jahre 84, und seine Partei unterlag dem mit seinem Heer aus dem Osten zurückkehrenden Lucius Cornelius Sulla, der seine Gegner ächtete und ein Blutbad unter ihnen anrichtete. Caesar kam mit dem Leben davon, obwohl er sich weigerte, die Tochter Cinnas zu verstoßen. Wie andere Angehörige der Aristokratie auch wurde er durch familiäre Fürsprache gerettet, und obwohl er im Kreis der von Sulla an die Macht gebrachten Bürgerkriegspartei mit Misstrauen betrachtet wurde, so verstand er es doch mit bemerkenswertem Geschick, nach Sullas Tod Vorteile aus der Auflösung der sullanischen Ordnung zu ziehen und seine Karriere zu befördern. Im Jahre 63 v. Chr., dem Geburtsjahr seines Großneffen Gaius Octavius, wurde er zum obersten Repräsentanten der römischen Staatsreligion, zum Pontifex maximus, und zum Praetor für das kommende Jahr gewählt.
Das Jahr 63 war überhaupt ein denkwürdiges Jahr.14 Pompeius organisierte damals nach seinem Sieg über die Könige Mithradates von Pontos und Tigranes von Armenien die römische Herrschaft vom Schwarzen Meer bis zu den Grenzen Ägyptens neu und verschaffte dem römischen Staat, abgesehen von der unermesslichen Beute, regelmäßige Einnahmen, deren Höhe die aus den älteren Provinzen überstiegen. Während Pompeius im Osten wie ein König schaltete und waltete, war der Konsul Marcus Tullius Cicero in Rom und Italien mit einem bewaffneten Putschversuch konfrontiert. Er ging aus von Lucius Sergius Catilina, der im Sommer zum zweiten Mal bei den Konsulwahlen durchgefallen war. Er fand Anhänger in der Aristokratie ebenso wie in den städtischen und ländlichen Unterschichten, nicht zuletzt auch unter den Veteranen, die Sulla in den Städten Italiens angesiedelt hatte. Die Bereitschaft zum Putsch, die erfolglose Amtsbewerber, Nutznießer und Opfer der sullanischen Proskriptionen, Tagelöhner auf dem Land und Gelegenheitsarbeiter in Rom miteinander verband, wurde von der weitverbreiteten Verschuldung gefördert, mochte diese aus dem Aufwand für Ämterbewerbung und luxuriöse Lebensführung oder aus der schlichten Unmöglichkeit resultieren, aus Besitz oder Arbeit ein hinreichendes Einkommen zu erzielen. Dies war die Kehrseite des aus den Ressourcen eines Weltreichs in den Händen einer kleinen Minderheit akkumulierten Reichtums. Als Sallust seine zweite Karriere, die des Geschichtsschreibers, nach der Ermordung des Diktators Caesar mit seiner Darstellung der Catilinarischen Verschwörung eröffnete, knüpfte er seinen Exkurs über den Parteienkampf in Rom an eine Betrachtung über den Kontrast zwischen der imponierenden äußeren Expansion und der inneren Krise Roms an, wie er in seiner, der Sicht eines Zeitgenossen, im Jahre 63 exemplarisch zutage getreten war:
„Zu dieser Zeit erschien mir das Imperium des römischen Volkes bei weitem am beklagenswertesten. Obwohl ihm vom Aufgang bis zum Untergang der Sonne alles, mit Waffen bezwungen, gehorchte, im Inneren Ruhe und Reichtümer, was Sterbliche für die höchsten Güter halten, im Überfluss vorhanden waren, gab es dennoch Bürger, die mit verhärtetem Sinn darangingen, sich und den Staat zugrunde zu richten. Denn trotz der beiden Senatsbeschlüsse hatte aus der Masse (der an dem Umsturzversuch Catilinas Beteiligten) kein einziger, durch die (ausgesetzte) Belohnung veranlasst, die Verschwörung enthüllt, noch hatte irgendeiner von ihnen das Lager Catilinas verlassen: So groß war die Stärke der Krankheit, die wie eine Seuche die Gemüter vieler Bürger befallen hatte.“15
Caesar hatte in der entscheidenden Senatssitzung vom 5. Dezember davor gewarnt, die gefangenen und der Verschwörung überführten Catilinarier ohne Gerichtsurteil hinrichten zu lassen, und statt dessen vorgeschlagen, sie bis auf weiteres in Sicherheitsverwahrung zu nehmen, bis ihnen nach Beruhigung der Lage der Prozess gemacht werden könne. Doch drang er mit seinem sachlich wohlbegründeten Votum nicht durch, und beim Verlassen der Kurie wurde er von der aus jungen Angehörigen des Ritterstandes gebildeten Leibgarde des Konsuls Marcus Cicero mit dem Tode bedroht:16 Die Stimme der Vernunft hatte keinen Platz in der angsterfüllten Atmosphäre des Tages. Die Catilinarische Verschwörung wurde niedergeschlagen, aber ihre Nachwirkungen machten das ländliche Italien, insbesondere den Süden, noch unsicherer, als er durch die aus Sklaven, Enteigneten und Verschuldeten rekrutierten Banden ohnehin schon war. So wurde Octavius’ Vater vom Senat damit beauftragt, auf dem Weg in seine Provinz Macedonia im Gebiet von Thurii (im heutigen Kalabrien am Golf von Tarent gelegen) die Reste der Gefolgschaft des Spartacus, der den Sklavenaufstand der Jahre 73 – 71 angeführt hatte, und des Catilina zu vernichten.17 Von dieser erfolgreichen Polizeiaktion seines Vaters erhielt das Kind den scherzhaften Beinamen „Thurinus“, der soviel bedeutet wie „Sieger von Thurii“ – nach Analogie der berühmten Siegerbeinamen wie beispielsweise Africanus, Macedonicus, Numidicus. Der „Sieg“ des Vaters über Banden, die das Land terrorisierten, reichte freilich nur zu einem Scherz. Ideelles Kapital war daraus nicht zu gewinnen – im Gegenteil: Als Gaius Octavius später einen anderen Namen, den Caesars, trug und mit Marcus Antonius um die Macht rivalisierte, verspottete dieser den wenig eindrucksvollen Heerführer als „Sieger von Thurii“, und schließlich wurde aus dem Beinamen die Mär von einer obskuren Herkunft der Familie aus Thurii gesponnen.18
Für den zeitgeschichtlichen Hintergrund und für den Lebensweg des jungen Gaius Octavius sollten freilich nicht die Catilinarische Verschwörung und ihre Nachwirkungen, sondern das fatale Bündnis bedeutsam werden, das im Jahre 60 v. Chr. seine beiden Verwandten, sein Großonkel Gaius Iulius Caesar und der mit seinem Großvater mütterlicherseits verschwägerte Gnaeus Pompeius Magnus, unter Einbeziehung des reichen, an unbefriedigtem Ehrgeiz leidenden Marcus Licinius Crassus schlossen. Der Grund des Bündnisses, des sogenannten Ersten Triumvirats, war, dass sowohl der aus dem Osten siegreich zurückgekehrte Feldherr Pompeius als auch der für das Jahr 59 zum Konsul gewählte Iulius Caesar nur in einem gemeinsamen Vorgehen eine Chance sahen, ihre politischen Ziele durchzusetzen und so das drohende Ende ihrer politischen Laufbahn zu verhindern. Was Crassus anbelangt, so witterte er für seine Ambitionen Morgenluft und ließ sich trotz seiner Eifersucht auf Pompeius von Caesar für das Bündnis gewinnen, das auf der Generalklausel beruhte, dass keiner der Drei etwas gegen das Interesse seiner Verbündeten unternehmen dürfe.19 Die vitalen Interessen, um die es ging, waren folgende: Pompeius konnte gegen die Mehrheit des Senats weder die Versorgung seiner demobilisierten Soldaten mit Bauernstellen noch die Ratifikation der Verfügungen durchsetzen, die er im Osten getroffen hatte. Der Feldherr, der auf den Spuren Alexanders des Großen gewandelt war, zeigte sich dem politischen Kleinkrieg in Rom nicht gewachsen und drohte gegenüber seiner Klientel das Gesicht zu verlieren. Das hätte sein politisches Ende bedeutet, und eben deswegen wurden alle seine ungeschickten Bemühungen, seine Ziele durchzusetzen, von den Gegnern blockiert, denen seine die Grenzen des Amtsrechts sprengende Karriere und die Akkumulierung von Macht und Einfluss längst ein Dorn im Auge waren. Auch Caesar war in einer Zwangslage. Zwar war es ihm gelungen, zum Konsul gewählt zu werden, aber seine Gegner im Senat hatten ihm einen Amtsbereich zugewiesen, der weder Ruhm noch finanziellen Gewinn versprach – er sollte eine Revision der in Italien gelegenen staatlichen Viehtriften und Weidewege vornehmen. Auf finanziellen Gewinn aber war er schon deshalb angewiesen, weil er die zur Bestechung der Wähler aufgenommenen Schulden zurückzahlen musste. Was Caesar darüber hinaus anstrebte, waren die Mittel, die Pompeius groß gemacht hatten: einen umfangreichen militärischen Aufgabenbereich, einen Krieg, der ihm eine ergebene Armee, Beute, Macht und Einfluss einbrachte. Er war gewillt, die Versorgung der Veteranen des Pompeius und die Ratifikation der Anordnungen, die dieser im Osten getroffen hatte, auf Biegen und Brechen durchzusetzen, wenn als Gegenleistung ein außerordentliches Kommando für ihn selbst dabei heraussprang. Der Dritte im Bunde, Crassus, der über großen Reichtum und entsprechenden Einfluss verfügte, hatte sich dem Bündnis mit der Aussicht angeschlossen, später zum Zuge zu kommen. Als es soweit war, im Jahre 55 v. Chr., und er seinerseits mit der Provinz Syrien eine Option auf einen großen Krieg gegen die Parther im Zweistromland erhielt, bezahlte er den vom Zaun gebrochenen Krieg mit seiner Niederlage in der Schlacht bei Carrhae und seinem Tod (53 v. Chr.).
Caesar setzte in seinem Konsulatsjahr unter Gewaltanwendung und Rechtsbrüchen das Gesetzgebungsprogramm durch, auf das sich die Verbündeten geeinigt hatten, und ihm wurden das in der Poebene gelegene Diesseitige Gallien mit dem Illyricum an der Ostküste der Adria und das Jenseitige Gallien als Provinz zugewiesen. Das Machtkartell der drei Verbündeten hatte Stellen, Geld und Karrierechancen zu vergeben, und es gab genug Angehörige der beiden Stände, aus denen sich die römische Oberschicht zusammensetzte, des Senatoren- und des Ritterstandes, die sich zur Unterstützung des Dreibundes gewinnen ließen. Zu ihnen gehörte Octavius’ Großvater mütterlicherseits, Caesars Schwager Marcus Atius Balbus. Er trat in die aus 20 Mitgliedern bestehende Kommission ein, deren Aufgabe die Landverteilung gemäß den umstrittenen beiden Agrargesetzen Caesars war, und beteiligte sich, so erfahren wir, an der Landverteilung in Kampanien.20 Ob Octavius’ Vater sich ebenfalls dem Machtkartell angeschlossen hätte, wenn er am Leben geblieben wäre, können wir nicht wissen. Für eine solche Annahme spräche die ihm zugeschriebene Absicht, sich nach seiner Rückkehr aus seiner Provinz um den Konsulat zu bewerben.21 Zu Recht ist gesagt worden, dass in Rom das Kernstück einer Partei die Familie und ihre verwandtschaftlichen Beziehungen waren,22 und so liegt die Annahme immerhin nahe, dass Gaius Octavius seine Kandidatur im engen Anschluss an das Machtkartell des Dreibundes betrieben hätte. Aber andererseits wirkten die brutalen Methoden, mit denen Caesar den Widerstand der Optimaten gebrochen hatte, polarisierend bis in die Familien der Aristokratie hinein. Gegen die Anhänger der Triumvirn, die sich ihnen um der eigenen Sicherheit oder des eigenen Vorteils willen angeschlossen hatten, stand der harte Kern der Senatsaristokratie, der für die kollektive Herrschaft des Senats unter Führung der alten Familien der Nobilität einstand. Gaius Octavius war, wie die Bemerkungen Ciceros zeigen, auch bei denen, die sich vom Machtkartell des Dreibundes fernhielten, ein hochangesehener Mann, und so ist zumindest nicht auszuschließen, dass er sich von dem anrüchigen Bündnis ferngehalten hätte.
Aber wie dem auch sei: Der Gegensatz zwischen dem Dreibund und den Optimaten war nicht die einzige Konstante, die die stadtrömische Politik in den fünfziger Jahren bestimmte. Rom wurde in Atem gehalten von den Umtrieben des Publius Clodius, der im Jahre 58 v. Chr. mit Hilfe der Triumvirn Volkstribun geworden war, sich jedoch von seinen Ziehvätern emanzipierte und es verstand, das Stadtvolk gegen Pompeius zu mobilisieren. Gewalt und Gegengewalt beherrschten die Szene, und mehr als einmal erwies es sich als unmöglich, die Wahlen der städtischen Magistrate ordnungsgemäß durchzuführen. Wer dem Chaos der Tagespolitik anhand der Briefe Ciceros folgt, mag geneigt sein, sich dem unübertrefflich formulierten Urteil Theodor Mommsens anzuschließen: „Man könnte ebenso gut ein Charivari auf Noten setzen als die Geschichte dieses politischen Hexensabbats schreiben wollen; es liegt auch nichts daran, all die Mordtaten, Häuserbelagerungen, Brandstiftungen und sonstigen Räuberszenen inmitten einer Weltstadt aufzuzählen und nachzurechnen, wie oft die Skala vom Zischen und Schreien zum Anspeien und Niedertreten und von da zum Steinewerfen und Schwerterzücken durchgemacht ward.“23
In diese unruhige Zeit zwischen dem Tod des Vaters und dem Ausbruch des Bürgerkriegs zwischen Caesar und Pompeius im Jahre 49 v. Chr. fiel die Kindheit des jungen Gaius Octavius. Er verbrachte sie im Haus seines Stiefvaters Lucius Marcius Philippus. Dieser gehörte wie schon sein Vater zu den nicht wenigen Angehörigen der regierenden Klasse, die sich im Streit der Parteien vorsichtig zurückhielten und es nach Möglichkeit vermieden, bei irgendeiner Seite Anstoß zu erregen. Auf diese Weise hatte er sein Konsulatsjahr (56 v. Chr.), in dem Caesar den gefährlichen Versuch seiner Gegner, den Dreibund zu sprengen, in letzter Minute vereitelt hatte, unbeschädigt überstanden. Als im Januar 49 der Bürgerkrieg ausbrach, blieb er, zumindest nach außen hin, neutral. Doch im Geheimen stand er wohl im Einverständnis mit Caesar, dem sehr daran gelegen war, dass möglichst viele Angehörige der Senatsaristokratie sich nicht mit der Regierung und Pompeius gegen ihn solidarisierten. Sein Sohn war bei Ausbruch des Bürgerkrieges Volkstribun und konnte es nicht ganz vermeiden, Flagge zu zeigen, als im Januar 49 die Beschlüsse zur Abberufung Caesars gefasst wurden. Er interzedierte in einer untergeordneten Angelegenheit gegen einen dieser Beschlüsse,24 hielt sich aber in allen entscheidenden Punkten zurück. Die durchtriebene Vorsicht war der Familie, in der Gaius Octavius aufwuchs, zur zweiten Natur geworden. Marcius Philippus hatte durch die Heirat mit Atia eine Familienverbindung mit Caesar geknüpft, aber er hatte seine Tochter aus erster Ehe dem schärfsten Gegner Caesars, dem jüngeren Cato, zur Frau gegeben. Wie immer der Streit der Parteien ausgehen mochte, worauf es ankam, war, dass der Rang der Familie unbeschädigt blieb und sie letzten Endes auf Seiten der stärkeren Bataillone stand. In diesem Milieu verbrachte der junge Gaius Octavius seine Kindheit und frühe Jugend, und es lässt sich mit gutem Grund vermuten, dass sich im Haus seines Stiefvaters gewisse Grundzüge seines Wesens ausbildeten, die eine Voraussetzung seines späteren politischen Aufstiegs waren: die mit einem ausgeprägten Machtinstinkt verbundene durchtriebene Vorsicht.