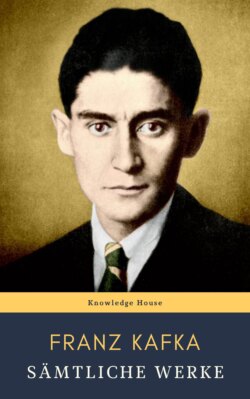Читать книгу Franz Kafka: Sämtliche Werke - Franz Kafka, Franz Kafka, Knowledge house - Страница 56
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Erstes Kapitel des Buches „Richard und Samuel“
Оглавлениеvon Max Brod und Franz Kafka
[veröffentlicht 1912 in Herderblätter, Prag]
Unter dem Titel „Richard und Samuel – Eine kleine Reise durch mitteleuropäische Gegenden“, wird ein Bändchen die parallelen Reisetagebücher zweier Freunde verschiedenartigen Charakters enthalten.
Samuel ist ein weltläufiger junger Mann, der mit vielem Ernst sich Kenntnisse im großen Stil und ein richtiges Urteil über alle Gegenstände des Lebens und der Kunst zu bilden bestrebt ist, ohne doch jemals nüchtern oder gar pedantisch zu werden. Richard hat keinen bestimmten Interessekreis, läßt sich von rätselhaften Gefühlen, noch mehr von seiner Schwäche treiben, zeigt aber in seinem engen und zufälligen Kreise so viel Intensität und naive Selbstständigkeit, daß er nie zu schrullenhafter Komik ausartet. Dem Berufe nach ist Samuel Sekretär eines Kunstvereines, Richard Bankbeamter. Richard hat Vermögen, arbeitet nur, weil er sich nicht für fähig hält, freie Tage zu ertragen; Samuel muß von seiner (überdies erfolgreichen und sehr geschätzten) Arbeit leben.
Die beiden, obwohl Schulkollegen, sind während dieser beschriebenen Reise zum erstenmal andauernd mit einander allein. Sie schätzen einander, obwohl sie einander unbegreiflich erscheinen. Anziehung und Abstoßung wird vielartig gefühlt. Es wird beschrieben, wie sich dieses Verhältnis zunächst zu überhitzter Intimität anstachelt, dann nach manchen Zwischenfällen auf dem gefährlichen Boden von Mailand und Paris in männliches Verständnis gegenseitig beruhigt und ganz befestigt. Die Reise schließt damit, daß die beiden Freunde ihre Fähigkeiten zu einem neuen eigenartigen Kunstunternehmen vereinigen.
Die vielen Nüancen, deren Freundschaftsbeziehungen zwischen Männern fähig sind, darzustellen und zugleich die bereisten Länder durch eine widerspruchsvolle Doppelbeleuchtung in einer Frische und Bedeutung sehn zu lassen, wie sie oft mit Unrecht nur exotischen Gegenden zugeschrieben werden: ist der Sinn dieses Buches.
Die erste lange Eisenbahnfahrt (Prag-Zürich)
Samuel: Abfahrt 26. VIII. 1911 Mittag 1 Uhr 2 Min.
Richard: Beim Anblick Samuels, der in seinen bekannten winzigen Taschenkalender etwas Kurzes einträgt, habe ich wieder die alte schöne Idee, jeder von uns solle ein Tagebuch über diese Reise führen. Ich sage es ihm. Er lehnt zuerst ab, dann stimmt er zu, er begründet beides, ich verstehe es beidemal nur oberflächlich, aber das macht nichts, wenn wir nur Tagebücher führen werden. – Jetzt lacht er schon wieder über mein Notizbuch, welches allerdings, in Glanzleinen schwarz eingebunden, neu, sehr groß, quadratisch, eher einem Schulheft ähnelt. Ich sehe voraus, daß es schwer und jedenfalls lästig sein wird, dieses Heft während der ganzen Reise in der Tasche zu tragen. Übrigens kann ich mir auch in Zürich mit ihm zugleich ein praktisches kaufen. Er hat auch eine Füllfeder. Ich werde mir sie hie und da ausborgen.
Samuel: In einer Station unserem Fenster gegenüber ein Waggon mit Bäuerinnen. Im Schoße einer, die lacht, schläft eine. Aufwachend winkt sie uns, unanständig in ihrem Halbschlaf: „Komm“. Als verspotte sie uns, weil wir nicht hinüberkönnen. Im Nebenkoupee eine dunkle, heroische, ganz unbeweglich. Den Kopf tief zurückgelehnt schaut sie entlang der Scheibe hinaus. Delphische Sibylle.
Richard: Aber was mir nicht gefällt, ist sein anknüpferischer, fälschlich Vertrautheit vorgebender, fast liebedienerischer Gruß an die Bäuerinnen. Nun setzt sich gar der Zug in Bewegung und Samuel bleibt mit seinem zu groß angefangenen Lächeln und Mützeschwenken allein. – Übertreibe ich nicht? – Samuel liest mir seine erste Bemerkung vor, sie macht auf mich einen großen Eindruck. Ich hätte auf die Bäuerinnen mehr Acht geben sollen. – Der Kondukteur fragt, übrigens sehr undeutlich, als hätte er es mit lauter Leuten zu tun, die diese Strecke schon oft gefahren sind, ob jemand für Pilsen Kaffee bestellen wolle. Bestellt man, so klebt er einen schmalen grünen Zettel für jede Portion ans Koupeefenster, so wie in Misdroy ehemals, so lange es keine Landungsbrücke gab, der ferne Dampfer durch Wimpel die Zahl der Boote, die zum Ausbooten benötigt wurden, anzeigte. Samuel kennt Misdroy gar nicht. Schade, daß ich nicht mit ihm dort war. Es war damals sehr schön. Diesmal wird es auch wunderbar schön werden. Die Fahrt ist zu schnell, es vergeht zu rasch; die Begierde nach weiten Reisen, die ich jetzt habe! – Welch ein altertümlicher Vergleich ist der obige, da seit fünf Jahren der Landungssteg in Misdroy steht. – Der Kaffee in Pilsen auf dem Perron. Man muß ihn mit Zettel nicht nehmen und bekommt ihn auch ohne.
Samuel: Vom Perron aus sehn wir ein fremdes Mädchen aus unserem Koupee herausschauen, die spätere Dora Lippert. Hübsch, dicknasig, kleiner Halsausschnitt in weißer Spitzenbluse. Erste gemeinschaftliche Tatsache bei der Weiterfahrt: ihr großer Hut in seiner Papierhülle schwebt aus dem Gepäcknetz leicht auf meinen Kopf herab. – Wir erfahren, daß sie die Tochter eines nach Innsbruck versetzten Offiziers ist und zu ihren Eltern fährt, die sie schon so lange nicht gesehn hat. Sie arbeitet in einem technischen Bureau in Pilsen, den ganzen Tag, hat sehr viel zu tun, aber es macht ihr Freude, sie ist sehr zufrieden mit ihrem Leben. Im Bureau heißt sie: unser Nesthäkchen, unsere kleine Schwalbe. Sie ist dort unter lauter Männern, die jüngste. O es ist lustig im Bureau! Man verwechselt die Hüte in der Garderobe, nagelt die Zehnuhrkipfel an oder klebt einem den Federstiel mit Gummiarabicum an die Schreibmappe. Wir selbst haben Gelegenheit an einem solchen „tadellosen“ Witz mitzuwirken. Sie schreibt nämlich eine Karte an ihre Bureaukollegen, in der es heißt: „Das Vorausgesagte ist leider eingetroffen. Ich bin in einen falschen Zug eingestiegen und befinde mich jetzt in Zürich. Herzliche Grüße.“ Wir sollen diese Karte in Zürich aufgeben. Sie erwartet aber von uns als „Ehrenmännern“, daß wir nichts dazuschreiben. Im Bureau wird man natürlich Sorge haben, telegraphieren und Gott weiß, was noch. – Sie ist Wagnerianerin, fehlt bei keiner Wagnervorstellung, „diese Kurz neulich als Isolde“, auch den Briefwechsel Wagners mit der Wesendonck liest sie eben, sie nimmt ihn sogar nach Innsbruck mit, ein Herr, natürlich jener, der ihr die Klavierauszüge vorspielt, hat ihr das Buch geborgt. Sie selbst hat leider wenig Talent zum Klavierspiel, wir wissen es aber schon, seitdem sie uns einige Leitmotive vorgesummt hat. – Sie sammelt Chokoladenpapier, aus dem sie eine große Staniolkugel macht, die sie auch mit hat. Diese Kugel ist für eine Freundin bestimmt, weiterer Zweck unbekannt. Sie sammelt aber auch Cigarrenbinden, diese ganz bestimmt für ein Tablett. – Der erste bayerische Kondukteur bringt sie darauf, ihre sehr widerspruchsvollen und dunklen Ansichten einer Offizierstochter über das österreichische Militär und Militär überhaupt kurz und mit großer Entschiedenheit zu äußern. Sie hält nämlich nicht nur das österreichische Militär für schlapp, sondern auch das deutsche und jedes Militär überhaupt. Aber läuft sie nicht im Bureau zum Fenster, wenn Militärmusik vorüberkommt? Eben nicht, denn das ist kein Militär. Ja, ihre jüngere Schwester, die ist anders. Die tanzt fleißig im Innsbrucker Offizierskasino. Also Uniformen imponieren ihr gar nicht und Offiziere sind für sie Luft. Offenbar ist daran zum Teil jener Herr schuld, der ihr die Klavierauszüge borgt, zum Teil aber unser Hin- und Herspazieren auf dem Perron des Further Bahnhofs, denn sie fühlt sich nach der Fahrt im Gehn so frisch und streicht mit den Handflächen ihre Hüften. Richard verteidigt das Militär, aber ganz im Ernst. – Ihre Lieblingsausdrücke: tadellos – mit Null Komma fünf Beschleunigung – herausfeuern – prompt – schlapp.
Richard: Dora L. hat runde Wangen mit viel blondem Flaum; sie sind aber so blutleer, daß man sehr lange die Hände in sie drücken müßte, ehe sich eine Röthung zeigte. Das Mieder ist schlecht, über seinem Rande auf der Brust zerknittert sich die Bluse; davon muß man absehn.
Froh bin ich, daß ich ihr gegenüber und nicht neben ihr sitze, ich kann nämlich mit einem, der neben mir sitzt, nicht reden. Samuel z. B. setzt sich wieder mit Vorliebe neben mich; er sitzt auch gern neben Dora. Ich dagegen fühle mich ausgehorcht, wenn sich jemand neben mich setzt. Schließlich hat man ja wirklich gegen einen solchen Menschen von vornherein kein Auge in Bereitschaft, man muß sie erst zu ihm hinüberdrehen. Allerdings bin ich infolge meines Gegenübersitzens von der Unterhaltung Doras und Samuels, besonders wenn der Zug fährt, zeitweilig ausgeschlossen; alle Vorteile kann man nicht haben. Dafür sah ich sie aber schon, wenn auch nur Augenblicke lang, stumm neben einandersitzen; natürlich ohne meine Schuld.
Ich bewundere sie; sie ist so musikalisch. Samuel allerdings scheint ironisch zu lächeln, als sie ihm etwas leise vorsingt. Vielleicht war es nicht ganz korrekt, aber immerhin, verdient es nicht Bewunderung, daß sich ein in einer großen Stadt alleinstehendes Mädchen so herzlich für Musik interessiert? Sie hat sogar in ihr Zimmer, das doch nur gemietet ist, ein gemietetes Klavier schaffen lassen. Man muß sich nur vorstellen: eine so umständliche Angelegenheit wie ein Klaviertransport (Fortepiano!), die selbst ganzen Familien Schwierigkeiten macht und das schwache Mädchen! Wie viel Selbständigkeit und Entschiedenheit gehört dazu!
Ich frage sie nach ihrem Haushalt. Sie wohnt mit zwei Freundinnen, abends kauft eine von ihnen das Nachtmahl in einem Delikatessengeschäft, sie unterhalten sich sehr gut und lachen viel. Daß das alles bei Petroleumbeleuchtung geschieht, kommt mir, als ich es höre, merkwürdig vor, aber ich will es ihr nicht sagen. Offenbar liegt ihr auch an dieser schlechten Beleuchtung nichts, denn bei ihrer Energie könnte sie von ihrer Wirtin gewiß auch eine bessere erzwingen, wenn es ihr einmal einfiele.
Da sie im Laufe des Gespräches alles vorzeigen muß, was sie in ihrem Täschchen hat, sehn wir auch eine Medizinflasche mit irgend etwas Abscheulichem Gelbem drin. Jetzt erst erfahren wir, daß sie nicht ganz gesund ist, sogar lange krank gelegen ist. Und nachher war sie noch sehr schwach. Damals hat ihr der Chef selbst geraten (so anständig ist man gegen sie), nur halbe Tage ins Bureau zu kommen. Jetzt geht es ihr besser, sie muß aber dieses Eisenpräparat nehmen. Ich rate ihr, es lieber zum Fenster hinauszuschütten. Sie stimmt zwar leicht zu (denn das Zeug schmeckt elend), ist aber nicht zum Ernst zu bringen, trotzdem ich, näher zu ihr vorgebeugt als jemals, meine gerade darin so klaren Ansichten über eine naturgemäße Behandlung des menschlichen Organismus darlegen will, und zwar in der aufrichtigen Absicht, ihr zu helfen oder zumindest dieses unberatene Mädchen vor Schaden zu bewahren, und mich so wenigstens für einen Augenblick lang als glücklichen Zufall dieses Mädchens fühle. – Als sie nicht aufhört zu lachen, breche ich ab. Geschadet hat mir auch, daß Samuel während meiner ganzen Rede mit dem Kopf gewackelt hat. Ich kenne ihn ja. Er glaubt an die Ärzte und hält die Naturheilmethode für lächerlich. Ich verstehe das sehr gut: er hat nie einen Arzt gebraucht und daher nie ernstliche selbständige Gedanken über diese Sache gehabt, kann beispielsweise dieses ekelhafte Präparat gar nicht auf sich beziehn. – Wäre ich mit dem Fräulein allein gewesen, so hätte ich sie schon überzeugt. Denn: wenn ich in dieser Sache nicht Recht habe, habe ich es in keiner!
Die Ursache ihrer Blutarmut ist mir ja von allem Anfang an klar gewesen. Das Bureau. Man kann ja wie alles auch das Bureauleben als etwas Scherzhaftes empfinden (und dieses Mädchen empfindet es ehrlich so, ist ja vollständig getäuscht), aber im Wesen, in den unglücklichen Folgen!? – Ich weiß ja, woran ich z. B. bin. Und jetzt soll gar ein Mädchen im Bureau sitzen, der Frauenrock ist gar nicht dazu gemacht, wie muß er sich überall spannen, um dauernd, stundenlang auf einem harten Holzsessel sich hin- und herzuschieben. Und so werden diese runden Popos gedrückt, und zugleich die Brust an der Schreibtischkante. – Übertrieben? – Ein Mädchen im Bureau ist mir doch jedesmal ein trauriger Anblick.
Samuel ist schon ziemlich intim mit ihr geworden. Er hat sie sogar, was ich eigentlich nie gedacht hätte dazu gebracht, mit uns in den Speisewagen zu gehn. In diesen Waggon zwischen fremde Passagiere treten wir schon mit einer geradezu unglaublichen Zusammengehörigkeit ein, alle drei. Das muß man sich merken, daß man zur Verstärkung der Freundschaft eine neue Umgebung aufsuchen soll. Ich sitze jetzt sogar neben ihr, wir trinken Wein, unsere Arme berühren einander, unsere gemeinsame Ferienfreude macht wirklich eine Familie aus uns.
Dieser Samuel hat sie trotz ihres lebhaften und durch den Regenguß unterstützten Sträubens überredet, den halbstündigen Aufenthalt in München zu einer Autofahrt zu benützen. Während er ein Auto holt, sagt sie zu mir in der Bahnhofsarkade, und sie nimmt mich dabei beim Arm: „Bitte, verhindern Sie diese Fahrt. Ich darf nicht mit. Es ist ganz ausgeschlossen. Ich sage es Ihnen, weil ich zu Ihnen Vertrauen habe. Mit Ihrem Freund kann man ja nicht reden. Er ist so verrückt!“ – Wir steigen ein, mir ist das Ganze peinlich, es erinnert mich auch genau an das Kinematographenstück „Die weiße Sklavin“, in dem die unschuldige Heldin gleich am Bahnhofsausgang im Dunkel von fremden Männern in ein Automobil gedrängt und weggeführt wird. Samuel dagegen ist guter Laune. Da der große Schirm des Autos uns die Aussicht nimmt, sehn wir eigentlich von allen Gebäuden nur den ersten Stock zur Not. Es ist Nacht. Perspektiven einer Kellerwohnung. Samuel dagegen leitet daraus phantastische Vorstellungen über die Höhe der Schlösser und Kirchen ab. Da Dora in ihrem dunklen Rücksitz noch immer schweigt und ich schon fast einen Ausbruch fürchte, wird er endlich doch stützig und fragt sie, für mein Gefühl etwas zu konventionell: „Nun, Sie sind doch nicht bös auf mich, Fräulein? Habe ich Ihnen etwas getan u. s. f.?“ Sie erwiedert: „Da ich einmal hier bin, will ich Ihnen das Vergnügen nicht stören. Sie hätten mich aber nicht zwingen sollen. Wenn ich ‚Nein‘ sage, so sage ich es nicht ohne Grund. Ich darf eben nicht fahren.“ „Warum?“ fragt er. „Das kann ich Ihnen nicht sagen. Sie müssen doch selbst einsehn, daß es sich für ein Mädchen nicht schickt, Nachts mit Herren herumzufahren. Außerdem ist noch etwas dabei. Nehmen Sie nur an, ich wäre schon gebunden...“ Wir erraten, jeder für uns, mit stillem Respekt, daß diese Sache irgendwie mit dem Wagner-Herren zusammenhängt. Nun, ich habe mir keine Vorwürfe zu machen, versuche sie aber trotzdem aufzuheitern. Auch Samuel, der sie bisher ein wenig von oben herab behandelt hat, scheint zu bereuen und will nur mehr von der Fahrt sprechen. Der Chauffeur, von uns aufgefordert, ruft die Namen der unsichtbaren Sehenswürdigkeiten aus. Die Pneumatics rauschen auf dem nassen Asphalt wie der Apparat im Kinematographen. Wieder diese „weiße Sklavin“. Diese leeren langen gewaschenen schwarzen Gassen. Das Deutlichste sind die unverhängten großen Fenster des Restaurants „Vier Jahreszeiten“, dessen Name uns als des elegantesten irgendwie bekannt war. Verbeugung eines livrierten Kellners vor einer Tischgesellschaft. Bei einem Denkmal, das wir in einem glücklichen Einfall für das berühmte Wagnerdenkmal erklären, zeigt sie Teilnahme. Nur beim Freiheitsmonument mit seinen im Regen klatschenden Fontänen ist längerer Aufenthalt gegönnt. Brücke über die nur geahnte Isar. Schöne herrschaftliche Villen längs des Englischen Gartens. Ludwigsstraße, Theatinerkirche, Feldherrnhalle, Pschorrbräu. Ich weiß nicht, wieso das kommt: ich erkenne nichts wieder, obwohl ich doch schon mehrmals in München war. Sendlinger Tor. Bahnhof, den rechtzeitig zu erreichen ich (besonders Doras wegen) Sorge hatte. So sind wir wie eine daraufhin ausgerechnete Feder in genau zwanzig Minuten durch die Stadt geschnurrt, nach dem Taxameter.
Wir bringen unsere Dora, als wären wir ihre Münchner Verwandten, in einem direkten Koupee nach Innsbruck unter, wo eine schwarzgekleidete Dame, die mehr zu fürchten ist als wir, ihr für die Nacht ihren Schutz anbietet. Da sehe ich erst, daß man uns zweien mit Beruhigung ein Mädchen anvertrauen kann.
Samuel: Die Sache mit Dora ist gründlich mißlungen. Je weiter es gieng, desto schlimmer. Ich hatte die Absicht, die Reise zu unterbrechen und in München zu übernachten. Bis zum Nachtmahl, etwa Station Regensburg, war ich überzeugt, daß es gehn würde. Ich versuchte mich mit Richard durch ein paar Worte auf einem Zettel zu verständigen. Er scheint ihn gar nicht gelesen zu haben, nur darauf bedacht, ihn zu verstecken. Schließlich liegt ja nichts daran, ich hatte gar keine Lust auf das fade Frauenzimmer. Nur Richard machte so ein Wesen aus ihr, mit seinen umständlichen Ansprachen und Gefälligkeiten. Dadurch wurde sie auch in ihrer dummen Ziererei bekräftigt, die schließlich im Automobil ganz unerträglich wurde. Beim Abschied wurde sie folgerecht ein sentimentales deutsches Gretchen, Richard, der ihr natürlich den Koffer trug, benahm sich, wie wenn sie ihn unverdient beglückt hätte, ich hatte nur ein peinliches Gefühl. Um es kurz zu formulieren: Frauen, die allein reisen oder sonst irgendwie als selbständig betrachtet sein wollen, dürfen dann nicht wieder in die übliche, vielleicht heute schon veraltete Koketterie verfallen, indem sie bald anziehn, bald abstoßen und in der dadurch erzeugten Verwirrung ihren Vorteil suchen. Denn das durchschaut man und läßt sich bald mit Vergnügen stärker abstoßen, als sie wahrscheinlich gewünscht haben. –
Nach dieser nicht ganz saubern Reisebekanntschaft war es ein besonderes Vergnügen, eine eigens für Hände- und Gesichtwaschen eingerichtete Anstalt auf dem Bahnhof zu finden. Man öffnet uns eine „Kabine“; allerdings könnte man sich schönere Waschgelegenheiten denken, auch haben wir nur gerade noch Zeit, mit unseren Kleidern bepackt uns in der Enge zwischen den zwei Waschbecken hin und her zu drehn, trotzdem sind wir einig, daß Kultur in dieser reichsdeutschen Einrichtung liegt. In Prag könnte man lange auf den Bahnhöfen herumsuchen, ehe man so etwas fände.
Wir steigen in das Koupee ein, in dem wir zu Richards Herzklopfen unser Gepäck gelassen hatten. Richard macht seine bekannten Schlafvorbereitungen, indem er sein Plaid als Kopfpolster unterlegt und den aufgehängten Havelock als Baldachin um sein Gesicht herabhängen läßt. Es gefällt mir, daß er, wenigstens wenn es sich um seinen Schlaf handelt, rücksichtslos ist, z. B. die Lampe verdunkelt, ohne zu fragen, trotzdem er weiß, daß ich in der Eisenbahn nicht schlafen kann. Er streckt sich auf seiner Bank aus, als ob er ein besonderes Recht vor den Mitreisenden hätte. Er schläft auch sofort friedlich ein. Und dabei hat der Mensch immerfort über Schlaflosigkeit zu klagen.
Im Koupee sitzen noch zwei junge Franzosen. (Genfer Gymnasiasten.) Der eine, schwarzhaarige, lacht immerfort, sogar darüber, daß ihn Richard kaum sitzen läßt (so streckt er sich aus), dann darüber, daß er einen Augenblick, in dem sich Richard erhebt und die Gesellschaft bittet nicht soviel zu rauchen, benützt um einen Teil von Richards Lagerplatz zu besetzen. Solche kleine Kämpfe werden unter Fremdsprachigen stumm und daher mit großer Leichtigkeit ausgefochten, ohne Entschuldigungen und ohne Vorwürfe. – Die Franzosen verkürzen sich die Nacht, indem sie eine Blechbüchse mit Kakes einander hin- und herreichen oder Zigaretten drehn oder jeden Augenblick auf den Gang hinausgehn, einander rufen, wieder hereinkommen. In Lindau (sie sagen „Lendó“) lachen sie herzlich und für diese Nachtzeit überraschend hell über den österreichischen Kondukteur. Kondukteure eines fremden Staates wirken unwiderstehlich komisch, so auch auf uns der bayrische in Furth mit seiner großen roten Tasche, die ihm tief unten um die Beine schlenkerte. – Langdauernde Aussicht auf den von den Zugslichtern beleuchteten und geglätteten Bodensee bis hinüber zu den fernen Lichtern der jenseitigen Ufer, finster und dunstig. Mir fällt ein altes Schulgedicht ein, „Der Reiter über den Bodensee“. Ich verbringe eine hübsche Zeit damit, es mir aus dem Gedächtnis wiederherzustellen. – Eindringen dreier Schweizer. Einer raucht. Einer, der dann auch nach dem Aussteigen der zwei andern zurückbleibt, ist zuerst unwesentlich, klärt sich aber gegen Morgen auf. Er hat den Streitigkeiten zwischen Richard und dem schwarzen Franzosen ein Ende gemacht, indem er gleichsam beiden Unrecht gab und sich für den ganzen Rest der Nacht steif zwischen sie setzte, den Bergstock zwischen den Beinen. Richard zeigt, daß er auch sitzend schlafen kann.
Die Schweiz überrascht durch die alleinstehenden, daher scheinbar besonders aufrechten selbstständigen Häuser in allen Städtchen, Dörfern längs der ganzen Eisenbahnstrecke. Keine Gassenbildung in St. Gallen. Vielleicht drückt sich darin der gut deutsche Partikularismus jedes Einzelnen aus, – von Terrainschwierigkeiten unterstützt. Jedes Haus mit seinen dunkelgrünen Fensterläden und viel grüner Farbe in Fachwerk und Geländer hat einen villenähnlichen Charakter. Trägt trotzdem eine Firma, nur eine, Familie und Geschäft scheinen nicht unterschieden. Diese Einrichtung, Geschäftsunternehmungen in Villen zu betreiben, erinnert mich stark an R. Walsers Roman „Der Gehilfe“.
Es ist Sonntag, fünf Uhr früh, 27. August. Alle Fenster noch geschlossen, alles schläft. Immer das Gefühl, daß wir, in diesen Zug gesperrt, die einzige schlechte Luft weit und breit atmen, während das Land draußen in natürlicher Weise, die man nur aus einem Nachtzug heraus, unter einer weiterbrennenden Lampe, richtig beobachten kann, sich entschleiert. Es ist zuerst von den dunklen Bergen als besonders schmales Tal zwischen ihnen und unserem Zug hergeschoben, dann durch den Morgendunst wie durch Oberlichtfenster weißlich aufgehellt, die Matten erscheinen allmählich frisch, wie nie zuvor berührt, saftig grün, was mich in diesem trockenen Jahr sehr in Erstaunen setzt, endlich erbleicht das Gras bei steigender Sonne in langsamer Verwandlung. – Bäume mit schweren großen Nadelästen, die längs des ganzen Stammes bis zum Fuße niederwallen.
Solche Formen sieht man häufig in Bildern Schweizer Maler und ich hielt sie bis heute für nichts als stylisiert.
Eine Mutter mit ihren Kindern beginnt auf der saubern Straße den Sonntagspaziergang. Das erinnert mich an Gottfried Keller, der von seiner Mutter erzogen wurde.
Im Wiesenland überall die sorgfältigsten Zäune; manche sind aus grauen wie Bleistifte zugespitzten Stämmen gebaut, oft aus halbierten solchen Stämmen. So teilten wir als Kinder Bleistifte, um den Graphit herauszubekommen. Derartige Zäune habe ich noch nie gesehn. So bietet jedes Land Neues im Alltäglichen und man muß sich hüten, der Freude über solche Eindrücke nachgebend das Seltene zu übersehn.
Richard: Die Schweiz in den ersten Morgenstunden sich selbst überlassen. Samuel weckt mich angeblich beim Anblick einer sehenswerten Brücke, die aber schon vorbei ist, ehe ich aufschaue, und verschafft sich durch diesen Griff vielleicht den ersten starken Eindruck von der Schweiz. Ich sehe sie zuerst, viel zu lange Zeit, aus innerer in äußerer Dämmerung an.
Ich habe in der Nacht ungewöhnlich gut geschlafen, wie in der Eisenbahn fast immer. Mein Schlaf in der Eisenbahn ist förmlich eine reinliche Arbeit. Ich lege mich hin, den Kopf zu allerletzt, probiere kurz zum Vorspiel einige Lagen, sondere mich von der ganzen Gesellschaft ab, wie sie mich auch von allen Seiten anschauen möge, indem ich mit dem Überzieher oder der Reisemütze mein Gesicht verdecke und werde von dem anfänglichen Behagen einer neu eingenommenen Körperlage in den Schlaf geweht. Am Anfang ist das Dunkel natürlich eine gute Hilfe, im weiteren Verlaufe ist es fast überflüssig. Auch die Unterhaltung könnte fortgehn wie früher nur ist es schon so, daß der Mahnung, die ein ernsthaft Schlafender bildet, auch ein entfernt sitzender Schwätzer nicht widerstehen kann. Denn es gibt kaum einen Ort, wo die größten Gegensätze in der Lebensführung so nah, unvermittelt und überraschend neben einander sitzen wie im Koupee und infolge der fortwährenden gegenseitigen Betrachtung in der kürzesten Zeit auf einander zu wirken anfangen. Und wenn auch ein Schlafender die andern nicht gleich wieder einschläfert, so macht er sie doch stiller oder steigert gar ganz gegen seinen Willen ihre Nachdenklichkeit zum Rauchen, so wie es leider bei dieser Fahrt geschehen ist, wo ich in der guten Luft unaufdringlicher Träume Wolken von Zigarettenrauch eingeatmet habe.
Meinen guten Schlaf in der Eisenbahn erkläre ich damit, daß mich sonst meine aus Überarbeitung stammende Nervosität durch den Lärm nicht schlafen läßt, den sie in mir anrichtet und der in der Nacht von allen zufälligen Geräuschen des großen Wohnhauses und der Gasse, von jedem aus der Ferne herannahenden Wagenrollen, jedem Zanken Betrunkener, jedem Schritt auf der Treppe angefeuert wird, daß ich oft ärgerlich alle Schuld auf diesen äußeren Lärm schiebe – während in der Eisenbahn die Gleichmäßigkeit der Fahrtgeräusche, ob es nun gerade die arbeitende Federung des Waggons ist, oder das sich Reiben der Räder, das Aneinanderschlagen der Schienen, das Zittern des ganzen Holz-, Glas- und Eisenbaues ein Niveau wie von vollkommener Ruhe bilden, auf dem ich schlafen kann, scheinbar wie ein gesunder Mensch. Dieser Schein weicht natürlich sofort z. B. einem vordringenden Pfiff der Lokomotive oder einer Veränderung des Fahrttempos oder ganz bestimmt dem Eindruck in den Stationen, der sich genau wie durch den ganzen Zug auch durch meinen ganzen Schlaf fortsetzt bis zum Erwachen. Dann höre ich ohne Erstaunen die Namen von Orten ausrufen, die ich nie zu passieren erwartet habe, wie diesmal Lindau, Konstanz, ich glaube auch Romanshorn und habe von ihnen weniger Gewinn, als wenn ich von ihnen nur geträumt hätte, im Gegenteil nur Störung. Erwache ich während der Fahrt, dann ist das Erwachen stärker, weil es wie gegen die Natur des Eisenbahnschlafes ist. Ich öffne die Augen und wende mich einen Augenblick zum Fenster. Viel sehe ich da nicht, und was ich sehe, ist mit dem nachlässigen Gedächtnis des Träumenden erfaßt. Doch möchte ich schwören, daß ich irgendwo im Würtembergischen, wie wenn ich auch dieses Würtembergische ausdrücklich erkannt hätte, um zwei Uhr in der Nacht einen Mann gesehen habe, der auf der Veranda seines Landhauses sich zum Geländer beugte. Hinter ihm war die Tür seines beleuchteten Schreibzimmers halb geöffnet, als sei er nur herausgekommen, um vor dem Schlaf noch den Kopf zu kühlen. ... In Lindau war im Bahnhof, aber auch während der Einfahrt und der Ausfahrt viel Gesang in der Nacht und weil man überhaupt in einer solchen Fahrt in der Nacht von Samstag auf Sonntag viel nächtliches Leben auf weiten Strecken, nur leicht im Schlaf beirrt, zusammenkehrt, scheint einem der Schlaf besonders tief und die Unruhe draußen besonders laut zu sein. Auch die Schaffner, die ich öfters an meiner getrübten Fensterscheibe vorüberlaufen sah, und die niemanden wecken, sondern nur ihre Pflicht erfüllen wollten, riefen in der Leere der Bahnhofsräume überlaut eine Silbe des Stationsnamens zu uns herein und weiterhin die andern. Dann lockte es meine Reisegenossen sich den Namen zusammenzusetzen oder sie erhoben sich, um durch die immer wieder abgewischte Scheibe den Namen selbst zu lesen; mein Kopf aber fiel schon zurück aufs Holz.
Wenn man aber schon einmal so gut im Fahren schlafen kann wie ich – Samuel durchsitzt die ganze Nacht mit offenen Augen, wie er behauptet – dann sollte man auch erst bei der Ankunft erwachen dürfen, um sich nicht im Augenblick des Aufwachens aus gesundem Schlaf mit fettigem Gesicht, nassem Körper, kreuz und quer gedrückten Haaren, in Wäsche und Kleidern, die 24 Stunden, ohne geputzt und gelüftet zu werden, im Eisenbahnstaub bestanden habend, in einen Winkel des Koupees gekrümmt zu finden und in diesem Zustand weiterfahren zu müssen. Hätte man jetzt die Kraft dazu, würde man den Schlaf verfluchen, so aber beneidet man nur im Stillen Leute, die wie Samuel, vielleicht nur weilchenweise geschlafen haben, aber dafür auch besser auf sich achten konnten, fast die ganze Fahrt mit Bewußtsein gemacht haben und die durch die Unterdrückung des Schlafes, dessen sie schließlich auch fähig gewesen wären, bei ununterbrochenem klarem Verstande geblieben sind. Ich war ja Samuel am Morgen ausgeliefert.
Wir standen nebeneinander beim Fenster, ich nur seinetwegen, und während er mir zeigte, was von der Schweiz zu sehen war und von dem erzählte, was ich verschlafen hatte, nickte ich und bewunderte, wie er wollte. Es ist noch ein Glück, daß er solche Zustände an mir entweder nicht merkt oder nicht richtig beurteilt, denn gerade zu solchen Zeiten ist er freundlicher zu mir, als dann, wenn ich es besser verdiene. Ernsthaft aber dachte ich damals nur an die Lippert. Ein wahres Urteil über neue kurze Bekanntschaften, besonders mit Frauen, kann ich mir ja nur schwer bilden. In der Zeit nämlich, in der die Bekanntschaft im Gange ist, beaufsichtige ich lieber mich selbst, weil da viel zu tun ist, und so habe ich auch an ihr nur einen lächerlichen Teil von dem bemerkt, was ich flüchtig und gleich verloren an ihr ahnte. In der Erinnerung wiederum nehmen diese Bekanntschaften sofort große anbetungswürdige Formen an, da sie dort stumm sind, nur ihrer eigenen Beschäftigung nachgehn und durch ihr völliges Vergessen unserer Person ihre Mißachtung unserer Bekanntschaft zeigen. Doch war noch ein anderer Grund, weshalb ich mich nach Dora, dem nächsten Mädchen meiner Erinnerung, so sehnte. Samuel genügte mir an diesem Morgen nicht. Er wollte als mein Freund eine Reise mit mir machen, aber das war nicht viel. Das bedeutete nur, daß ich an allen Tagen dieser Reise einen angezogenen Mann neben mir haben werde, dessen Körper ich nur im Bade sehen kann, ohne auch nach diesem Anblick das geringste Verlangen zu haben. Samuel würde ja schließlich meinen Kopf an seiner Brust dulden, wenn ich dort weinen wollte, aber können mir beim Anblick seines männlichen Gesichts, seines knapp wehenden Spitzbartes, seines zusammengeklappten Mundes – da höre ich schon auf – können mir denn ihm gegenüber die erlösenden Tränen in die Augen kommen?
(Fortsetzung folgt)
[ «« ]