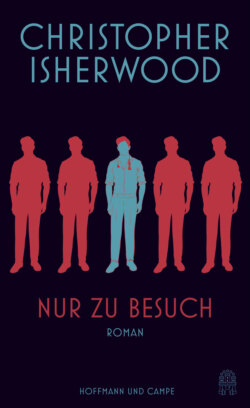Читать книгу Nur zu Besuch - Кристофер Ишервуд - Страница 4
Mr. Lancaster
ОглавлениеEndlich bin ich so weit, über Mr. Lancaster zu schreiben. Das wollte ich schon seit Jahren, aber nur halbherzig. Ich hatte nie das Gefühl, ihm gerecht werden zu können. Jetzt erkenne ich meinen Irrtum; ich habe ihn immer als Einzelperson gesehen. Isoliert betrachtet kommt er zu kurz. Um ihn korrekt ins Bild zu setzen, muss ich zeigen, dass meine Zeit mit ihm der Anfang eines, nein, mehrerer neuer Kapitel in meinem Leben war. Und ich muss einige Figuren in diesen Kapiteln schildern. Mr. Lancaster ist ihnen, mit einer Ausnahme, nie begegnet. (Wenn er geahnt hätte, was einmal aus Waldemar werden würde, hätte er ihn entsetzt hinausgeworfen.) Hätte er Ambrose, Geoffrey, Maria oder Paul kennengelernt – nein, das übersteigt meine Phantasie! Dennoch sind all diese Menschen durch mich miteinander verbunden, so verhasst ihnen dieser Gedanke möglicherweise gewesen wäre. Und so müssen alle die Kränkung hinnehmen, gemeinsam in diesem Buch aufzutreten.
Im Frühling 1928, ich war dreiundzwanzig, kam Mr. Lancaster auf Geschäftsreise nach London und schrieb meiner Mutter, dass er uns gerne besuchen würde. Keiner von uns war ihm je begegnet. Ich wusste nur, dass er die norddeutsche Niederlassung einer britischen Reederei leitete. Und dass er der Stiefsohn des Schwagers meiner Großmutter mütterlicherseits war; vielleicht lässt sich das auch einfacher ausdrücken. Sogar meine Mutter mit ihrem Faible für Verwandtschaftsverhältnisse musste zugeben, dass er, streng genommen, nicht zur Familie gehörte. Aber sie entschied, es wäre eine nette Geste, ihn »Cousin Alexander« zu nennen, damit er sich bei uns ein bisschen mehr zu Hause fühlte.
Ich fügte mich, obwohl es mir völlig schnuppe war, wie wir ihn nannten und wie er sich fühlte. Für mich gehörten alle über vierzig, mit ein paar wenigen rühmlichen Ausnahmen, einem fremden Stamm an, naturgemäß feindselig, in Wirklichkeit aber eher lächerlich als furchteinflößend. Sie waren durch und durch groteske Gestalten, salbungsvoll und vertrottelt, denen man mit Gleichgültigkeit begegnen musste. Nur Leute meiner Generation erschienen mir wirklich lebendig. Oft verkündete ich, dass wir, wenn uns das Alter ereilte – ein Zustand, den ich theoretisch voraussehen konnte und dennoch unvorstellbar fand –, hoffentlich schnell und schmerzfrei sterben würden.
Mr. Lancaster erwies sich als genauso grotesk, wie ich erwartet hatte. Doch trotz aller Bemühungen gelang es mir nicht, ihm gegenüber gleichgültig zu sein, denn er brachte mich vom Moment seiner Ankunft an in Harnisch und demütigte mich. (Heute erkenne ich, dass er das nicht absichtlich tat; er war wohl einfach furchtbar gehemmt.) Er behandelte mich wie einen Schuljungen, mit heiterer, gönnerhafter Miene. Sein schlimmstes Vergehen war, dass er mich »Christophilos« nannte – eine Anrede, die in seiner manierierten klassischen Aussprache umso spöttischer und beleidigender klang.
»Ich möchte wetten, mein teuerster Christophilos, dass du noch nie einen Trampdampfer von innen gesehen hast. Nein? Dann rate ich dir, zur Rettung deiner unsterblichen Seele, den Rockzipfel deiner gnädigen Frau Mutter ausnahmsweise loszulassen und uns auf einem unserer Schiffe zu besuchen. Zeig uns, dass du ohne Komfort auskommst. Wir wollen sehen, wie du mitten in einem Nordweststurm Speck vertilgst und unter dem Gelächter der alten Seebären zur Reling stürzt. Vielleicht macht das einen Mann aus dir.«
»Mit dem größten Vergnügen«, sagte ich so ungerührt, wie ich es vermochte.
Ich sagte es, weil ich Mr. Lancaster in diesem Augenblick hasste und mich der Herausforderung daher kaum verweigern konnte. Ich sagte es, weil ich damals überall mit jedem hingefahren wäre; in mir brannte die Sehnsucht nach der großen unbekannten Welt. Ich sagte es auch, weil ich vermutete, dass Mr. Lancaster nur bluffte.
Ich irrte mich. Etwa drei Wochen später bekam ich einen Brief vom Londoner Hauptsitz seiner Firma. Darin wurde ich vor die vollendete Tatsache gestellt, dass ich an dem und dem Tag fahren würde, an Bord des reedereieigenen Frachters Coriolanus. Ein Angestellter werde mich zum Schiff bringen, ich solle mich um zwölf am Hafentor in der West India Dock Road einfinden.
Im ersten Moment war ich beunruhigt. Doch dann schaltete sich meine Phantasie ein. Ich übernahm die Hauptrolle in einem epischen Drama, frei nach Conrad, Kipling und Brownings Gedicht »Waring«. Als ein Mädchen anrief und mich für Mittwoch in einer Woche zu einer Cocktailparty einlud, sagte ich kurz und in leicht grimmigem Ton: »Bedaure. Da bin ich schon weg.«
»Ach! Wo bist du denn?«
»Weiß ich nicht genau. Irgendwo mitten auf der Nordsee. Auf einem Trampdampfer.«
Es verschlug ihr den Atem.
Mr. Lancaster und seine Reederei passten nicht in mein Epos. Es war mir peinlich zuzugeben, dass ich nur bis zur deutschen Nordseeküste fuhr. Wenn ich mit flüchtigen Bekannten sprach, deutete ich geschickt an, dass dies nur der erste Zwischenstopp auf einer ungeheuer langen, geheimnisvollen Reise sei.
Bevor ich zu der Konvention zurückkehre, den jungen Mann, der im Taxi zu seinem Abenteuer aufbricht, »ich« zu nennen, will ich ihn wie ein separates Wesen, ja fast wie einen Fremden betrachten. Denn natürlich ist er für mich fast ein Fremder. Ich habe seine Möglichkeiten überdacht, ihm einen neuen Akzent und neue Eigenarten gegeben, seine Vorurteile und Gewohnheiten abgelegt oder verfestigt. Das Skelett ist noch dasselbe, aber die äußere Hülle hat sich so stark verändert, dass er mich auf der Straße sehr wahrscheinlich nicht erkennen würde. Wir tragen dasselbe Namensschild und teilen ein fortlaufendes Bewusstsein; es bestätigt mir jeden Tag, ohne Ausnahme, dass ich ich bin. Was ich bin, hat sich jedoch im Laufe der Tage und Jahre so verändert, dass, abgesehen von der Gewissheit um meine Existenz, fast nichts mehr so ist wie damals. Und diese Gewissheit ist nichts Besonderes; jeder hat sie.
Der Christopher, der im Taxi zum Hafen fuhr, ist, praktisch gesprochen, tot; es gibt ihn nur noch in den verblassenden Erinnerungen derer, die ihn kannten. Er lässt sich nicht wiederbeleben. Ich kann ihn nur aus den Worten und Handlungen in meinem Gedächtnis und aus den Büchern rekonstruieren, die er uns hinterlassen hat. Oft ist er mir peinlich, und ich bin versucht, über ihn zu spotten; ich will mich jedoch bemühen, es nicht zu tun. Ich will mich auch nicht für ihn entschuldigen. Immerhin schulde ich ihm eine gewisse Anerkennung. Auf die eine Art ist er mein Vater, auf die andere mein Sohn.
Wie allein er wirkt! Nicht einsam, denn er hat viele Freunde, bei denen er sich lebhaft zeigt und die er zum Lachen bringt. Er ist für sie sogar so etwas wie ein Wortführer. Sie bauen darauf, dass er ihnen sagt, was sie als Nächstes denken, was sie bewundern und was verabscheuen sollen. Sie halten ihn für streitbar und originell. Und dennoch ist er in ihrer Gesellschaft isoliert durch sein Selbstmisstrauen, seine Unruhe und seine Angst vor der Zukunft. Sein Leben hat sich bisher in engen Grenzen abgespielt, und er ist, was die meisten Erfahrungen angeht, ziemlich unbedarft; er fürchtet sie, und doch giert er danach. Um sich zu beruhigen, verwandelt er jede in Windeseile in ein Heldenepos. Er spielt unentwegt Theater.
Mehr noch als die Zukunft fürchtet er die Vergangenheit – ihren Status, ihre Traditionen mitsamt ihren unausgesprochenen Ansprüchen und Vorhaltungen. Vielleicht ist sein stärkster Antrieb der Hass auf seine Vorfahren. Er hat sich geschworen, sie zu enttäuschen, zu verleugnen, Schande über sie zu bringen. Mein Spott würde den Eindruck erwecken, dass dieser Entschluss aus der Angst entstanden ist, an ihren Erwartungen zu scheitern; aber das wäre nicht einmal halb wahr. Seine Wut ist aufrichtig. Er ist ein echter Rebell. Er spürt, dass er sich nur durch Auflehnung weiterentwickeln kann.
Er nimmt ein Geheimnis mit auf diese Reise, es ähnelt einem Talisman; verleiht ihm Macht, solange er es hütet. Gestern ist sein erster Roman erschienen – und nicht einer der vielen Menschen, denen er in nächster Zeit begegnen wird, weiß es! Der Kapitän und die Mannschaft der Coriolanus wissen es bestimmt nicht; wahrscheinlich weiß es in ganz Deutschland niemand. Mr. Lancaster hat bereits gezeigt, dass er es nicht wert ist, eingeweiht zu werden; er weiß es nicht und wird es nie erfahren. Außer natürlich, der Roman wird so erfolgreich, dass er irgendwann in der Zeitung davon liest … Aber dieser Gedanke wird in abergläubischer Eile zensiert. Nein – nein – das Buch wird scheitern. Alle Literaturkritiker sind korrupt und arbeiten für den Feind … Und überhaupt, wozu sein Vertrauen in so trügerische Hoffnungen setzen, wenn die Welt des Heldenepos doch zuverlässig Trost und Sicherheit bereithält?
In jenem Frühling fand, von den dummen, aufgeblasenen Literaten der damaligen Zeit gänzlich ignoriert, ein Ereignis statt, das, darin sind wir uns jetzt, zehn Jahre später, wohl alle einig, die Geburtsstunde des modernen Romans markierte, wie wir ihn heute kennen: Lauter gute Absichten erschien. Am nächsten Tag stellte sich heraus, dass Isherwood nicht mehr in London weilte. Er war ohne ein Wort spurlos verschwunden. Seine engsten Freunde waren verwundert und bestürzt. Manche fürchteten sogar Selbstmord. Doch dann – Monate später – raunte man sich in den Salons seltsame Gerüchte zu – dass an ebenjenem Morgen eine verhüllte Gestalt gesichtet worden sei, die an einem Kai auf der Isle of Dogs einen Trampdampfer bestieg –
Nein, ich werde nicht über ihn spotten. Mich auch nicht für ihn entschuldigen. Ich bin stolz darauf, sein Vater und sein Sohn zu sein. Ich denke an ihn und staune, aber ich muss mich davor hüten, ihn zu verklären. Ich muss berücksichtigen, dass vieles, das wie Mut erscheint, nichts anderes ist als blanke Unwissenheit. Immer wieder vergesse ich, dass er seiner Zukunft gegenüber blind ist wie das dümmste Tier. So blind wie ich gegenüber meiner. Seine Zukunft ist in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich – bei weitem glücklicher, unbeschwerter und ereignisreicher als die der meisten. Und dennoch, wenn ich er wäre und sie vor mir sehen könnte, ich würde mit Sicherheit entsetzt aufschreien, dass ich ihr nicht gewachsen sei.
Nun ist es so, dass er kaum die nächsten fünf Minuten vorhersehen kann. Alles, was unmittelbar bevorsteht, ist neu für ihn und somit unberechenbar. Jetzt, wo sich die Taxifahrt dem Ende nähert, schalte ich meinen Weitblick ab und bemühe mich, mit seinen Augen zu sehen.
Der Reedereiangestellte, ein Mann kaum älter als ich, namens Hicks, erwartete mich wie vereinbart am Hafentor. Mit seinem pickeligen, vom Ruß und Nebel der düsteren Fenchurch Street blassen Gesicht hätte ich ihn nicht als Figur für mein Epos ausgewählt. Außerdem legte er eine übertriebene Eile an den Tag, die epischen Figuren fehlt. »Huch«, rief er mit einem Blick auf die Taschenuhr, »wir sollten uns besser sputen!« Er fasste den Griff meines Koffers und setzte sich in Trab. Da ich ihn den Koffer nicht allein tragen lassen wollte, musste ich mit seinem Tempo Schritt halten. Meinem Auftritt im ersten Akt des Dramas fehlte es an Stil.
»Da«, sagte Hicks. »Das ist sie.«
Die Coriolanus sah noch kleiner und schmutziger aus, als ich erwartet hatte. Alle nicht schwarzen Teile waren von einem gelblichen Braun; eine Farbe, die mich – vielleicht durch reine Gedankenassoziation – an Erbrochenes erinnerte. Zwei Kräne verluden noch Kisten an Deck, auf dem es von Hafenarbeitern wimmelte. Sie schrien aus voller Kehle, um sich gegen das Klappern der Winden und das Kreischen der Möwen durchzusetzen, die am Himmel ihre Kreise zogen.
»Wir hätten uns gar nicht so beeilen müssen!«, sagte ich vorwurfsvoll zu Hicks. Captain Dobson wisse die Passagiere gerne rechtzeitig an Bord, antwortete er ungerührt. Er hatte bereits das Interesse an mir verloren. Mit einem genuschelten Abschiedsgruß ließ er mich wie ein ausgeliefertes Paket, für das er nicht mehr zuständig war, an der Gangway stehen.
Ich drängelte mich an Bord, wobei ich fast in den offenen Laderaum gestoßen wurde. Captain Dobson erspähte mich von der Brücke und kam hinunter, um mich zu begrüßen. Er war ein kleiner, dicklicher Mann mit vom Wetter gerötetem Gesicht und den hervorquellenden Augen und Tränensäcken eines Komikers.
»Sie werden spucken«, sagte er. »Wir hatten schon einige gute Männer hier, aber alle haben versagt.« Ich bemühte mich, ein entsprechend besorgtes Gesicht zu machen.
Unter Deck stieß ich auf einen chinesischen Koch, einen walisischen Schiffsjungen und einen Steward, der aussah wie ein Jockey. Er sei zwölf Jahre lang für die Cunard Line gefahren, erzählte er, aber hier gefalle es ihm besser. »Sie sind der Einzige.« Er zeigte mir meine Kabine. Sie war so winzig wie ein Schrank und stickig; das Bullauge ließ sich nicht öffnen. Ich ging in den Salon, doch der lange Tisch war von einer Handvoll Angestellter belegt, die fieberhaft Ladelisten schrieben. Ich stieg wieder hinauf an Deck und fand einen Platz am Bug, wo ich, indem ich mich ganz klein machte, niemandem im Weg stand.
Eine Stunde später legten wir ab. Es dauerte lange, aus dem Hafenbecken hinaus auf den Fluss zu kommen, denn wir mussten mehrere Schleusentore passieren. Kinder aus den Armenvierteln hingen munter an den Toren und beobachteten uns. Ein Reedereiangestellter kam an Deck und stellte sich zu mir an die Reling.
»Das wird eine unruhige Fahrt«, sagte er. »Sie ist eine wahre Tänzerin.« Ohne ein weiteres Wort schwang er sich mit einem sportlichen Satz über die Reling auf den Kai, winkte mir kurz zu und war verschwunden.
Später aßen wir im Salon zu Abend. Ich lernte den Nautischen Offizier und die beiden Ingenieure kennen. Es gab eingelegte Makrele und Tee aus Messingbechern; er schmeckte metallisch und stark. Ich ging zurück an Deck und sah, dass ein ruhiger, bewölkter Abend angebrochen war. Wir ließen die Stadt hinter uns. Der Hafen und die Speicher machten kalten grauen Feldern und Marschland Platz. Wir fuhren an mehreren Feuerschiffen vorbei. Das letzte hieß Barrow Deep. Kapitän Dobson sagte im Vorbeigehen: »Das ist nur die erste Etappe unserer wagemutigen Reise.« Auf seine Art versuchte er, eine epische Stimmung zu erzeugen. Na schön – ich honorierte seinen guten Willen.
Ich ging in die Kabine zurück, denn es war inzwischen zu dunkel, um irgendetwas zu sehen. Der Steward schaute vorbei, um mir ein Angebot zu machen. Gegen ein Pfund Verpflegungsgeld könne ich während der Reise so viel essen, wie ich wolle. Ich durchschaute, dass er ein gutes Geschäft witterte, denn er war sich sicher, dass ich seekrank werden würde. »Vor einigen Monaten ist ein anderer Herr mit uns gefahren«, sagte er vergnügt. »Es ging ihm richtig dreckig. Sie klopfen an die Wand, wenn Sie heute Nacht etwas brauchen, nicht wahr, Sir?«
Ich schmunzelte, als er fort war. Ich hatte nämlich noch ein Geheimnis, das ich ebenso streng zu hüten gedachte wie das andere. Diese Seeleute, dachte ich, waren auf geradezu liebenswerte Weise einfältig. Die Fortschritte der Medizin waren offenbar völlig an ihnen vorbeigegangen. Natürlich hatte ich vorgesorgt. In meiner Tasche steckte eine kleine Pappschachtel mit Kapseln in Stanniolpapier. Die Kapseln enthielten teils rosa, teils graues Pulver. Man musste je eine nehmen; einmal vor der Abreise, danach zweimal täglich.
Als ich am nächsten Morgen aufwachte, war die Coriolanus heftig in Bewegung. Mit jeder Welle hob sich der Bug steil in die Höhe, das Schiff schwankte und stürzte dann krachend vornüber, sodass die gesamte Kabine bebte. Ich hatte gerade meine Kapseln geschluckt, als die Tür aufging und der Steward hereinschaute. Ich sah an der Enttäuschung in seinem Gesicht, worauf er spekuliert hatte.
»Ich dachte, Ihnen sei nicht wohl, Sir«, sagte er vorwurfsvoll. »Vor einer halben Stunde habe ich nach Ihnen gesehen, und Sie haben nicht reagiert.«
»Ich war noch nicht wach«, sagte ich. »Ich habe geschlafen wie ein Stein.« Ich schenkte dem Aasgeier ein strahlendes Lächeln.
Beim Frühstück trug der Zweite Ingenieur den Arm in einer Schlinge. In der Nacht war im Maschinenraum ein Rohr geplatzt, und er hatte sich die Hand verbrüht. Teddy, der walisische Schiffsjunge, schnitt ihm den Speck klein. Er stellte sich ungeschickt an, und der Ingenieur herrschte ihn an, sich zu beeilen. Das trug ihm eine Rüge vom Ersten Ingenieur ein: »Aus Ihnen wird später mal ein widerliches altes Stinktier – das sag ich Ihnen!«
Trotz der einigermaßen heldenhaften Verletzung des Zweiten Ingenieurs schwanden meine Erwartungen an das epische Format dieser Reise. Ich war davon ausgegangen, dass es sich bei der Besatzung um ein ganz eigenes Völkchen handeln würde – Männer, die nur für die See lebten. Tatsächlich aber entsprach nicht einer von ihnen meiner Vorstellung von einem Seemann. Der Nautische Offizier war zu gutaussehend, fast wie ein Schauspieler. Die Ingenieure hätten auch in einer Fabrik arbeiten können; sie waren einfach Ingenieure. Der Steward unterschied sich in nichts von anderen Bediensteten. Kapitän Dobson hätte auch als Wirt eines Pubs eine gute Figur abgegeben. Ich musste der ernüchternden Wahrheit ins Auge sehen: Jedermann fuhr zur See.
Tatsächlich schienen sie mit den Gedanken ganz an Land zu sein. Sie sprachen über Filme, die sie gesehen hatten. Unterhielten sich über einen Scheidungsskandal, der vor kurzem in aller Munde gewesen war: »Man kann sie gut und gerne eine ehrbare Hure nennen.« Sie unterhielten mich mit Rätselfragen: »Ein vierzehnjähriges Mädchen hat keinen, ein sechzehnjähriges Mädchen wartet drauf, und Prinzessin Mary wird nie einen haben. Was ist das?« Antwort: »Ein Sozialversicherungsausweis.« Ich gab die Geschichte vom Geistlichen, dem Betrunkenen und den Straßenkindern zum Besten. Als ich zur Pointe kam: »Vielleicht sollten Sie dann Ihre Hose falsch herum tragen wie Ihren Kragen …«, stockte ich, unsicher, ob es taktlos wäre, einen Cockney-Akzent nachzumachen, denn beide Ingenieure hatten einen. Aber die Geschichte kam gut an. Alle waren sehr freundlich. Doch die Antwort auf die ewige Frage des jungen Mannes, »Was denken sie wirklich über mich?«, schien wie gewöhnlich zu lauten: »Gar nichts.« Ihr Interesse an mir reichte nicht einmal aus, um sich zu wundern, als ich mir eine zweite Portion Speck nahm, obwohl das Schiff schaukelte wie eine Wippe.
Den ganzen Tag lang pflügten wir schlingernd durch die raue See. Das Wasser auf Deck glitzerte so hell, dass ich von dem Anblick halb benommen war. Jetzt, wo die Kisten verstaut und die Luken abgedeckt waren, wirkte das Schiff doppelt so groß. Ich spazierte über das leere Deck wie ein Preistruthahn. Hin und wieder machte mich Kapitän Dobson, der mit einem alten Filzhut auf dem Kopf auf der Brücke stand und eine Bruyèrepfeife rauchte, wohlmeinend auf ein vorbeifahrendes Schiff aufmerksam. Ich fühlte mich jedes Mal verpflichtet, zur Reling zu eilen und es mit sachkundigem Eifer zu betrachten. Später brachte er mich in Verlegenheit, denn er kam mit einem Liegestuhl und stellte ihn eigenhändig für mich auf. »Jetzt sind Sie so selig wie der Junge, der seinen Vater umgebracht hat«, sagte er. »Ich würde gerne Ihre Meinung hierzu hören«, fuhr er fort und gab mir ein Taschenbuch mit einem aufreizenden Bild auf dem Umschlag. Es hieß Die Braut der Bestie und enthielt lauter Szenen wie diese: »Er legte seine glühenden Hände auf ihre vollen Brüste, dann drückte er sie brutal zusammen, bis sie vor Schmerz und Verlangen aufschrie.« In London hätten meine Freunde und ich uns mit geistreichen Worten darüber lustig gemacht. Es gehörte einfach zum guten Ton, Bücher dieser Art als lächerlich zu verwerfen. Hier aber durfte ich mir eingestehen, dass es mich, so albern es auch war, ungeheuer erregte. Kapitän Dobson sah es als Kompliment, dass ich es in einer Stunde durchlas. Teddy versorgte mich währenddessen mit Tee und Blätterteiggebäck mit Marmeladenfüllung.
Mitten in der Nacht schlug ich die Augen auf, als hätte mich jemand geweckt. Ich kniete mich auf mein Bett und spähte durchs Bullauge. Die ersten Lichter Deutschlands spiegelten sich im schwarzen Wasser, blau, grün und rot.
Am nächsten Morgen fuhren wir den Fluss hinauf. Kapitän Dobson trank mit dem deutschen Lotsen im Kartenraum und war ausgesprochen heiter. Er hatte den alten Filzhut gegen eine schicke weiße Mütze getauscht, mit der er mehr denn je einem lustigen Seebären aus dem Varieté ähnelte. Wir fuhren an Binnenschiffen vorbei, die mit ihren bunten Gardinen und den Blumentöpfen vor den Fenstern wie ein gemütliches Zuhause wirkten. Kapitän Dobson wies mich auf allerlei Interessantes am Ufer hin. Er zeigte auf ein Fabrikgebäude und sagte: »Dort arbeiten Hunderte junge Wollwäscherinnen. Es ist so heiß, dass sie sich obenrum völlig frei machen.« Er zwinkerte mir zu. Aus Höflichkeit setzte ich ein anzügliches Grinsen auf.
Im Hafen wurde die Coriolanus wieder winzig klein, als sie zwischen all den großen Schiffen demütig ihren Liegeplatz ansteuerte. Kapitän Dobson rief den anderen Schiffen im Vorbeifahren Grüße zu, und sie wurden erwidert. Er schien allseits beliebt zu sein.
Als wir festmachten, lag das Deck so weit unterhalb des Kais, dass die Gangway fast senkrecht stand. Ein Polizist, der meinen Pass kontrollieren wollte, zögerte, sie hinunterzugehen. Kapitän Dobson veralberte ihn: »Zieh Leine, Tirpitz! Zieh Leine!« Auch den Lotsen hatte er Tirpitz genannt, so wie alle angerufenen Kapitäne. Der Polizist stieg vorsichtig rückwärts hinunter, lachend, aber mit den Händen fest am Geländer.
Als ich meinen Stempel hatte, waren die Formalitäten erledigt. Ich gab dem Steward die Hand (er war leicht eingeschnappt; ein schlechter Verlierer), steckte Teddy ein Trinkgeld zu und winkte Kapitän Dobson zum Abschied. »Schöne Grüße an die Mädels!«, rief er von der Brücke. Der Polizist begleitete mich hilfsbereit zum Tor und setzte mich in die Straßenbahn, die direkt vor Mr. Lancasters Arbeitsstätte hielt.
Das Kontor war eindrucksvoll, noch größer, als ich erwartet hatte, im Erdgeschoss, mit einer Drehtür. Ein halbes Dutzend Mädchen und etwa doppelt so viele Männer arbeiteten dort. Ein Junge von vielleicht sechzehn Jahren führte mich in Mr. Lancasters Büro.
Mr. Lancaster war mir als groß in Erinnerung geblieben, doch dass er so groß war, hatte ich vergessen. Riesig und dünn. Ich fügte mich der unbewussten Körperreaktion, die zu jeder Begegnung gehört, und wurde, während ich ihm die knochige Hand schüttelte, um den Bruchteil eines Millimeters kleiner, breiter, massiger.
»Da bin ich, Cousin Alexander!«
»Christopher«, sagte er mit seiner tiefen, gelangweilten Stimme. Es war kein Ausruf, sondern eine Feststellung. Ich füllte sie mit der Bedeutung: Da bist du, und ich bin nicht im mindesten überrascht.
Sein Kopf war so klein, dass er feminin wirkte. Er hatte sehr große Ohren, einen dicken, feuchten Schnurrbart und einen verdrießlichen Mund. Seine Miene war unfreundlich, frostig, missgestimmt. An der langen roten Nase deutete sich ein winziger Tropfen an. Obendrein trug er einen hohen, steifen Kragen und scheußliche schwarze Stiefel. Nein – ich konnte nichts Schönes an ihm finden. All meine früheren Eindrücke wurden bestätigt. Ich dachte zustimmend an den Ausspruch meines alten Freundes Hugh Weston: »Alle hässlichen Menschen sind böse.«
»Ich brauche noch –«, Mr. Lancaster sah auf die Uhr und schien ein paar kurze, aber komplizierte Berechnungen anzustellen, »achtzehn Minuten.« Er kehrte an seinen Schreibtisch zurück.
Ich setzte mich auf einen unbequemen Stuhl in der Ecke und merkte, wie sich zornige Resignation in mir breitmachte. Ich war tief enttäuscht. Warum? Was hatte ich denn erwartet? Ein herzliches Willkommen, Erkundigungen über meine Reise, Bewunderung, dass ich nicht seekrank geworden war? Nun – ja. Genau das. Wie konntest du nur so dumm sein?, dachte ich. Du hättest es besser wissen müssen. Jetzt sitzt du eine Woche lang bei diesem stumpfen alten Esel fest.
Mr. Lancaster schrieb etwas. Ohne aufzublicken, nahm er die Zeitung vom Schreibtisch und warf sie mir zu. Es war die London Times, drei Tage alt.
»Vielen Dank – Sir«, sagte ich so bissig, wie mein Mut es zuließ. Das war meine Kriegserklärung. Mr. Lancaster zeigte keine Reaktion.
Dann griff er zum Hörer. Er telefonierte auf Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch. Alle Sprachen hatten bei ihm denselben Klang und dieselbe Satzmelodie. Hin und wieder wurde er laut, und ich begriff, dass er seiner Stimme lauschte und dass ihm gefiel, was er hörte. Sie hatte eindeutig etwas Priesterliches und auch etwas Präsidiales; nur nichts von einem Geschäftsmann. Mehrmals schlug er einen Befehlston an. Einmal wurde er fast liebenswürdig. Er konnte seine Hände nicht einen Moment lang stillhalten, und beim kleinsten Problem reagierte er gereizt und wurde nervös.
Er brauchte über eine halbe Stunde.
Dann stand er ohne Vorankündigung auf, sagte: »Das war’s« und verließ das Büro, sodass mir nichts anderes übrigblieb, als ihm zu folgen. Die erwachsenen Angestellten waren alle fort, vermutlich in der Mittagspause. Der Junge hielt die Stellung. Mr. Lancaster sagte etwas auf Deutsch zu ihm, dem ich nur entnahm, dass er Waldemar hieß. Im Hinausgehen grinste ich ihm zu, ein intuitiver Versuch, mich mit ihm gegen Mr. Lancaster zu verbünden. Er verzog keine Miene und schenkte mir nur eine kleine, steife deutsche Verbeugung. Ich war fassungslos, dass ein Halbwüchsiger sich so kriecherisch benahm. Mr. Lancaster brach sie offenbar schon in der Jugend. Oder stellte er mich – ein schrecklicher Gedanke! – auf eine Stufe mit Mr. Lancaster und behandelte mich deshalb mit demselben höhnisch-verächtlichen Respekt? Ich bezweifelte es. Wahrscheinlich war Waldemar genauso bieder wie sein Chef und versuchte, ihn zu imitieren, weil er ihn für den Inbegriff eines Mannes von Welt hielt.
Wir fuhren mit der Straßenbahn zu Mr. Lancasters Wohnung. Es war ein warmer, schwüler Frühlingstag. Ich schwitzte wegen des schweren Koffers und des Mantels – ich hatte ihn angezogen, damit ich ihn nicht schleppen musste –, aber ich genoss das Wetter. Es machte mich unruhig und erregte mich. Ich war froh über das Gedränge in der Bahn – nicht nur, weil ich dadurch von Mr. Lancaster getrennt wurde und mich nicht mit ihm unterhalten musste, sondern auch, weil ich gegen die Körper junger Deutscher meines Alters, Männer und Frauen, gepresst wurde; die Grenze zwischen unseren Nationalitäten schien sich aufzulösen, während uns der schwankende Waggon zu einem dichten Menschenknäuel verwob. Auch draußen waren viele junge Leute unterwegs, auf Fahrrädern. Die Schüler trugen Mützen mit glänzenden Schirmen und farbenfrohe, am Hals offene Hemden mit Bändern statt Knöpfen. Die bunt bemalte Straßenbahn brauste rasselnd und klingelnd durch lange Straßen, gesäumt von weißen Häusern in Gärten voller Fliederbüsche, die Stuckfassaden bewachsen mit großblättrigem Wilden Wein. Wir fuhren an einem Brunnen vorbei – eine Figurengruppe mit Laokoon und seinen Söhnen, die sich im Würgegriff der Schlangen wanden. Bei dem sonnigen Wetter konnte man sie fast beneiden. Denn die Schlangen spien kaltes Wasser über die nackten, erhitzten Leiber der Männer, und der tödliche Ringkampf wirkte sinnlich und träge.
Mr. Lancaster wohnte im Erdgeschoss eines großen Hauses, dessen Front nach Norden ging. Die hohen Räume waren luftig und hässlich. Sie wurden durch große weiße Schiebetüren getrennt, die sich bei bloßer Berührung verblüffend schwungvoll öffneten, mit einem Rumsen, das durchs ganze Haus hallte. Die Wohnung war im germanischen Jugendstil möbliert. Stühle, Tische, Schränke und Bücherregale hatten grauenhaft kantige Formen, die augenscheinlich von einer tiefen Abscheu gegen jeden Komfort und einem unbeugsamen Puritanismus zeugten. Ein ebenso grauenhafter Fries aus kahlen Zweigen zierte die Wohnzimmerdecke, und die Hängelampe in der Mitte war eine schmucklose Lotusknospe in säuerlichem Grün. Im Winter musste es hier unbeschreiblich trostlos sein; jetzt spendete die Wohnung wenigstens Kühle. Mr. Lancasters einziger erkennbarer Beitrag zur Einrichtung bestand aus einigen Fotografien aus der Schul- und Armeezeit.
Das eindrucksvollste Foto in Mr. Lancasters Sammlung war die große Aufnahme eines kraftstrotzenden, bärtigen alten Mannes von vielleicht fünfundsiebzig Jahren. Was für ein Bart! Ein Prachtexemplar, nicht mehr erhältlich, aus Sterlingsilber; der Bart eines waschechten viktorianischen Patriarchen. Haarmassen ergossen sich sintflutartig von den leicht gewölbten Nasenlöchern und den fleischigen Ohren hinab zu den Wangen, türmten sich dort zu zwei schäumenden Flutwellen auf, die unter dem Kinn zusammenstießen und reißende Stromschnellen erzeugten, denen kein Boot hätte standhalten können. Wie stolz der Alte seine Herrlichkeit zur Schau stellte – den Kopf leicht angehoben, um sich bewundern zu lassen, in einer Pose ungehemmter Launenhaftigkeit!
»Mein lieber alter Vater«, sagte Mr. Lancaster andächtig und gab mir so zu verstehen, dass der Bart jetzt bei Gott war. »Bevor er sechzehn war, hatte er Kap Hoorn umsegelt und war bis zum Rand des Eises, nördlich der Aleuten, vorgedrungen. Als er in deinem Alter war, Christopher« – hier klang ein leiser Vorwurf an –, »segelte er als Zweiter Offizier von Singapur durchs Chinesische Meer. Wenn Taifune wüteten, übersetzte er Xenophon. Alles, was ich weiß, habe ich von ihm.«
Das Mittagessen war kalt. Es bestand aus Schwarzbrot, hartem, gelbem holländischem Käse und verschiedenen Würsten – alle von der unanständig rosafarbenen Sorte, die streng riecht, voller Knorpel ist und im Anschnitt einem uralten Kirchenfenster ähnelt.
Bevor wir einen Bissen gegessen hatten, teilte Mr. Lancaster mir mit, dass er von Mittagsschlaf nichts hielt. »Als ich die Niederlassung in Valparaiso leitete, redete mein Vize ständig auf mich ein, ich solle wie die anderen Angestellten Siesta halten. Also sagte ich zu ihm: ›Das ist die Zeit, in der der weiße Mann den Kanaken zuvorkommt.‹«
Diese Bemerkung war, wie ich bald feststellen sollte, ein typisches Beispiel für Mr. Lancasters kühne reaktionäre Reden. In diesem Fall fungierte sie zweifellos als erzieherische Maßnahme, da er es für ausgemacht hielt, dass ich romantische, liberale Ansichten vertrat, denen man entgegenwirken musste. Darin lag er sowohl richtig als auch falsch. Auf diffuse, unreflektierte Weise hatte ich tatsächlich liberale Ansichten, doch irrte er sich in der Annahme, er könnte mich durch das Äußern gegensätzlicher Meinungen erschüttern. Erschüttert wäre ich nur gewesen, wenn er meine Ansichten geteilt hätte; stattdessen nahm ich seine Vorurteile ganz selbstverständlich hin, ohne Neugier, denn sie fügten sich nahtlos in das Bild, das ich von ihm hatte.
Im Grunde, glaube ich, wähnte sich Mr. Lancaster über den Gegensatz von Links und Rechts erhaben. Er bezog seine Standpunkte aus seiner unfehlbaren Lebenserfahrung und der müden Erkenntnis, alles gesehen zu haben, was sich zu sehen lohnt. Auch die Literatur hatte er hinter sich gelassen. Die Abende, erzählte er, verbringe er in der kleinen Werkstatt im hinteren Teil der Wohnung mit Tischlerarbeiten – »um mich vom Lesen fernzuhalten«.
»Für Bücher als solche habe ich keine Verwendung«, verkündete er. »Wenn ich bekommen habe, was ich von ihnen will, werfe ich sie weg … Erzählt mir jemand von einer neu entdeckten Philosophie, von einer Idee, die die Welt verändern wird, greife ich zu den Klassikern und sehe nach, welcher große Grieche sie am besten formuliert hat … Die Schreiberei ist in letzter Zeit zu einer Nervenkrankheit geworden. Und sie breitet sich überall aus. Zweifellos, mein armer Christophilos, wirst auch du in Kürze tief genug gesunken sein, um einen Roman zu verbrechen!«
»Ich habe gerade einen veröffentlicht.«
Kaum war es heraus, erschrak ich über mich selbst und schämte mich. Es war, als wären die Worte von selbst aus meinem Mund gekommen. Nicht einmal ein Staatsanwalt vor Gericht hätte mich so raffiniert zu einem Geständnis verleiten können wie Mr. Lancaster.
Das Demütigendste an meinem Geständnis war, dass es ihn weder zu überraschen noch zu interessieren schien. »Schick mir bei Gelegenheit ein Exemplar«, sagte er ungerührt. »Du bekommst es zurück, die getrennten Infinitive rot unterstrichen und alles Unlogische blau.« Er klopfte mir auf die Schulter; ich zuckte vor Abscheu zusammen. »Ach, übrigens«, fuhr er fort, »wir müssen später zu einem albernen, unbedeutenden Bankett –«, er sagte es in einem besonderen, verschmitzten Ton, als wollte er meine ehrerbietige Aufmerksamkeit darauf lenken, dass es sich dabei um ein humorvoll gemeintes Zitat aus dem Göttlichen Schwan handelte, »alle Lokalgrößen von den Reedereien, Konsulaten und so weiter werden dort sein. Du wirst mich begleiten.«
»Nein«, sagte ich. Und das war mein Ernst. Ich hatte genug. Die Menge an kostbarer Lebenszeit, die ich auf diesen ignoranten, beleidigenden, selbstgefälligen Dummkopf verschwenden konnte, war begrenzt. Ich würde einfach gehen, sofort, an diesem Nachmittag. Ich hatte ein bisschen Geld. Ich würde in ein Reisebüro gehen und mich erkundigen, wie viel eine herkömmliche, gesittete Fahrt dritter Klasse zurück nach England kostete. Wenn das Geld nicht reichte, würde ich mir ein Hotelzimmer nehmen und meine Mutter per Telegramm um mehr bitten. Die Sache war ganz einfach. Mr. Lancaster war nicht der Alleinherrscher über die Welt, und er konnte mich durch nichts daran hindern. Das wusste er so gut wie ich. Ich war kein Kind mehr. Und doch …
Und doch – aus irgendeinem absurden, irrationalen, ärgerlichen, erniedrigenden Grund – hatte ich Angst vor ihm! Unglaublich, aber wahr. Solche Angst, dass ich zitterte und mir fast die Stimme versagte, als ich gegen ihn aufbegehrte. Mr. Lancaster schien mich gar nicht gehört zu haben.
»Das wird eine wichtige Erfahrung für dich«, sagte er, während er auf seinem alten harten Käse kaute.
»Ich kann nicht«, sagte ich, diesmal übertrieben laut.
»Was kannst du nicht?«
»Mitkommen.«
»Warum nicht?« Er zeigte sich nachsichtig; ein Erwachsener, der sich die Ausflüchte eines Schülers anhört.
»Ich … ich habe keinen Smoking.« Wieder erschrak ich über mich selbst. Dieser Verrat geschah so unfreiwillig wie der erste; bis zu dem Moment, als ich es aussprach, hatte ich geglaubt, ich würde ihn über meine Abreise in Kenntnis setzen.
»Davon bin ich ausgegangen«, sagte Mr. Lancaster unbeirrt. »Ich habe meinen Vize gebeten, dir seinen zu borgen. Er hat etwa deine Größe und muss heute Abend zu Hause bleiben. Seine Frau erwartet schon wieder ein Kind. Das fünfte. Sie vermehren sich wie Ungeziefer. Das ist die wahre Gefahr der Zukunft, Christopher. Nicht Krieg. Nicht Krankheit oder Hungersnot. Sie laichen sich zu Tode. Ich habe 21 davor gewarnt. Einen langen Brief an die Times geschrieben, in dem ich einen explosiven Anstieg der Geburtenrate vorhersagte. Meine Prognose hat sich bestätigt. Aber sie fürchteten sich. Die Wahrheit war zu entsetzlich. Nur der erste Absatz wurde abgedruckt –« Er stand abrupt auf. »Du kannst dir jetzt die Stadt ansehen. Sei um Punkt sechs zurück. Nein – besser um fünf vor sechs. Ich habe jetzt zu tun.« Und damit ließ er mich allein.
Das Bankett wurde in den Festräumen eines großen Restaurants mitten in der Innenstadt abgehalten.
Bei unserer Ankunft legte Mr. Lancaster sofort ein geschäftiges Verhalten an den Tag. Sein Blick schwirrte in alle Richtungen, und er ließ mich immer wieder stehen, um mit neu eingetroffenen Gästen zu sprechen. Er trug einen grünlich schwarzen Smoking im Stil der Zeit vor 1914, und in der gestärkten Hemdmanschette steckte ein weißes Seidentuch. Mein geliehener Smoking war mir eindeutig zu groß; ich fühlte mich darin wie ein Laienzauberer – ohne Kaninchen in den großen Taschen.
Mr. Lancaster war nervös! Er verspürte offensichtlich das Bedürfnis, mich in seine Sorgen einzuweihen, aber er konnte nicht. Er brachte nicht einen klaren Satz hervor, sondern murmelte Unzusammenhängendes, während er den Blick durch den Raum schweifen ließ.
»Siehst du – die Hauptversammlung. Gewöhnlich eine reine Formsache. Aber dieses Jahr – gewisse Einflüsse – absolute Entschlossenheit – man muss ihnen begreiflich machen, was auf dem Spiel steht. Die Alternative wäre nämlich. Wie überall heutzutage. Muss bekämpft werden. Kompromisslos. Meinen Standpunkt klarmachen – ein für alle Mal. Warten wir es ab. Ich glaube nicht, dass sie es wagen –«
Die Versammlung, worum es dabei auch ging, schien in Kürze zu beginnen. Denn die Gäste bewegten sich bereits auf eine Tür am anderen Ende des Raumes zu. Ohne mich anzuweisen, auf ihn zu warten, schloss Mr. Lancaster sich ihnen an. Mir blieb nichts anderes übrig, als auf meinem Platz zu bleiben, am äußersten Rand eines langen Sofas gegenüber eines großen Wandspiegels.
Nur ganz selten im Leben – Gott weiß, warum – hat man das Gefühl, dass ein Spiegel das eigene Bild einfängt und es festhält wie eine Kamera. Jahre später muss man nur an diesen Spiegel denken und sieht sich so, wie man damals darin ausgesehen hat. Man erinnert sich sogar daran, was man beim Blick hinein empfunden hat. Mit neun Jahren schoss ich zum Beispiel in einem Schulfußballspiel mit maßlos viel Glück ein Tor. Als ich vom Platz ging, blickte ich in der Umkleide in den Spiegel, in der Erwartung, dieser unwahrscheinliche sportliche Erfolg müsste mein Äußeres verändert haben. Hatte er nicht, aber ich weiß noch ganz genau, wie ich in diesem Moment aussah und wie ich mich fühlte. Und ich weiß auch, wie ich aussah und wie ich mich fühlte, als ich in diesen Restaurantspiegel starrte.
Ich sehe mein junges Gesicht, das mich unter einem Schopf strähnigen blonden Haars mit großen vorwurfsvollen Augen anblickt. Ein schmales, angespanntes Gesicht, so berückend schön, dass man es hätte fotografieren und auf Plakatgröße hätte bringen können, als Aufruf aller jungen Leute dieser Welt: »Die Alten hassen uns, weil wir so hübsch sind. Bitte helfen Sie!«
Und jetzt empfinde ich, was dieses Gesicht empfindet – das Gefühl des Verlassenseins, unter dem die Jugend ständig leidet. Ihr Gott lässt sie täglich mehrmals im Stich; sie stoßen an ihren Kreuzen unaufhörlich Schreie der Verzweiflung aus. Ich bin nicht wütend auf Mr. Lancaster, weil er mich verlassen hat; ich nehme es ihm nicht einmal richtig übel. Denn in diesem Moment erscheint er mir als nahezu unpersönlicher Ausdruck des Verrats, den die Welt an der Jugend begeht.
Ich habe Todesangst, dass ich vom Maître d’hôtel oder von einem der vielen Kellner zur Rede gestellt werde, die untätig herumstehen und darauf warten, dass das Bankett beginnt. Angenommen, sie fragen mich, was ich hier zu suchen habe – warum ich, wenn ich zu den geladenen Gästen gehöre, nicht mit den anderen auf der Versammlung bin?
Also verwende ich all meine Willenskraft darauf, nicht angesprochen zu werden. Ich richte den Blick starr auf mein Spiegelbild und versuche, diese Männer aus meinem Bewusstsein zu verbannen, jede Andeutung einer möglichen telepathischen Verbindung zwischen uns zu zerstören. Das ist schrecklich anstrengend. Ich zittere am ganzen Körper, und mir ist schlecht. Schweiß rinnt mir über die Schläfen.
Die Sitzung dauerte fast anderthalb Stunden.
Die meisten Gäste kamen zu zweit oder zu dritt zurück, nur Mr. Lancaster war allein. Er steuerte direkt auf mich zu.
»Jetzt wird gegessen«, sagte er mit gereizter Ungeduld, als hätte ich irgendwelche Einwände erhoben. »Ich habe dich neben den alten Machado setzen lassen. Er wird dir alles über Peru erzählen. Er ist ihr hiesiger Vizekonsul. Du sprichst doch Französisch?«
»Nicht ein Wort.« Das war gelogen. Aber ich wollte Mr. Lancaster verunsichern und ihm als Strafe dafür, dass er mich allein gelassen hatte, ein schlechtes Gewissen machen.
Er hörte mir gar nicht zu. »Gut. Das wird eine wichtige Erfahrung für dich.« Und schon war er wieder fort. Ich schloss mich der Menge an, die sich in Richtung Esszimmer bewegte.
Der Raum war sehr groß, ein richtiger Festsaal. Vier lange Tische standen darin. Ganz am Ende, unter hängenden Nationalflaggen, befand sich offensichtlich der Ehrentisch. Mr. Lancaster nahm dort bereits Platz. Ebenso einfach zu erkennen war der unwichtigste Tisch, gleich neben der Tür. Und tatsächlich trug eines der Tischkärtchen meinen Namen. Zu meiner Rechten las ich den Namen Emilio Machado, und einen Augenblick später setzte sich Sr. Machado neben mich. Er war ein winziger Mann in den Siebzigern. Sein gutmütiges mahagonibraunes Gesicht war durchzogen von Falten – diese waren von leicht hellerer Farbe – und wurde von einem herunterhängenden weißen Schnauzbart geziert. Sein Mund verzog sich zu einem kläglichen, albernen Lächeln, als er das Mienenspiel einiger sich laut unterhaltender Gäste gegenüber beobachtete, doch ich hatte nicht den Eindruck, dass er angesprochen werden wollte.
Das Essen war zu meiner Überraschung hervorragend. (Ich verband alles in dieser Stadt mit Mr. Lancaster und war daher geneigt zu vergessen, dass er mit der Bewirtung unmöglich etwas zu tun haben konnte.) Nach der Suppe begannen die Gäste, sich paarweise zuzuprosten. Dabei erhob sich ein Gast mit dem Glas in der Hand halb von seinem Platz und wartete, bis die gewünschte Person seinen Blick erwiderte. Diese stand ebenfalls auf, die Gläser wurden erhoben, und man verbeugte sich. Es handelte sich eindeutig um eine ernste Angelegenheit. Ich war mir sicher, dass jeder Toast aufmerksam registriert wurde und es sich ausgesprochen nachteilig auf die eigenen Geschäfte ausgewirkt hätte, jemanden zu übergehen.
Die Prozedur machte mich darauf aufmerksam, dass mein Glas leer war. Offenbar wurden die Getränke nicht mit den Speisen serviert; man musste sie extra bestellen. In der Eile des Umziehens hatte ich vergessen, Geld einzustecken; ich würde die Rechnung an Mr. Lancaster schicken lassen müssen. Aber darüber machte ich mir keine Sorgen. Geschieht ihm recht, dachte ich, weil er dich vernachlässigt hat. Ich beschloss, mich an Sr. Machado zu wenden und ihn zu bitten, sich eine Flasche Wein mit mir zu teilen. Auch er hatte nichts zu trinken. Ich holte tief Luft: »Si vous voulez, Monsieur, j’aimerais bien boire quelque chose –«
Er hörte mich nicht. Ich bekam vor Scham einen heißen Kopf. Aber dann hörte ich an meinem anderen Ohr eine Stimme: »Sie sind Mr. Lancasters Neffe, nicht wahr?«
Ich zuckte schuldbewusst zusammen. Denn die schwierige Kontaktaufnahme mit Sr. Machado hatte mich so beansprucht, dass ich meinen anderen Tischnachbarn kaum wahrgenommen hatte. Es war ein Mann mit gierigem Gesicht und funkelnden Augen, lächelnd und ohne Kinn. Das dünne, glatte graue Haar war streng nach hinten gekämmt. Ein Monokel hing an einem breiten Seidenband vor seiner Brust. Seine Mundwinkel zeigten leicht nach unten, was ihm eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Hai verlieh – nicht von der gefährlichen Sorte allerdings; ganz sicher kein Menschenfresser. Ich schielte auf sein Tischkärtchen und las einen ungarischen Namen, den nur ein Ungar richtig aussprechen kann.
»Ich bin nicht sein Neffe«, sagte ich. »Eigentlich bin ich nicht einmal mit ihm verwandt.«
»Ach so?« Das freute den Hai. »Sie sind nur Freunde?«
»Ich nehme an.«
»Ein Frrreund?«, rief er mit herrlich rollendem R. »Mr. Lancaster hat einen joongen Frrreund!«
Ich schmunzelte. Ich hatte das Gefühl, den Hai bereits bestens zu kennen.
»Aber er lässt Sie allein! Das ist nicht sehr freundlich.«
»Nun, jetzt sind Sie ja da, um auf mich aufzupassen.«
Das löste beim Hai kreischendes Gelächter aus. (Bei genauer Überlegung hatte er auch etwas von einem Papagei.)
»Ich soll auf Sie aufpassen?«, sagte der Papageienhai. »Ah, einverstanden! Das werde ich, das werde ich. Bitte, seien Sie unbesorgt!« Er winkte einen Kellner herbei. »Helfen Sie mir, eine große Flasche Wein zu trinken? Es ist nicht gut für mich, wenn ich immer allein trinken muss.«
»Gar nicht gut.«
»Und jetzt erzählen Sie mir bitte – Sie sind Mr. Lancasters Freund, seit wann?«
»Seit heute Morgen.«
»Seit heute Morgen erst!« Der Papageienhai war nicht so schockiert, wie er vorgab, aber er war ehrlich verblüfft. »Und er lässt Sie schon alleine?«
»Ach, das bin ich gewohnt!«
Die Neugier in seinem Blick nahm deutlich zu, vielleicht weil ihm aufging, dass hier irgendetwas nicht ganz alltäglich, sogar ein bisschen unheimlich war. Hätte er gewusst, was für einen überaus sonderbaren jungen Fisch er an der Angel hatte, wäre er möglicherweise schreiend aus dem Saal geflüchtet. Doch in diesem Augenblick kam der Wein, und seine Neugier war rasch vergessen.
Von da an lief alles wie von selbst. Der Papageienhai war leicht bei Laune zu halten, erst recht, als die erste Flasche geleert war und er eine neue bestellte. Nach dem Hauptgang wurde es dunkel im Saal, und die Kellner brachten Eisbomben mit bunten Lichtern darauf. Dann folgten die Reden. Ein dicker, glatzköpfiger Mann erhob sich mit dem Selbstvertrauen einer Berühmtheit. Der Papageienhai flüsterte mir zu, das sei der Bürgermeister. Jemand hatte mir einmal erklärt, wie man auf Deutsch eine Geschichte erzählt: Man spart sich die Pointe möglichst auf und packt sie in das letzte Verb am Ende des allerletzten Satzes. Kurz bevor man am Ziel ist, legt man eine dramatische Pause ein, dann schleudert man das wuchtige, ungraziöse, vielsilbige Verb wie ein Würfelspieler auf den Tisch.
Am Ende jeder Rede brach das Publikum in tosenden Beifall aus und wischte sich mit Taschentüchern die schwitzenden Gesichter. Doch als Mr. Lancaster an der Reihe war, waren sie schon etwas müde und nicht mehr so leicht zufriedenzustellen. Seine Rede wurde lediglich mit höflichem Applaus bedacht.
»Mr. Lancaster hat schlechte Laune heute Abend«, erklärte mir der Papageienhai mit sichtlicher Genugtuung.
»Warum denn das?«
»Dies ist ein Club für die Ausländer, die in der Stadt arbeiten. Mr. Lancaster ist seit drei Jahren unser Vorsitzender. Bis jetzt wurde er immer ohne Widerstand gewählt – weil er eine so mächtige Reederei vertritt –«
»Und in diesem Jahr haben Sie einen anderen gewählt?«
»Nein, nein. Wir haben ihn gewählt. Aber erst nach langer Debatte. Wir wählen ihn, weil wir Angst vor ihm haben.«
»Ha, ha! Sehr komisch!«
»Es ist wahr! Wir alle haben Angst vor Mr. Lancaster. Er ist unser Schulmeister. Nein – bitte sagen Sie ihm das nicht! Ich scherze nur.«
»Ich habe keine Angst vor ihm«, prahlte ich.
»Ach, bei Ihnen ist das etwas anderes! Sie sind auch Engländer. Ich glaube, wenn Sie in Mr. Lancasters Alter sind, fürchten sich die Leute auch vor Ihnen.« Aber der Papageienhai meinte es nicht ernst: Er glaubte nicht eine Sekunde daran. Er tätschelte mir die Hand. »Es macht mir Spaß, Sie ein wenig zu necken.« In diesem Einvernehmen tranken wir auf unser Wohl und leerten die dritte Flasche.
An den Rest des Abends erinnere ich mich nur undeutlich. Nach den Reden erhoben sich die Gäste von den Stühlen. Einige gingen vermutlich nach Hause. Die meisten nahmen die Sitzgelegenheiten in den Nebenräumen in Beschlag und bestellten mehr zu trinken. Tischchen wurden gebracht, um die Gläser darauf abzustellen. Wer leer ausgegangen war, schlenderte aufmerksam umher, um einen frei gewordenen Platz zu erobern. Das Licht kam mir sehr hell vor. Das laute Stimmengewirr dämpfte sich in meinen Ohren zu einem tiefen, schläfrigen Brummen. Ich saß an einem Tisch in einem Alkoven. Der Papageienhai passte weiter auf mich auf, und einige seiner Freunde hatten sich zu ihm gesellt. Nicht alle waren Ungarn, glaube ich – einer schien vielmehr Franzose zu sein und ein anderer Skandinavier –, aber sie verhielten sich, als gehörten sie zusammen. Es schien, als wären sie Mitglieder einer Geheimgesellschaft, denn ihre Reden steckten voller Codewörter und mit wissendem Lächeln quittierten Losungen. Mein Bauchgefühl sagte mir, dass sie alle gegen Mr. Lancasters Wiederwahl rebelliert hatten. Sie wirkten nicht besonders furchteinflößend; es war kein Wunder, dass er sie besiegt hatte. Aber sie waren entschlossener und gefährlicher, als sie vermuten ließen. Sie waren lächelnde Feinde, Wadenbeißer, Heckenschützen, die schnell davonhuschten, aber mit Sicherheit wiederkamen.
Machado war längst fort. Dafür tauchte Mr. Lancaster mehrere Male kurz in meinem Blickfeld auf. Überrascht stellte ich fest, dass er genauso betrunken war wie ich. Ich hatte angenommen, dass er, aus Überzeugung oder Vorsicht, streng enthaltsam lebte oder aber eine Menge vertrug. Wir tranken jetzt Likör. Ich war schon halb vornübergesunken. »Müde?«, fragte der Papageienhai. »Ich mache Sie wieder munter!« Er rief den Kellner und gab ihm auf Deutsch genaue Anweisungen, wobei er seinen Freunden zuzwinkerte. Alle lachten. Ich lachte auch. Es war mir wirklich völlig egal, was sie mit mir anstellten.
Der Kellner brachte das Getränk. Ich roch daran. »Was ist das?«, fragte ich.
»Ach, nur eine kleine besondere Arznei.« Die Gesichter vom Papageienhai und seinen Mitverschwörern waren plötzlich ganz nah. Sie bildeten einen Kreis, der mich auf betörende Weise umschloss. Ihre Blicke folgten jeder meiner Bewegungen, mit einem Interesse, das mir gefiel und schmeichelte. Es war auf jeden Fall eine Abwechslung, im Mittelpunkt derart geballter Aufmerksamkeit zu stehen. Ich roch wieder an dem Getränk. Es handelte sich um eine Art Cocktail; ich machte einen moschusartigen Geruch aus, der möglicherweise Nelken enthielt.
Etwas veranlasste mich, mich umzudrehen. Und da stand Mr. Lancaster. Mein Gefühl für Entfernungen war nicht mehr besonders zuverlässig; er schien etwa fünfundzwanzig Meter weit weg zu stehen und an die vier Meter groß zu sein. In Wahrheit muss er direkt hinter meinem Stuhl gestanden haben. Er sagte scharf: »Trink das nicht, Christopher, das ist ein Trick –« (oder vielleicht: »Das macht dick«; ich weiß es nicht).
Es gab eine lange Pause, in der ich wahrscheinlich dümmlich grinste. Der Papageienhai sagte lächelnd: »Hören Sie, was Herr Lancaster sagt? Sie dürfen das nicht trinken.«
»Nein«, sagte ich, »das werde ich auch nicht. Ich will doch meinen lieben Cousin nicht verärgern.« Mit diesen Worten hob ich das Glas an den Mund und trank es in einem Zug leer. Es war, als hätte ich eine Rakete verschluckt. Durch den Schock war ich einen Augenblick lang stocknüchtern. »Faszinierend«, hörte ich mich sagen, »eine reine Reflexhandlung. Ich meine – also – hätte er gesagt, ich soll es nicht trinken – ich meine, dann –«
Der Satz blieb in der Luft hängen, und ich hatte keine Lust, ihn zu beenden. Als ich aufblickte, stellte ich überrascht fest, dass Mr. Lancaster verschwunden war. Wahrscheinlich waren mehrere Minuten vergangen.
»Er kann Sie nicht leiden«, sagte ich unvermittelt zum Papageienhai.
Der Papageienhai grinste. »Das kommt, weil er Angst hat, dass ich Sie ihm stehle.«
»Und worauf warten Sie dann noch?«, rief ich herausfordernd. »Wollen Sie mich denn nicht stehlen?«
»Das werden wir«, sagte er, doch er blickte weiter besorgt hinüber zu Mr. Lancaster, der in mittlerer Entfernung wieder aufgetaucht war. »Es gibt hier eine Bar«, flüsterte er mir zu, »unten am Hafen. Da ist es sehr unterhaltsam.«
»Was meinen Sie damit – unterhaltsam?«
»Sie werden schon sehen.«
Seine Worte zerstörten den Zauber. Auf einmal war ich entsetzlich gelangweilt. Ja, auf meine sadistische Art hatte ich mit dem Papageienhai geflirtet; ihn dazu aufgerufen, meinen Willen zu brechen, mich in Erstaunen zu versetzen, mich zu beherrschen, mich zu entführen. Armes, scheues Wesen, er hätte nicht einmal eine Maus entführen können! Er hatte kein Vertrauen in seine eigenen Begierden. Ihm fehlte jede Schamlosigkeit. Vermutlich hielt er sich selbst für einen Verführer. Aber seine Verführungsmethoden waren in den Neunzigern aus der Mode gekommen. Sie ähnelten einem endlos langen, sehr schlecht geschriebenen Buch, das ich, wie mir jetzt klar war, nie hatte lesen wollen.
»Unterhaltsam?«, sagte ich. »Unterhaltsam?«
Damit stand ich in all meiner betrunkenen Würde auf und ging langsam zu Mr. Lancaster hinüber. »Bring mich nach Hause«, sagte ich gebieterisch. Es muss gebieterisch gewesen sein, denn er gehorchte auf der Stelle!
Am nächsten Morgen beim Frühstück wirkte Mr. Lancaster schwer angeschlagen. Seine arme Nase war röter denn je und sein Gesicht grau. Er saß antriebslos am Tisch und ließ mich das Essen aus der Küche holen. Ich summte dabei vor mich hin. Ich war ungewöhnlich heiter. Mir war bewusst, dass Mr. Lancaster mich beobachtete.
»Ich hoffe, du nimmst kalte Bäder, Christopher.«
»Ich habe vorhin eins genommen.«
»Braver Junge! Das ist eine der Gewohnheiten, an denen man einen Mann erkennt.«
Ich wollte laut auflachen. Denn ich nahm nur ein kaltes Bad, wenn ich getrunken hatte, und hätte es als peinlich und reaktionär empfunden, es aus anderen Gründen zu tun. Dieses eine Mal gab ich Mr. Lancaster recht: Kalt zu baden war eine Gewohnheit, an der man einen Mann erkannte – es kennzeichnete ihn als Feind. Dennoch musste ich bekennen, dass ein Teil von mir, meine Spaniel-Seite, die ich verabscheute, Mr. Lancasters unberechtigtes Lob gierig aufleckte!
Insgesamt hatte sich unser Verhältnis deutlich verbessert; zumindest meinerseits. Ich hatte das Gefühl, ihn übertrumpft zu haben, und konnte es mir daher leisten, gnädig zu sein. Ich hatte ihm hinsichtlich des Cocktails die Stirn geboten und war ungestraft davongekommen. Ich hatte einen Blick hinter die Kulissen seines Berufslebens geworfen und gesehen, dass er nicht unverwundbar war; zumindest war er das Ziel belangloser Ambitionen. Vor allem aber war er heute Morgen verkatert und ich nicht – na ja, nicht allzu sehr.
»Leider war ich gestern Abend ein wenig abgelenkt«, sagte er. »Ich hätte dich beiseitenehmen und dir alles in Ruhe erklären sollen. Ich befand mich in einer sehr heiklen Lage. Ich musste schnell handeln –« Mir wurde klar, dass es gar nicht seine Absicht war, mir von dem Club und dem Kampf um seine Wiederwahl zu erzählen; das hätte sich nicht wichtig genug angehört. Also flüchtete er sich in hochtrabende Verallgemeinerungen: »Überall auf der Welt geht das Böse um. Ich bin in Russland gewesen, ich kenne mich aus. Ich weiß, wann ich es mit Satanisten zu tun habe. Und sie werden von Jahr zu Jahr dreister. Sie kriechen nicht mehr in der Gosse herum. Sie sitzen in Machtpositionen. Ich wage eine Prognose – präge dir meine Worte gut ein –, in zehn Jahren kannst du diese Stadt weder mit deiner Mutter, deiner Frau noch einem anderen unbescholtenen weiblichen Wesen besuchen. Es wird hier – und ich sage nicht schlimmer, denn das wäre unmöglich – genauso schlimm sein wie in Berlin!«
»Ist Berlin denn so schlimm?«, fragte ich, bemüht, nicht allzu interessiert zu wirken.
»Christopher – nirgends, nicht in Tausendundeine Nacht, den schamlosesten Ritualen des Tantra, auf den Steinreliefs der Schwarzen Pagode, den japanischen Bordellbildern, in den abscheulichsten Perversionen der orientalischen und asiatischen Phantasie, findet man Ekelerregenderes als das, was sich dort, ganz öffentlich, Tag für Tag abspielt. Diese Stadt ist dem Untergang geweiht, mehr, als es Sodom je war. Die Menschen dort begreifen gar nicht, wie tief sie gesunken sind. Das Böse erkennt sich nicht als böse. Es herrscht der schlimmste aller Teufel – der Teufel ohne Gesicht. Du bist behütet aufgewachsen, Christopher. Gott sei es gedankt. Du kannst dir solche Dinge gar nicht vorstellen.«
»Nein – sicher nicht«, sagte ich lammfromm. Und ich traf auf der Stelle eine Entscheidung – eine Entscheidung, die mein gesamtes weiteres Leben prägen sollte. Ich beschloss, dass ich, egal wie, so bald wie möglich nach Berlin fahren und dort sehr, sehr lange bleiben würde.
Am Nachmittag beauftragte Mr. Lancaster Waldemar, mir die Stadt zu zeigen. Wir sahen uns die Gemälde im Rathaus an und besuchten den Dom. Kapitän Dobson hatte mich neugierig auf den darunterliegenden Bleikeller gemacht, in dem es mumifizierte Leichen von Menschen und Tieren zu bestaunen gab. Er hatte sie sich mit seinem Bruder angesehen: »Eine ist eine Frau. Sie trägt eine schwarze Unterhose. Und da dachte ich mir, ich würde gerne wissen, wie sich die Lage dort unten entwickelt hat. Ein Aufseher schob Wache, aber er drehte uns den Rücken zu. Also bat ich meinen Bruder, den alten Tirpitz im Auge zu behalten. Und dann lüpfte ich sie. Und wissen Sie, was? Da war nichts – gar nichts! Die Ratten müssen sich über sie hergemacht haben.«
Mit ihrem ausgetrockneten, eingefallenen Fleisch waren die Toten kaum mehr als Gerippe; die Haut sah aus wie schwarzes Gummi. Auch diesmal war ein Aufseher zugegen; er drehte uns jedoch nicht den Rücken zu, sodass ich keine Gelegenheit hatte, Kapitän Dobsons Geschichte zu überprüfen. Bei dem Gedanken daran musste ich lächeln; gerne hätte ich sie Waldemar erzählt. Eine Amerikanerin, die mit uns im Keller war, fragte mich, wie man die Leichen konserviert hätte. Als ich gestand, es nicht zu wissen, schlug sie vor, ich solle Waldemar fragen. Ich musste ihr erklären, dass das nicht möglich sei. Worauf sie zu ihrem Begleiter sagte: »Ach – ist das nicht goldig? Dieser junge Mann spricht kein Deutsch und sein Freund kein Englisch!«
Ich fand das gar nicht goldig. Waldemars Gesellschaft war mir unangenehm. Er war vermutlich ein netter Junge. Auf jeden Fall sah er gut aus; mit seinen hohen Wangenknochen war er im gotischen Sinne sogar schön. Er ähnelte einer der steinernen Engelsfiguren in der Kirche. Zweifellos hatte der Bildhauer im 12. Jahrhundert einen solchen Jungen – vielleicht sogar einen direkten Vorfahren Waldemars – als Modell genommen. Ein Engel ist jedoch keine besonders aufregende Begleitung, vor allem wenn er nicht deine Sprache spricht; außerdem verhielt sich Waldemar ausgesprochen passiv. Er dackelte mir hinterher, ohne die geringste Initiative zu zeigen. Ich nahm an, dass er mich so ermüdend fand wie die Sehenswürdigkeiten und sich nur mit dem Gedanken tröstete, dass es im Kontor noch öder wäre.
Die vier Tage, die ich jetzt bei Mr. Lancaster weilte, kamen mir vor wie ein ganzes Leben. Ich bezweifle, dass ich ihn in vier Monaten oder vier Jahren besser kennengelernt hätte.
Natürlich war ich gelangweilt, aber das störte mich nicht sonderlich. (Junge Leute sind meistens gelangweilt – sofern sie nicht völlig geistlos sind. Das heißt, sie sind empört – und das völlig zu Recht –, weil das Leben nicht so großartig ist, wie es ihrer Ansicht nach sein sollte.)
Ich hatte jedoch beschlossen, das Beste aus Mr. Lancaster zu machen. Ich schämte mich, dass ich mich am ersten Tag so unreif ihm gegenüber verhalten hatte. War ich nicht Schriftsteller? Während des Studiums hatten mein Freund Allen Chalmers und ich uns mit dem Motto »Alle Qualen!« angespornt. So begann eine Zeile aus Matthew Arnolds Shakespeare-Sonett: »Alle Qualen muss der unsterbliche Geist erdulden.« Damit riefen wir uns gegenseitig in Erinnerung, dass einem Schriftsteller alles Mögliche als Stoff dienen kann und dass es ihm nicht zusteht, mit der Grundlage seiner Existenz zu hadern. Mr. Lancaster, ermahnte ich mich jetzt, war eine dieser »Qualen«, und ich beschloss, mich damit abzufinden und ihn zu studieren wie ein Wissenschaftler.
Also durchsuchte ich seine Wohnung, als ich das erste Mal allein war, gründlich nach Indizien. Ich hatte ein lächerlich schlechtes Gewissen dabei. Es lag nirgends Teppich, und meine Schritte auf den nackten Dielen waren so laut, dass ich kurz davor war, die Schuhe auszuziehen. In einer Ecke im Wohnzimmer lehnte ein Paar Ski. Die Skier sahen so nach Mr. Lancaster aus, dass sie mir vorkamen wie zu meiner Beobachtung abgestellte Getreue. Ich schnitt ihnen Grimassen. Beobachtet wurde ich sowieso, vom Bart auf dem Foto. Zu gerne hätte er mich auf seinem Schiff gehabt und bei Schneesturm vor Kap Hoorn in die Takelage geschickt! Wenn man ihn ansah und dann an sein Opfer und seinen Schüler Mr. Lancaster dachte, begriff man, welchen Schaden das alte Ungeheuer angerichtet hatte.
Alles in allem erwies sich meine Suche als Enttäuschung. Ich fand so gut wie nichts. Es gab einen verschlossenen Schreibtisch, der möglicherweise Geheimnisse barg; ich würde auf eine Gelegenheit warten hineinzusehen. Alle anderen Schubladen und Schränke waren offen. Meine einzige interessante Entdeckung war eine Hauptmannsuniform der britischen Armee, die zwischen Mr. Lancasters Anzügen im Kleiderschrank hing. Er gehörte also zu den trostlosen Zeitgenossen, die mit ihren Kriegserlebnissen einen Kult trieben! Nun ja, ich hätte es mir denken können. Das war zumindest ein Anfang.
Beim Abendessen – die einzige genießbare Mahlzeit, denn sie wurde von einer Frau zubereitet, die eigens zu diesem Zwecke kam – brachte ich ihn auf das Thema. Das war alles andere als schwierig. Kaum sprach ich das Wort »Krieg« aus, begann er zu schwadronieren:
»Loos – Armentières – Ypern – Saint-Quentin – Compiègne – Abbeville – Épernay – Amiens – Béthune – Saint-Omer – Arras –« Er war in seinen priesterlichen Singsang verfallen, und ich fragte mich schon, ob er je ein Ende finden würde. Aber das tat er, unversehens. Dann sagte er, viel leiser: »Le Cateau« und schwieg. Er hatte den Ort in seinem weihevollsten Ton ausgesprochen. Schließlich erklärte er: »Dort schrieb ich eines der leider Gottes ganz wenigen großen Gedichte über den Krieg.« Wieder erhob sich seine Stimme zum Singsang: »Die ungeheure Wut nur der Kanonen.«
»Aber ist das nicht von –?«, rief ich unwillkürlich und biss mir schnell auf die Zunge, als ich die ganze Schönheit dieser Entdeckung begriff. Mr. Lancaster litt unter echtem Größenwahn!
»Ich hätte Schriftsteller werden können«, fuhr er fort. »Ich verfügte über die Gabe, die nur die größten Dichter haben – die Gabe, vollkommen objektiv auf alle menschliche Erfahrung hinunterzublicken.« Er sagte es mit einer Überzeugung, dass es fast gespenstisch war. Ich musste daran denken, wie die Toten bei Dante über sich selbst sprechen.
»Tolstoi hatte sie auch«, sinnierte Mr. Lancaster, »aber Tolstoi war verdorben. Das weiß ich, denn ich habe in sechs Ländern gelebt. Er konnte kein Bauernmädchen ansehen, ohne an die Brüste unter ihrem Kleid zu denken.« Er hielt inne, damit ich mich vom Schock über seine kraftvolle Sprache erholen konnte. Er spielte jetzt die Rolle des großen Romanciers, der, einfach und schonungslos, über das Leben redet, wie er es sieht, frei von Furcht und Begehren. »Eines Tages, Christopher, musst du dort hinfahren und dir selbst ein Bild machen. Die Steppe erstreckt sich Tausende Meilen weit über den Horizont hinaus, und überall herrschen Elend und Hoffnungslosigkeit. Erbärmliche, alles zersetzende Faulheit. Absolute Willensschwäche. Dann wirst du begreifen, warum Russland heute von einer Horde gottloser Juden regiert wird … In England haben wir niemand Größeren hervorgebracht als Keats. Keats hatte ein reines Herz, aber sein Blick war getrübt. Er war zu krank. Man braucht einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Ach, ich weiß, ihr jungen Freudianer spottet über solche Worte, aber die Geschichte wird euch eines Besseren belehren. Eure Generation wird zahlen, zahlen, zahlen. Die Sonne berührt schon den Horizont. Es ist fast zu spät. Die Nacht der Barbaren naht. Über all das hätte ich schreiben können. Ich hätte sie warnen können. Aber ich bin nun mal ein Mann der Tat –
Ich sage dir etwas, mein teuerster Christophilos – ich will dir etwas schenken. Ich schenke dir die Idee für einen Band mit Kurzgeschichten, der dich zu einem angesehenen Schriftsteller machen wird. So etwas wurde noch nie geschrieben. Niemand hat es sich getraut. Sie hatten nur den sogenannten Expressionismus im Kopf. Sie hielten sich für subjektiv. Pah! Ihnen fehlte die Ausdauer. Ihr Geist war verstopft. Alles, was sie hervorbrachten, war trocken wie Schafskötel –
Diese Dummköpfe glauben, Realismus bedeute, über Gefühle zu schreiben. Sie wähnen sich tollkühn, weil sie Dinge mit den Schlagwörtern benennen, die sich die Freudianer ausgedacht haben. Aber das ist nur umgekehrter Puritanismus. Die Puritaner verboten die Verwendung bestimmter Wörter, also befehlen die Freudianer, sie auszusprechen. Das ist der einzige Unterschied. Beide Seiten nehmen sich nichts. In ihren verdorbenen kleinen Herzen fürchten sich die Freudianer genauso vor diesen Wörtern wie die Puritaner – weil in ihren Köpfen immer noch die elende jüdische Nekromantie des Mittelalters herumgeistert –, Rabbi Löw und so weiter … Der wahre Realismus aber – der Realismus, vor dem alle zurückschrecken – hat für solche Wörter keine Verwendung. Der wahre Realismus ist darüber erhaben –
Ich würde also Folgendes tun –«
Hier hielt Mr. Lancaster eindrucksvoll inne, stand auf, ging durch den Raum, zog eine Schublade auf, nahm eine Pfeife heraus, stopfte sie, zündete sie an, schloss die Schublade wieder und kehrte zu seinem Platz zurück. Das Ganze zog sich fast fünf Minuten lang hin. Sein Gesicht blieb währenddessen völlig ausdruckslos. Aber ich merkte, dass er es genoss, mich zappeln zu lassen – und ich war, ohne es zu wollen, ehrlich gespannt.
»An deiner Stelle«, fuhr er schließlich fort, »würde ich Geschichten schreiben, die das Gefühl nicht beschreiben, sondern es erzeugen. Überleg doch mal, Christopher – eine Geschichte, die das Wort ›Angst‹ nie ausspricht, das Gefühl der Angst nie schildert, sondern den Leser in Angst versetzt. Kannst du dir vorstellen, wie furchtbar diese Angst wäre?
Eine Geschichte würde Hunger und Durst auslösen. Eine andere Zorn entfachen. Und dann gäbe es eine Geschichte – die grauenhafteste von allen. Fast zu grauenhaft vielleicht, um sie niederzuschreiben –«
(Die Geschichte, die einen in Schlaf versetzt? Ich sprach es nicht aus, dachte es aber – sehr laut.)
»Die Geschichte«, sagte Mr. Lancaster ganz langsam, um die größtmögliche Wirkung zu erzielen, »die … den Fortpflanzungstrieb weckt.«
Mein Plan, Mr. Lancaster durch die Brille des Wissenschaftlers zu betrachten, diente nicht allein der Kunst. Ich hatte erkannt, dass er einen wahrlich gefährlichen Einfluss auf meine Persönlichkeit auszuüben drohte. Denn sobald ich ihn nicht mehr als groteske Gestalt, sondern als echten Menschen sah, würde ich ihn dafür hassen, dass er mich tyrannisierte. Und wenn ich ihn hasste, seine Tyrannei aber weiter duldete, würde ich in lasterhafte, degenerierte Gehässigkeit verfallen; die ohnmächtige Gehässigkeit eines Sklaven. Gäbe es so etwas wie Reinkarnation – und warum sollte es das nicht? –, wäre ich im alten Rom vielleicht Mr. Lancasters Sklave und Sekretär gewesen. Wir hätten vermutlich in einer baufälligen Villa auf der falschen Seite der Via Appia gewohnt. Ich wäre ein Sklave gewesen, der sich für einen Dichter und Philosophen hält, seine Zeit jedoch damit verschwenden muss, das Gefasel seines Herrn niederzuschreiben und seine erschütternd banalen Ergüsse über die Geheimnisse der Natur zu ertragen. Mein Herr wäre selbstverständlich arm und dazu noch geizig gewesen. Ich hätte für zwei gearbeitet, Holz und Wasser geholt, vielleicht sogar kochen müssen. Vor den Sklaven aus den anderen Villen hätte ich mich aufgespielt und vorgegeben, keine niederen Tätigkeiten zu verrichten. Nachts hätte ich wachgelegen und seine Ermordung geplant. Aber ich hätte mich nicht getraut, die Tat auszuführen, aus Furcht, erwischt und ans Kreuz geschlagen zu werden.
Nein – mit Mr. Lancaster musste man sich wissenschaftlich befassen oder gar nicht. Ihn erforschen wie einen Gegenstand. Ich schrieb sogar seine Tischreden mit:
»Das Schlimmste an meiner gegenwärtigen Tätigkeit ist, dass sie höchstens ein Hundertstel meines Gehirns beansprucht. Ich leide unter geistiger Verstopfung. Im Krieg stellte mich mein Batterieführer oft vor knifflige Artillerieprobleme. Ich bewältigte sie an einem Tag. Nannte ihm für jedes Problem drei Lösungsmöglichkeiten – ganz ohne Mathematik.
Eines, Christopher, solltest du begreifen. Man muss in dieser Welt an die Macht des Bösen glauben. Lebensfreude – alle Lebensfreude – besteht darin, das Böse zu bekämpfen. Wenn wir dieses Ziel aus den Augen verlieren, verliert unser Leben seinen Sinn. Wir verfallen in Glykons grausige Verzweiflung:
Panta gelōs, kī panta konis, ki panta māden,
panta gar ex alogōn esti ta ginomena …
Alles ist nur Lachen, Staub und Nichts,
Alles ist aus Unvernunft geboren …
Hier blieben die Heiden stehen, am Ufer des grenzenlosen Meeres. Sie wussten es nicht besser. Wir aber haben keinen Grund, es ihnen gleichzutun. Denn, wo sie verneinen, können wir uns auf Gareths wunderbares Bekenntnis berufen, die Antwort an seine Mutter, als sie ihn drängte, zu Hause zu bleiben und sich mit den Zerstreuungen eines ziellosen Lebens zu vergnügen:
Mann bin ich geworden, muss Männerarbeit tun.
Dem Wild folgen? Folge Christus, dem König,
lebe rein, sprich wahr, richte Unrecht, folge dem König –
Wozu sonst sind wir geboren?
Vergiss das nie, Christopher. Rufe es dir jeden Morgen beim Aufwachen ins Gedächtnis. Wozu sonst sind wir geboren? Frage dich nie: Können wir gewinnen? Kämpfe, kämpfe!
Noch ein Angriff! Kein Wort frommt!
Lass den Sieger, wenn er kommt,
wenn dann fällt der Torheit Fort,
Tot dich finden nah am Tor!
Nicht einer deiner schlauen Anhänger der Moderne hat Arnolds Stimme. Meredith hatte sie. William Watson hatte sie – er war der Letzte. Dann stürmten die neunmalklugen Modernen auf die Bühne, und die Botschaft ging verloren.
Ich hätte sie den Menschen zurückgeben, sie zu neuem Leben erwecken können. Aber ich hörte einen anderen Ruf. Es geschah an einem Morgen im Frühsommer – am Rande des Mer de Glace, direkt unterhalb des Montblanc. Ich blickte über das weite, blendende Meer aus Eis, und eine Stimme fragte mich: Was willst du sein? Entscheide dich. Ich sagte: Hilf mir bei der Entscheidung. Und die Stimme fragte: Willst du Liebe? Ich sagte: Nicht auf Kosten der Pflichterfüllung. Und die Stimme fragte: Willst du Reichtum? Ich sagte: Nicht auf Kosten der Liebe. Und die Stimme fragte: Willst du Ruhm? Ich sagte: Nicht auf Kosten der Wahrheit. Dann herrschte lange Stille. Ich wartete, denn ich wusste, dass die Stimme wieder sprechen würde. Und schließlich sagte sie: Gut, mein Sohn. Nun weiß ich, was ich dir gebe –
Du hast das Leben noch vor dir, Christopher. Die Liebe ist noch nicht zu dir gekommen. Aber das wird sie. Sie kommt zu uns allen. Und sie kommt nur einmal. Mache dir keine Illusionen. Sie kommt und sie geht. Ein Mann muss sich für die Liebe bereitmachen; und er muss erkennen, wenn sie da ist. Manche sind ihrer nicht würdig. Sie erniedrigen sich und können sie nicht empfangen. Andere zögern, sie zu empfangen – sei es aus Stolz, sei es aus Furcht –, Furcht vor dem eigenen Glück – wer soll es beurteilen? Sei bereit für den Moment, Christopher. Sei bereit –«
Eines Morgens, als Mr. Lancaster ins Kontor gefahren war, sah ich, dass der Schreibtisch, den er gewöhnlich verschlossen hielt, offen stand. Da er den Schlüssel samt Bund im Schloss hatte stecken lassen, ging ich davon aus, dass er das Versäumnis rasch bemerken und zurückkommen würde. Ich musste mich also beeilen.
Als Erstes stieß ich auf einen alten Armeerevolver, offensichtlich ein weiteres von Mr. Lancasters sentimentalen Kriegsandenken. Das interessierte mich nicht im Geringsten; ich war mir sicher, dass der Schreibtisch lohnendere Geheimnisse barg. Ich blätterte durch alte bezahlte Rechnungen und abgelaufene Eisenbahnfahrpläne, fand Drahtstücke, durchgebrannte Glühbirnen, gesprungene Bilderrahmen, rostige Teile eines kleinen Motors, gerissene Gummibänder. Es war, als hätte Mr. Lancaster alles Unordentliche an seiner Persönlichkeit strikt aussortiert und an diesem unsichtbaren Ort verstaut.
In der obersten Schublade jedoch – den ich für den wichtigsten und somit unwahrscheinlichsten Ort hielt und mir deswegen zuletzt vornahm – fand ich ein dickes Notizbuch mit glänzendem schwarzem Einband. Begeistert stellte ich fest, dass die Seiten mit Versen in Mr. Lancasters Handschrift gefüllt waren; offenbar ein langes Erzählgedicht. In der Eile konnte ich es nur überfliegen – viel Natur natürlich – Berge, Meer, Sterne, Wanderungen in der Kindheit, Grübeleien im Stile Wordsworths – Gott – jede Menge Gott – und Reisen – und der Krieg – ach je, der Krieg – und noch mehr Reisen – hm – hm – hm – aha, was war das? Jetzt wurde es endlich interessant!
Und es gab einen –
vor langer Zeit – lieber Gott, so lang ist’s her –
der, als der Flieder in atemloser Blüte atmete
und späte Knospen, noch ihr Geheimnis wahrend,
versprachen, sich zu öffnen, weil sie mussten,
denn so war es bestimmt – als es Abend wurde,
war auch sie da, ihr Kommen gefühlt, bevor erblickt
von ihm, der auf sie wartete. Sie erfuhr nie,
welche Bedeutung ihr Schritt der Dämmerung verlieh,
welche Leere, für ihn, die Dämmerung brachte,
als sie, bald schon, nicht mehr kam – das Leben
sie woandershin führte. Und sie erfuhr nie,
während sie ihrer Wege ging, was sie, unwissend,
getan hatte; wessen Herz sie mit Schönheit beschenkt
und in bitterem Schmerz zurückgelassen hatte.
Ich weiß nicht mehr, was ich damals von diesen Zeilen hielt, denn ich sah sie lediglich als Fund. Meine Schatzsuche war erfolgreich gewesen. Ich triumphierte. Ich griff zu Stift und Papier und schrieb sie ab, mit dem einzigen Gedanken, sie meinen Freunden vorzulesen, wenn ich wieder in London war.
Kaum war ich mit der Abschrift fertig, hörte ich, dass Mr. Lancaster nach Hause gekommen war. Er war viel leiser gewesen als gewöhnlich. Mir blieb keine Zeit, die Spuren meiner Forschungen zu verwischen. Die einzige Möglichkeit war – und ich glaube, das zeugte von großer Geistesgegenwärtigkeit –, das Notizbuch in die Schublade zu werfen und nach dem Revolver zu greifen. Jedenfalls schien es mir weniger verfänglich, einen Revolver zu inspizieren als ein autobiographisches Gedicht.
»Leg ihn weg!«, fuhr Mr. Lancaster mich heiser an.
Er hatte noch nie in diesem Ton mit mir gesprochen; ich erschrak und war empört. »Er ist nicht geladen«, sagte ich. »Und außerdem bin ich kein Kind mehr.« Ich legte den Revolver zurück in die Schublade und verließ das Zimmer.
(Heute erkläre ich mir Mr. Lancasters Verhalten anders. Ich erkenne, dass seine Reden voller Versuche steckten, mein Interesse an ihm zu wecken. Erwartete er beispielsweise nicht, dass ich nachfragen würde, was die Stimme auf dem Gletscher ihm gegeben hatte? Hoffte er nicht sogar, dass ich ihn drängen würde, mir von seinem Liebesleben zu erzählen? Und ließ er den Schlüssel nicht in unbewusster Absicht stecken, damit ich sein Gedicht las? Wenn ich recht habe – und ich glaube, das habe ich –, lag meine Grausamkeit Mr. Lancaster gegenüber in meiner fehlenden Neugier. Meine angeblich wissenschaftliche Studie seiner Persönlichkeit war durch und durch unwissenschaftlich, weil mir von Anfang an klar war, was ich herausfinden würde – und das darf bei einem Wissenschaftler nicht sein. Für mich stand fest, dass er ein Langweiler war.
Als Mr. Lancaster das Zimmer betrat und mich nicht mit dem Notizbuch, sondern mit seinem Revolver in der Hand vorfand, muss er also bitter enttäuscht gewesen sein, auch wenn er sich nicht hätte erklären können, warum. Daher sein Temperamentsausbruch.
Den Revolver hatte er vielleicht schon fast vergessen. Und vielleicht wurde er erst durch mich darauf gestoßen, dass er die ganze Zeit dort gelegen hatte, in der untersten Schublade, ein Stück ordinäres Metall inmitten seiner Phantasiewelt.)
Zwei Tage vor der Rückfahrt nach England nahm Mr. Lancaster mich mit zum Segeln. Er fragte mich nicht, ob ich mitkommen wolle; er verkündete sein Vorhaben, und ich willigte ein. Es war mir inzwischen ziemlich egal, was passierte. Seit dem Vorfall mit dem Revolver war unser Verhältnis abgekühlt. Ich zählte nur noch die Stunden bis zu meiner Abreise.
Wir brachen abends nach Dienstschluss auf, um mit seinem Wagen zu dem Dorf am Fluss zu fahren, wo sein Boot lag. Unterwegs holten wir Sr. Machado ab. Ich war froh, ihn dabeizuhaben, denn ich wollte nicht länger mit Mr. Lancaster allein sein. Erst viel später kam mir in den Sinn, dass Sr. Machado wahrscheinlich der einzige von Mr. Lancasters Bekannten war, der sich noch breitschlagen ließ, ihn zu so einem Ausflug zu begleiten. Viele hatten es zweifellos schon versucht – ein Mal.
Wir quetschten uns zu dritt auf den Vordersitz des kleinen Wagens, denn auf dem Rücksitz lag unter einer Plane der Außenbordmotor. Ziemlich schnell hatten wir uns verfahren. Mr. Lancaster, der vergessen hatte, die Straßenkarte mitzunehmen, wurde immer hektischer, während wir auf einer schmalen Sandpiste am Rand einer Marsch durch die Dämmerung rumpelten. Alte Bauernhäuser standen halb überschwemmt in den Flussauen. Ein Kranich stolzierte steifbeinig am Fuß des Deiches entlang und flog dann über die feuchte grüne Landschaft. Eine träumerische, romantische Zufriedenheit überkam mich. Was machte es schon aus, wo wir waren? Warum überhaupt irgendwo sein? Doch Mr. Lancaster war außer sich.
Als es dunkel wurde, tauchten draußen auf der Marsch zwei Gestalten in einem Stechkahn auf. Mr. Lancaster hielt an, lief auf den Deich und rief ihnen etwas zu. Sie waren winzig und flachsblond, ein Junge und ein Mädchen. Man konnte sich kaum vorstellen, dass sie in der Lage waren, das Boot zu bewegen, und so schienen sie eher wie sehr intelligente Tiere denn als furchtbar dumme Kinder. Die beiden standen Hand in Hand im Kahn, stierten mit großen blauen Augen und offenen Mündern zu Mr. Lancaster hinauf, als erwarteten sie, dass er sie fütterte. Mr. Lancaster sprach sie – wie er mir später erzählte – auf Hochdeutsch und auf Plattdeutsch an. Er redete mit ihnen, wie man mit Schwachsinnigen redet, ganz langsam und mit so deutlichen Gesten, dass sogar ich begriff, worum es ging. Nicht so die Kinder. Sie glotzten ihn verständnislos an. Mr. Lancaster schrie und fuchtelte mit den Armen, aber die beiden zeigten keine Regung. Sie waren zu dumm, um sich vor ihm zu fürchten. Schließlich gab er resigniert auf, wendete und fuhr in die Richtung zurück, aus der wir gekommen waren.
Spät am Abend erreichten wir endlich unser Ziel. Der Ort war voll mit Urlaubern, und im Gasthaus gab es nur noch ein freies Zimmer. Es muss jedoch eines der besten gewesen sein, denn es verfügte über ein imposantes Podestbett und ein Schlafsofa. Prominentester Ziergegenstand war die Photogravüre einer halb nackten Frau in »künstlerischer« Pose; sie stand auf einer Staffelei, drapiert mit einem gemusterten Dekorationsstoff. Mr. Lancaster entschied, dass er auf dem Sofa und Sr. Machado im Bett schlafen würde. Mir wurde die Kajüte von Mr. Lancasters Boot zugewiesen. »Das wird eine wichtige Erfahrung für mich«, bemerkte ich sarkastisch, bevor er es sagen konnte. Aber Mr. Lancaster war Sarkasmus gegenüber taub.
Ich wachte in aller Frühe bei strahlendem Wetter auf, unschlüssig, ob ich mir die Lage schönreden oder eingeschnappt sein sollte. Die Situation war romantisch, das ließ sich nicht leugnen. Ich war allein in diesem fremden Land, hatte ein ganzes Boot für mich! Die anderen Leute beobachteten mich und wunderten sich zweifellos. Obwohl es höchstens sechs Uhr war, schienen die meisten Urlauber schon auf zu sein.
Das Dorf war am Flussufer gebaut, mit Biergärten, die bis hinunter ans Wasser gingen. Sträuße aus Pappelzweigen zierten die Mastspitzen der Boote, und auch die Lenker der Kinderfahrräder waren damit geschmückt. Auf den Decks standen Grammophone, und Leute spielten Konzertina und sangen dazu. Man trank Bier und futterte Würstchen, und es duftete herrlich nach frischem Kaffee. Die Mädchen waren mollig, aber hübsch, die Männer schweinchenrosa mit kurz geschorenem blondem Haar. Sie sangen, während sie sich kämmten oder rasierten, und verstummten, wenn sie sich mit Wasser aus dem Fluss die Zähne putzten.
All das stimmte mich froh. Auf der Sollseite des Tages standen jedoch meine Steifheit, die davon rührte, dass ich zusammengerollt in der winzigen Koje geschlafen hatte, sowie Kopfschmerzen. Und natürlich Mr. Lancaster, der an Bord kam und verstimmt war, weil ich weder die Kajüte aufgeräumt hatte noch fertig angezogen war und mich stattdessen an Deck in der Sonne aalte. Als wir das Frühstück im Gasthaus beendet hatten und sich bei mir Verstopfung einstellte – meine übliche Reaktion, wenn ich fremde Toiletten benutzen musste und zur Eile angetrieben wurde –, verlegte ich mich aufs Schmollen.
Als Nächstes wurde der Motor befestigt, aber er sprang nicht an. Ein Mechaniker musste aus der Werkstatt geholt werden; eine große Menschentraube sah ihm bei der Arbeit zu. Mr. Lancasters Beitrag beschränkte sich darauf, sich aufzuregen und zu nörgeln. Nichtsdestoweniger nutzte er die Situation als Gelegenheit für eine seiner nostalgischen Predigten: »Das erinnert mich an den Krieg. Wir waren in einem Dorf bei Loss und brachen kurz vor Morgengrauen auf, weil wir wussten, dass der Hunne uns beim ersten Sonnenstrahl unter Beschuss nehmen würde. Ich war gespannt, ob ich den Belastungen standhalten würde, denn unser Oberst hatte die Hosen voll. Also maß ich meinen Puls. Er war völlig normal. Mein Verstand funktionierte so ausgezeichnet, dass ich mir, während ich meinem Kompaniefeldwebel Befehle erteilte, eine Schachaufgabe vor Augen führte, die ich einige Tage zuvor in der Times gelesen hatte. Schwarz sollte den Gegner in drei Zügen matt setzen, und ich sah die Lösung, Christopher. Ich musste nicht eine Sekunde lang überlegen. Ein Blick genügte, so wie man auf den Stadtplan schaut und zu sich selbst sagt: ›Natürlich, das ist der kürzeste Weg zum Marktplatz.‹ Es konnte gar nicht anders sein. Und ich bin mir absolut sicher, ich hätte in diesem Moment mindestens ein halbes Dutzend Partien gleichzeitig spielen können und jede gewonnen. Was sagte Sophokles noch über die Größe des Menschen, wenn der Geist sich im Angesicht des Schicksals zu höchster Höhe aufschwingt –?« Und dann schwadronierte er wieder lange und wortreich auf Griechisch. Wie recht Hugh Weston doch hatte, als er sagte, Griechisch sei die abscheulichste Sprache überhaupt!
Schließlich legten wir ab, Richtung Nordsee. Mr. Lancaster schnauzte mich an, weil ich einige Teile seiner Angelausrüstung fallen ließ. Ich strafte ihn mit einem finsteren Blick. Um mich zu brüskieren und mir meinen Platz zu zeigen, wandte er sich Sr. Machado zu und unterhielt sich mit ihm auf Spanisch. Für mich war das die reinste Wohltat, nicht aber für Sr. Machado, dessen gute lateinamerikanische Manieren von ihm verlangten, jetzt, da er mich zur Kenntnis genommen hatte, mit mir zu plaudern. (Ihm war mit Sicherheit entfallen, dass ich beim Bankett sein Tischnachbar gewesen war.) Also sprach er mich von Zeit zu Zeit auf Französisch an, das ich wegen seines fürchterlichen Akzents nur mit größter Mühe verstand. Das Schlimmste war jedoch nicht das Verständnisproblem, sondern dass seine Äußerungen keinerlei Anlass boten, ein Gespräch zu beginnen. Er sagte zum Beispiel: »Je suppose que le sujet le plus intéressant pour un écrivain, c’est la prostitution.« Worauf ich nur begeistert erwidern konnte: »Monsieur, vous avez parfaitement raison.« Und schon steckten wir fest.
Wir waren jetzt in der Mündung; der Fluss wurde immer breiter. Mr. Lancaster beauftragte mich, das Boot zu steuern, während er die Angeln vorbereitete. »Du musst vom ersten Augenblick an auf der Hut sein«, sagte er. »Hier gibt es überall Sandbänke. Pass auf. Vorsicht! VORSICHT! Achte auf die Farbe des Wassers vor dir. An dieser Stelle ganz langsam! Sachte jetzt. Sachte. Sachte. Sachte. Sachte. Jetzt – Gas geben. GIB GAS! Schnell, Mensch. Backbord! HART backbord! Willst du uns volllaufen lassen?« (Es war sehr leichter Wellengang, als wir die Flussmündung verließen; man spürte kaum eine Veränderung.)
»Und jetzt immer voraus! Zwei Grad Südwest von der Landspitze. Kurs halten. HALTEN! Vorsicht, Mensch. Gut. Gut! Ja, gut so! Ausgezeichnet! Gut gesteuert, Sir! Ich befürchte, Christopher, wir machen noch einen Seemann aus dir!«
Ich hatte nichts Lobenswertes getan, außer eine Boje von der Größe eines Heuschobers zu umfahren. Mr. Lancasters Enthusiasmus war so verrückt wie seine Besorgnis. Dennoch fühlte ich mich – wie in der Sache mit dem kalten Bad – auf kindische Weise geschmeichelt. Ach, wenn er erkannt hätte, wie leicht ich zu beherrschen war; wie schnell ich auf das plumpeste Kompliment ansprang. Nein – selbst wenn er es erkannt hätte, er wäre nicht anders mit mir umgegangen. Eine Schmeichelei hätte Mr. Lancaster mir nie gewährt; das wäre seiner Ansicht nach schädlich für meine Seele gewesen.
Für Sr. Machados Seele fühlte er sich anscheinend nicht verantwortlich. Denn er schmierte ihm, mir zuliebe auf Französisch, auf schamloseste Weise Honig um den Bart. Er nannte ihn einen »feinen Kerl«, wobei er das englische good sport verwendete und es Machado dann auf Französisch erklärte, bis dieser verstand und entzückt in die Hände klatschte: »Good spot! Ich – good spot? Oh, ja!«
»Ist er nicht ein lieber alter Mann?«, sagte Mr. Lancaster milde. »Er ist zu drei Vierteln peruanischer Indio, weißt du. Sein Vater hat wahrscheinlich Koka gekaut und nie Schuhe getragen. Das nennt man einen echten unverdorbenen Kanaken. Ganz gleich, wie alt er ist – er bleibt immer ein Kind.«
Wir waren jetzt ziemlich weit draußen auf dem glatten Meer; das Ufer mit den flachen Dünen war nur noch eine fahle Linie zwischen dem glitzernden Wasser und dem leuchtenden Himmel. Weiße Segel wölbten sich, so weit das Auge reichte. Mr. Lancaster stand, offensichtlich hochzufrieden mit sich, am Bug und tönte:
Pervixi: neque enim fortuna malignior unquam
erepiet nobis quod prior hora dedit.
Mir wurde schlagartig bewusst, wie furchtbar die Odyssee und die Fahrt der Pequod gewesen sein mussten und dass ich früher oder später lieber über Bord gesprungen wäre, als den schauderhaften Langweilern Odysseus und Ahab zu lauschen.
Sogleich verkündete Mr. Lancaster, es sei Zeit zum Angeln. Machado und ich bekamen die Ruten. Wir zogen unsere Schnüre laienhaft durchs Wasser. Das hätte eine gemütliche Angelegenheit werden können, hätte Gott meine Faulheit nicht mit einem überaus lästigen Wunder bestraft – einer riesigen Menge von Fischen. Wir stießen auf eine Makrelenschule!
Mr. Lancaster war völlig aufgelöst. »Vorsicht! VORSICHT, MENSCH! Sachte – sachte – sachte! Nicht die Schnur durchhängen lassen! Du verlierst ihn! Spiel mit ihm! Immer schön mit ihm spielen! Kämpfe mit ihm! Er ist ein hinterlistiger Teufel! Er führt dich an der Nase herum. Nein, nicht mich ansehen! Sieh ihn an! IHN! Nicht die Nerven verlieren! Ganz ruhig! JETZT –«
Seine Anweisungen waren in höchstem Maße überflüssig, denn es wäre völlig unmöglich gewesen, die grässlichen Fische entwischen zu lassen, außer wir hätten die Angeln weggeworfen und uns unten in die Kajüte gelegt. Machado sprach jetzt weder Französisch noch Spanisch. Er gab Laute von sich, die wie die Jagdrufe eines Stammes klangen, vielleicht war es ein indianischer Andendialekt. Anfangs ließ ich mich von ihrem Eifer anstecken und zog die Fische an Bord, so schnell ich konnte. Dann verließ mich die Lust. Dann empfand ich Abscheu. Es ging so unerhört einfach. Am Ende hatten wir, glaube ich, mindestens dreißig Fische im Boot.
Anschließend machte sich Mr. Lancaster daran, ein paar Fische fürs Essen auszunehmen, sodass er nicht groß auf Machado achtgab. Ich saß an der Pinne. Als ich zu dem alten Mann hinüberblickte, sah ich, dass er sich weit aus dem Boot lehnte. Sein Rücken war angespannt, die Beine steif und gespreizt. Mein erster Gedanke war, dass er einen Schlaganfall erlitten hatte. Aber nein – er kämpfte verzweifelt mit irgendetwas im Wasser. Es sah aus, als wollte er den Meeresgrund an Bord hieven. Er wandte mir das Gesicht zu und bekam vor Anstrengung kaum Luft. »Poisson!«, röchelte er, doch es klang eher wie: »Opossum!«
Natürlich sprang ich auf, um ihm zu helfen. Ich war verblüfft – und dann außer mir vor Wut –, als ich von Mr. Lancaster einen kräftigen Rückhandschlag vor die Brust bekam! Ich fiel hintenüber und landete hart auf dem Boden. Hätte ich ein Messer gehabt, ich glaube, ich hätte es auf der Stelle gezückt und ihn erledigt. So schrie ich ihn nur im Geiste an: »Wenn du mich noch einmal anfasst, du alter Hammel, dreh ich dir den Hals um!« Mr. Lancaster schrie mir derweil ins Gesicht: »Lass ihn, du kleiner Dummkopf!« Vermutlich sah er den lodernden Hass in meinen Augen, denn er fügte etwas weniger unbeherrscht hinzu: »Hilf nie einem Mann, wenn er einen Fisch landet. NIEMALS! Weißt du denn nicht einmal das?«
Er wandte sich von mir ab und kümmerte sich um Machado, während dieser die Angel einholte. Mr. Lancaster kniete sich neben ihn und redete ihm auf Französisch aufmunternd zu, tröstete ihn, beruhigte ihn, ermahnte ihn, beschwor ihn, tief zu atmen, sich zu entspannen, langsam und sachte weiter Druck auszuüben. »Ça va mieux, n’est-ce pas? Ça marche? Mais naturellement –« Er benahm sich auf absurde Weise wie eine Hebamme, die eine Gebärende anspornt. Und tatsächlich, langsam, ganz langsam, unter grenzenlosen Schmerzen, wurde Machado von einem riesigen Fisch entbunden – ein Thunfisch, sagte Mr. Lancaster. Nachdem er ihn gelandet hatte, zogen wir ihn im Wasser hinter uns her, um ihn frisch zu halten.
Dann briet Mr. Lancaster auf einem Spirituskocher die ausgenommenen Makrelen. Gerne wäre ich so willensstark gewesen, das Essen zurückzuweisen. Aber ich hatte rasenden Hunger. Und obwohl Mr. Lancaster den Fisch in seiner typischen Unfähigkeit arg hatte verbrennen lassen, roch und schmeckte er köstlich. Außerdem befand ich mich in einer unangenehmen Lage, denn ich wollte auf keinen Fall gemein zu Machado sein, der im Siegesrausch war und mehrmals beglückwünscht werden musste. Höchstwahrscheinlich würde dies der letzte wirklich glückliche Tag seines Lebens sein. Ich schloss einen Kompromiss, indem ich Mr. Lancaster die kalte Schulter zeigte. Es schien ihm gar nicht aufzufallen.
In dieser Stimmung traten wir den Rückweg an. Mr. Lancaster fuhr fort, sich selbstgefällig für seine Voraussicht zu loben; er hatte unseren Zeitplan so berechnet, dass wir in beide Richtungen mit den Gezeiten fuhren. Gleichwohl fand ich die lange tuckernde Fahrt ziemlich ermüdend. Als wir die Flussmündung erreichten, saß ich wieder an der Pinne, und Mr. Lancaster hackte auf mir herum. Anscheinend waren wir vom Kurs abgekommen, aber woher sollte ich das wissen? Es hatte keinen Zweck, sich zu bemühen, seinen pseudonautischen Richtungsangaben zu folgen. Ich verließ mich ganz auf meine Augen.
Plötzlich schrie er: »SAND! SAND VORAUS! KURS ÄNDERN! ABDREHEN! HART ABDREHEN!«
Was dann geschah, war nicht geplant. Zumindest handelte ich nicht aus einer bewussten Entscheidung heraus. Ich tat es trotzdem. Inzwischen hatte ich ein Gespür für die Pinne entwickelt; ich konnte ziemlich gut einschätzen, wie viel sie aushielt. Ich befolgte Mr. Lancasters Befehl lediglich einen Hauch zu enthusiastisch. Ich riss die Pinne energisch herum – sehr energisch. Worauf mit einem äußerst befriedigenden, herzergreifenden Knackgeräusch die Haltevorrichtung des Außenbordmotors brach und dieser ins Wasser fiel.
Ich sah Mr. Lancaster an und musste fast grinsen.
Einen Augenblick lang befürchtete ich, er würde seinen Adamsapfel verschlucken. »Du Dummkopf«, schrie er. »Du Dummkopf! Du verdammter kleiner Idiot!« Er trat auf mich zu und brachte das Boot zum Schwanken. Aber ich hatte nicht die geringste Angst. Ich wusste, er würde – konnte – mich nicht schlagen. Und das tat er auch nicht.
Außerdem war das Wasser so flach, dass sich der Motor ohne große Mühe bergen ließ. Aber natürlich war gar nicht daran zu denken, ihn wieder anzuwerfen; er musste erst gründlich gereinigt werden. Es blieb also nichts anderes übrig, als zurück ins Dorf zu segeln.
Die Fahrt dauerte den ganzen restlichen Tag. Es wehte nur sehr schwacher Wind, und Mr. Lancaster nutzte ihn offenbar auf die denkbar schlechteste Weise, denn die meisten anderen Boote auf dem Fluss überholten uns. Er saß niedergeschlagen an der Pinne. Machado erholte sich friedlich schlummernd von seinen Strapazen. Schließlich nahm uns ein Vergnügungsdampfer ins Schlepptau. Mr. Lancaster musste die Gefälligkeit annehmen, denn es wurde langsam dunkel, doch ich sah, wie gedemütigt er sich fühlte. Ein Mann und eine Frau, beide weder jung noch schlank, saßen am Heck des Dampfers, unsichtbar für die anderen Passagiere, aber direkt vor unserer Nase. Während der gesamten Fahrt tauschten sie leidenschaftlich Zärtlichkeiten aus. Und auch das war eine Demütigung für Mr. Lancaster, denn es war den beiden ganz offensichtlich völlig gleichgültig, ob er sich daran störte. Ich merkte, dass ich auf der Seite der Liebenden stand, und lächelte ihnen anerkennend zu, aber das interessierte sie genauso wenig.
Ich war bester Stimmung. Beim halb mutwilligen Versenken des Motors hatte sich meine ganze Wut entladen wie in einem großartigen Orgasmus. Ich verspürte nicht mehr den geringsten Groll gegen Mr. Lancaster. In Wahrheit dachte ich überhaupt nicht mehr an ihn. Meine Gedanken waren der Gegenwart, meinem Aufenthalt auf diesem Boot enteilt; sie hatten Mr. Lancaster und Deutschland weit hinter sich gelassen. Sie waren wieder in London, in meinem Zimmer, an meinem Schreibtisch. Dabei hatte ich es nicht einmal besonders eilig, körperlich dorthin zurückzukehren, denn inzwischen hatte ich reichlich Stoff zum Nachdenken. Dieser alberne Tag würde mir – trotz Mr. Lancaster – mein Leben lang unvergesslich bleiben. Denn mittendrin – vielleicht genau in dem Augenblick, als der Motor ins Wasser geplumpst war – hatte ich eine Eingebung gehabt. Eine Stimme hatte gesagt: »Die beiden Frauen – die Geister der Lebenden und die Geister der Toten – das Denkmal.« Und auf einmal hatte ich alles vor mir gesehen – die Teile hatten sich von selbst angeordnet –, das Gerüst stand. Unscharf, aber voller Begeisterung erkannte ich die Konturen eines neuen Romans.
Der Tag meiner Rückreise nach England war gekommen. Die Coriolanus lief am Abend aus.
Am Morgen teilte Mr. Lancaster mir auf seine typische indifferente Art mit, dass Waldemar mit mir in die Kunsthalle gehen würde. Anschließend sollte ich – da Mr. Lancaster einen Geschäftstermin hatte – mit Waldemar zu Mittag essen und mich pünktlich um Viertel nach vier wieder in der Wohnung einfinden. Ich sagte nichts.
Doch als ich mit Waldemar auf der Treppe zum Museum stand und Mr. Lancaster um die Ecke verschwunden war, sah ich ihn an und schüttelte entschieden den Kopf. »Nein«, sagte ich.
Waldemar schien verdutzt. Er zeigte zum Eingang und sagte: »Nein?«
»Nein«, wiederholte ich lächelnd. Dann machte ich mit den Armen Brustschwimmbewegungen.
Waldemars Miene hellte sich schlagartig auf. »Ach – schwimmen! Wir sollen schwimmen gehen?«
»Ja«, sagte ich nickend. »Swimmen.«
Waldemar strahlte. Ich hatte ihn noch nie so lächeln gesehen. Sein ganzes Gesicht veränderte sich. Alles Engelhafte war daraus verschwunden.
Er führte mich zu einem großen Freibad. Ich war schon mehrere Male daran vorbeigegangen, hatte mich aber wegen meiner praktisch nicht vorhandenen Deutschkenntnisse nie hineingetraut. Diesmal war Waldemar alles andere als passiv. Er löste den Eintritt, gab mir Handtuch und Seife, begrüßte mehrere Freunde, bugsierte mich in die Umkleide, schickte mich unter die Dusche und zeigte mir, wie man die roten dreieckigen Badehosen zuband, die er für uns geliehen hatte. Als er sich auszog, war es, als legte er seine Büropersönlichkeit gleich mit ab. Es war erstaunlich, wie es ihm gelungen war, seinen gut entwickelten, tierhaft entspannten braunen Körper in dem steifen Anzug zu verbergen. Er behandelte mich nicht mehr, als wäre ich vierzig und vom gleichen Schlag wie Mr. Lancaster. Wir lächelten uns zaghaft an, dann rangen wir miteinander, spritzen einander nass, tauchten uns gegenseitig unter, schwammen um die Wette. Doch obwohl wir spielten wie Kinder, war mir voll und ganz bewusst, dass er schon ein junger Mann war.
Bald gesellte sich ein Freund zu uns, ein Junge in seinem Alter namens Oskar. Oskar war ein dunkler, vorlauter Typ mit einem grinsenden Affengesicht. Er sprach ziemlich gut Englisch. Er sei Page, erzählte er, in einem der großen Hotels. Seine Pagenmentalität blieb mir nicht verborgen; er hatte viel erlebt, er wusste, was Sache war, und er sah mich an wie einen Hotelgast, dessen besondere Wünsche sich gegen Zahlung eines Trinkgeldes vielleicht erfüllen ließen. Zwischendurch tuschelte er kichernd mit Waldemar. Ich wusste, dass sie über mich sprachen, aber das machte mir nichts aus, denn Oskar gab sich große Mühe, mir zu zeigen, dass ich dazugehörte.
Nach dem Schwimmen gingen wir zum Mittagessen in ein Restaurant. Beide Jungen rauchten und tranken Bier. Waldemar schien es darauf anzulegen, so weltgewandt zu wirken wie sein Freund. Inzwischen waren wir beim Du angekommen.
Waldemar sagte etwas zu seinem Freund, und beide brachen in lautes Gelächter aus.
»Was ist so lustig?«, fragte ich.
»Walli glaubt, seine Braut wird dich mögen«, sagte Oskar.
»Ah – schön. Kommt sie her?«
»Wir gehen zu ihr. Bald. In Ordnung?«
»In Ordnung.«
»In Ordnung!« Waldemar lachte herzhaft. Er war leicht angetrunken. Er langte über den Tisch und schüttelte mir kräftig die Hand. Oskar erklärte: »Wallis Braut mag auch ältere Herren. Nicht zu alt. Du – sehr gut! Hübscher Junge!«
Ich wurde rot. Eine köstliche Ahnung beschlich mich.
»Hast du fünf Mark?«
»Ja.« Ich zeigte sie vor.
Die Jungen lachten. »Nein, nein – für später.«
»Aber, Oskar« – irgendwie hatte ich das Gefühl, dass wir aneinander vorbeiredeten – »wenn sie Wallis Braut ist – und überhaupt, ist er nicht viel zu jung zum Heiraten?«
»Ich hatte schon mit zwölf eine. Walli auch.«
»Aber – wird er denn nicht eifersüchtig sein, wenn ich –?«
Wieder Gelächter. Oskar sagte: »Wir lassen dich nicht mit ihr alleine.« Ich muss immer verblüffter ausgesehen haben, denn er tätschelte mir beruhigend die Hand. »Du musst nicht schüchtern sein, Christoph. Guck uns erst mal zu. Dann siehst du, wie einfach das ist.« Er übersetzte es Waldemar, und die beiden lachten, bis ihnen die Tränen über das Gesicht liefen.
Jungen wie Oskar und Waldemar benutzten das Wort Braut für jedes Mädchen, mit dem sie gerade gingen. Diese erste Deutschlektion lernte ich an jenem unvergesslichen, heiteren schamlosen Nachmittag – ein Nachmittag mit heruntergelassenen Jalousien, Grammophonmusik und den glitschigen Geräuschen nackter Körper, mit türkischen Zigaretten, Kissenstaub, billigem Parfum und gesundem Schweiß, mit prustendem Gelächter und ächzenden Sofafedern.
Ich kam erst um kurz vor sechs in Mr. Lancasters Wohnung zurück. Ich war noch so im Freudentaumel, dass es mir egal war, ob er mich ausschimpfte, aber er tat nichts dergleichen. Vielmehr schien er in derselben Stimmung zu sein, in der er mich am Tag meiner Ankunft empfangen hatte. Er schien sich einfach nicht sonderlich für mich zu interessieren. »Grüße deine Mutter von mir«, war alles, was er zum Abschied sagte. Seine Kälte verletzte mich. So gleichgültig ich mich anderen gegenüber auch verhielt, ich war immer noch aufrichtig erstaunt, wenn mein Desinteresse erwidert wurde.
Bei meiner Rückkehr nach London stellte ich fest, dass mein Roman tatsächlich ein Reinfall war. Die Kritiken waren noch schlechter, als ich befürchtet hatte. Meine Freunde verbündeten sich loyal zu seiner Verteidigung und erklärten der Welt, die Kanaillen der Mittelmäßigkeit hätten ein Meisterwerk zerstört. Mich ließ das alles ziemlich kalt. In meinem Kopf drehte sich alles um meinen nächsten Roman und mein neues irrsinniges Vorhaben, Medizin zu studieren. Und im Hintergrund war immer Berlin. Es rief mich jede Nacht, mit der rauen, verführerischen Stimme der Grammophonplatten, die ich im möblierten Zimmer von Waldemars »Braut« gehört hatte. Früher oder später würde ich dorthin fahren. Dessen war ich mir sicher. Ich hatte sogar schon damit begonnen, Deutsch zu lernen, mit einem dieser »Fließend sprechen in drei Monaten«-Bücher. Wenn ich im Bus saß, sagte ich unregelmäßige Verben auf. Sie waren für mich wie die Zauberformeln aus Tausendundeine Nacht, die einem zum Herrscher über ein Paradies der Freuden machen.
Natürlich schickte ich Mr. Lancaster nie ein Exemplar von Lauter gute Absichten. Aber ich schrieb ihm einen Dankesbrief – eines jener dankfreien, herzlosen Schreiben, die zu verfassen ich schon als Kind gelernt hatte. Er beantwortete ihn nicht.
Als ich meinen Freunden von ihm erzählte, fiel es mir ausgesprochen schwer, ihn als speziellen oder gar absurden Charakter darzustellen. Anscheinend war mir sein Wesen verschlossen geblieben. Und als ich Allen Chalmers sein Gedicht vorlas, waren wir beide ziemlich betreten. Es war auf seine Art einfach nicht schlecht genug. Chalmers musste höflich sein und machte es viel lächerlicher, als es in Wirklichkeit war.
Gegenüber meiner Mutter sprach ich Mr. Lancasters Liebesleben an. Sie sagte mit einem stillen Lächeln: »Ach, ich glaube, da hat sich nicht viel getan.« Dann erfuhr ich, was sie bis dahin nicht für erwähnenswert gehalten hatte – Mr. Lancaster war nach dem Krieg ein paar Monate lang verheiratet gewesen, doch seine Frau hatte ihn verlassen, und sie hatten sich scheiden lassen. »Weil«, sagte meine Mutter trocken, »Cousin Alexander – dem Vernehmen nach – seine Pflichten als Ehemann nicht erfüllen konnte.« Ich war erschüttert, von Mr. Lancasters Impotenz zu hören. Nicht seinetwegen – ich hatte mehr oder weniger damit gerechnet –, sondern wegen meiner Mutter. Es schockiert mich immer wieder, dass selbst die damenhaftesten Damen einen vertrauten, nüchternen Umgang mit den Tatsachen der Natur pflegen. Meine Mutter war erstaunt und hocherfreut über meine Reaktion. Sie wusste, dass sie ausnahmsweise etwas »Modernes« gesagt hatte, auch wenn sie sich nicht erklären konnte, wie ihr das gelungen war.
Vermutlich hätte ich Mr. Lancaster mit der Zeit völlig vergessen, hätte er mein Interesse nicht auf extrem dramatische Weise aufs Neue geweckt. Gegen Ende November desselben Jahres nahm er sich das Leben.
Die Nachricht kam in Form eines Briefes von Mr. Lancasters Stellvertreter, dem »Vize«, der mir für das Bankett seinen Smoking geliehen hatte. Ich hatte ihn danach kurz im Kontor kennengelernt und mich bei ihm bedankt. Er war mir als rotgesichtiger kleiner Mann mit breitem Yorkshire-Akzent und tüchtigem, freundlichem Wesen in Erinnerung geblieben.
Er informierte uns in sachlicher, geschäftsmäßiger Manier über die nackten Tatsachen. Mr. Lancaster hatte sich eines Abends in seiner Wohnung erschossen. Die Leiche war erst am nächsten Tag entdeckt worden. Ein Abschiedsbrief wurde nicht gefunden, auch keine »persönlichen« Dokumente. (Das Notizbuch mit seinem Gedicht hatte er vermutlich verbrannt.) Er war nicht krank gewesen. Auch steckte er nicht in finanziellen Schwierigkeiten, und die Firmengeschäfte gaben keinen Anlass zur Besorgnis. Zum Abschluss sprach uns der Stellvertreter förmlich sein Beileid und sein Bedauern über unseren »schmerzlichen Verlust« aus. Zweifellos hielt er uns für Blutsverwandte oder war der Meinung, wir sollten die Familie vertreten, da es außer uns niemanden gab.
Mr. Lancasters Tat beeindruckte mich sehr. Ich war aus Prinzip ein entschiedener Befürworter des Selbstmords, denn ich betrachtete ihn als Protesthandlung gegen die Gesellschaft. Ich wollte Mr. Lancasters Protest in den Mittelpunkt einer großen Saga stellen. Eine romantische Figur aus ihm machen. Aber ich konnte nicht. Ich wusste nicht, wie.
Im Jahr darauf ging ich, nachdem ich mein kaum begonnenes Medizinstudium geschmissen hatte, endlich nach Berlin. Und dort lief mir einige Zeit später Waldemar in die Arme. Er hatte sich in seiner Heimatstadt gelangweilt und war nach Berlin gekommen, um dort sein Glück zu suchen.
Waldemar wusste natürlich nur sehr wenig über die Umstände von Mr. Lancasters Tod. Aber er erzählte mir etwas Erstaunliches. Nach meiner Abreise, sagte er, habe Mr. Lancaster im Kontor oft von mir gesprochen. Er habe gesagt, ich hätte ein Buch geschrieben; es sei in England ein Misserfolg gewesen, weil die Kritiker alle Dummköpfe seien, doch eines Tages werde man mich als einen der größten Schriftsteller meiner Zeit anerkennen. Außerdem habe er mich immer als seinen Neffen bezeichnet.
»Ich glaube, er hat dich sehr gerngehabt«, sagte Waldemar sentimental. »Er selbst hatte keinen Sohn, oder? Wer weiß, Christoph, wenn du auf ihn aufgepasst hättest, würde er vielleicht noch leben!«
Wenn die Dinge doch so einfach wären!
Ich glaube, ich erkenne jetzt, dass Mr. Lancasters Einladung sein letzter Versuch war, wieder in Verbindung mit der Außenwelt zu treten. Aber dafür war es natürlich längst zu spät. Wenn mein Besuch ihm zu irgendetwas verholfen hatte, dann zu der Einsicht, was ihn daran hinderte, enge Beziehungen zu anderen Menschen zu unterhalten. Er hatte zu lange in seinem eigenen Klangkörper gelebt, seinem eigenen Echo gelauscht, dem epischen Lied von sich selbst. Er brauchte mich nicht. Er brauchte überhaupt niemanden; nur einen imaginären Neffen und Schüler, der eine Nebenrolle in seiner großen Erzählung spielte. Nach meiner Abreise hatte er sich einen geschaffen.
Dann, so vermute ich, verließ ihn plötzlich der Glaube an sein Epos. Verzweiflung ist etwas entsetzlich Einfaches. Und obwohl Mr. Lancaster so gerne über die Verzweiflung sprach, erlebte er sie vermutlich völlig anders, als er es sich vorgestellt hatte. Doch in seinem Fall, hoffe und glaube ich, währte sie nur kurz. Nur wenige Menschen können einen so tiefen Schmerz bei vollem Bewusstsein aushalten. Meistens leiden wir, Gott sei Dank, dumm und gedankenlos wie die Tiere.