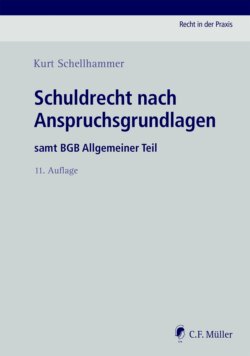Оглавление
Kurt Schellhammer. Schuldrecht nach Anspruchsgrundlagen
Schuldrecht
Autor
Impressum
Vorwort
Vorwort zur 1. Auflage
Inhaltsübersicht
Inhaltsverzeichnis
Verzeichnis der Bilder
Abkürzungsverzeichnis
1. Die Rechtsnormen
2. Die Rechtsquellen
3. Objektives und subjektives Recht
Bild 1: Objektives und subjektives Recht
1. Die Abgrenzung der großen Rechtsblöcke
Bild 2: Die Rechtsordnung
2. Das allgemeine bürgerliche Recht und das Sonderrecht einzelner Lebensbereiche
Bild 3: Das Zivilrecht
1. Die Entstehung des BGB
2. Das System des BGB. 2.1 Die Kodifikation des allgemeinen Zivilrechts
Bild 4: Das System des BGB
2.2 Vom Allgemeinen zum Besonderen
3. Die Sprache des BGB
4. Das Menschenbild des BGB einst und jetzt
1. Die Subsumtion des Sachverhalts unter die Rechtsnormen
2. Die juristische Methode der Falllösung. 2.1 Die Reihenfolge der rechtlichen Prüfung
Bild 5: Die Methode der Falllösung
2.2 Der Prozessfall
Bild 6: Die Arbeitsteilung im Zivilprozess
3. Die Auslegung des Gesetzes. 3.1 Die Auslegungsmethoden
3.2 Die richterliche Rechtsfortbildung
1. Das System des Zivilrechts
2. Das subjektive Recht
3. Der Anspruch des BGB
4. Der Anspruch im Rechtsstreit
1. Das gesetzliche Fundament des Zivilrechts
2. Eine Last, keine Pflicht
3. Tatsachen und Rechtsfolgen
4. Die gesetzlichen Beweislastregeln
5. Die ungeschriebene allgemeine Beweislastregel
6. Anspruchsgrundlagen, Gegennormen und Hilfsnormen. 6.1 Die Anspruchsgrundlagen
6.2 Die Gegennormen
6.3 Die Ausnahmen von Gegennormen
6.4 Die Hilfsnormen
7. Die Behauptungs- und Beweislast für negative Tatsachen
1. Kaufvertrag, Verpflichtungsvertrag, Vertrag
Bild 8: Der Kauf im System des BGB
2. Besonderes und allgemeines Schuldrecht
3. Schuld- und Sachenrecht
Bild 9: Kauf und Übereignung
4. Das Kaufrecht nach der Schuldrechtsreform. 4.1 Die Abmagerungskur
4.2 Die Gleichschaltung von Rechts- und Sachmängeln, von Stück- und Gattungskauf, von Sach- und Rechtskauf
4.3 Die besonderen Gestaltungsformen des Kaufs
1. Die Anspruchsgrundlage
Bild 10: Die Ansprüche auf Erfüllung des Kaufvertrags
2. Die Rechtsfolgen des Kaufvertrags. 2.1 Der Anspruch des Käufers einer Sache auf Übergabe und Übereignung
2.2 Der Anspruch des Käufers eines Rechts auf Verschaffung des Rechts
2.3 Der Anspruch des Verkäufers auf den Kaufpreis
2.4 Der Anspruch des Verkäufers auf Abnahme der Kaufsache
3. Die Anspruchsvoraussetzung: ein Kaufvertrag. 3.1 Der Mindestinhalt des Kaufvertrags
3.2 Die Beweislast
3.3 Die rechtliche Struktur des Kaufvertrags
3.4 Die Abgrenzung des Kaufvertrags von anderen Vertragstypen
4. Der Kaufgegenstand
5. Der Kaufpreis. 5.1 Die Kaufpreisvereinbarung
5.2 Die Fälligkeit des Kaufpreises
6. Die Form des Kaufvertrags
7. Die behördliche Genehmigung des Kaufvertrags
8. Nebenpflichten aus Kaufvertrag und Kaufverhandlungen. 8.1 Selbständige, klagbare Nebenleistungspflichten
8.2 Unselbständige Nebenpflichten
1. Eine Haftung wegen Vertragsverletzung
Bild 11: Neue Strukturen des Kaufrechts
2. Der gesetzliche Vorrang der Nacherfüllung
3. Die Sachmängelrechte des Käufers auf einen Blick
Bild 12: Die Sachmängelrechte des Käufers
4. Die Modernisierungskunst des Gesetzgebers
5. Die Rechtsgrundlagen für die Sachmängelhaftung und ihre Ausnahmen. 5.1 Die Anspruchs- und Rechtsgrundlagen
5.2 Die Gegennormen
5.3 Die Beweislast für und gegen eine Sachmängelhaftung
5.4 Die unberechtigte Mängelrüge
5.5 Der Gang der Darstellung
1. Die Anspruchsgrundlage
Bild 13: Der Anspruch des Käufers auf Nacherfüllung
2. Die Rechtsfolge des Anspruchs auf Nacherfüllung. 2.1 Das Wahlrecht des Käufers
2.2 Der Anspruch des Käufers auf Mängelbeseitigung
2.3 Der Anspruch des Käufers auf Lieferung einer mangelfreien Sache
2.4 Der Anspruch des Käufers auf Ersatz seiner Aufwendungen
2.5 Der Anspruch des Verkäufers auf Rückgewähr der mangelhaften Sache
2.6 Das Zahlungsverweigerungsrecht des Käufers
3. Die Voraussetzungen des Nacherfüllungsanspruchs
4. Der Ausschluss des Nacherfüllungsanspruchs. 4.1 Die Unmöglichkeit der Nacherfüllung
4.2 Sonstige Erlöschensgründe
4.3 Das Leistungsverweigerungsrecht des Verkäufers
1. Die Rechtsgrundlage
2. Die Rechtsfolgen des Rücktrittsrechts und des Rücktritts. 2.1 Ein Gestaltungsrecht
Bild 14: Das Rücktrittsrecht des Käufers
2.2 Die Rückabwicklung des Kaufvertrags
2.3 Rücktritt und Schadensersatz
3. Die Voraussetzungen des Rücktrittrechts. 3.1 Die Beweislast
3.2 Die angemessene Frist zur Nacherfüllung
3.3 Der sofortiger Rücktritt ohne Nachfrist
3.4 Der Rücktritt nach einer Teilleistung
3.5 Der Rücktritt vor Fälligkeit der Verkäuferpflicht
4. Der Ausschluss des Rücktrittsrechts
1. Die Rechtsgrundlage
Bild 15: Das Minderungsrecht des Käufers
2. Die Rechtsfolgen des Minderungsrechts. 2.1 Ein Gestaltungsrecht
2.2 Die Herabsetzung des Kaufpreises
2.3 Die Rückforderung des überzahlten Kaufpreises
2.4 Minderung und Schadensersatz
3. Die Voraussetzungen des Minderungsrechts
4. Der Ausschluss des Minderungsrechts
1. Die bunte Palette der Ersatzansprüche
Bild 16: Der Anspruch des Käufers auf Schadensersatz
2. Die Abgrenzung der unterschiedlichen Arten des Schadensersatzes. 2.1 Der Grundtatbestand und seine speziellen Ableger
2.2 Der gesetzliche Vorrang der Nacherfüllung vor dem Schadensersatz
2.3 Das Fazit der Abgrenzung
3. Der Anspruch des Käufers auf Ersatz des durch den Sachmangel verursachten Schadens. 3.1 Die Anspruchsgrundlage
3.2 Die Rechtsfolge: Der Ersatz des Mangelfolgeschadens
3.3 Die Anspruchsvoraussetzungen
4. Der Anspruch des Käufers auf Schadensersatz statt der Leistung. 4.1 Die Anspruchsgrundlage
4.2 Die Rechtsfolge: Der Ersatz des Mangelschadens
4.3 Die Anspruchsvoraussetzungen
4.4 Der Schadensersatz statt der Leistung nach einer unvollständigen Verkäuferleistung
4.5 Der Schadensersatz statt der anfänglich unmöglichen Leistung
4.6 Der unerhebliche Sachmangel als Ausnahme
5. Der Anspruch des Käufers auf Ersatz des Verzögerungsschadens. 5.1 Die Anspruchsgrundlage
5.2 Die Rechtsfolge: Der Ersatz des Verzögerungsschadens
5.3 Die Anspruchsvoraussetzungen
6. Der Anspruch des Käufers auf Ersatz seiner vergeblichen Aufwendungen. 6.1 Die Anspruchsgrundlage
6.2 Die Rechtsfolge: der Ersatz vergeblicher Aufwendungen
6.3 Die Anspruchsvoraussetzungen
6.4 Der Ausschluss des Aufwendungsersatzes
7. Der Rückgriff des Verkäufers
1. Der Sachmangel als Vertragsverletzung
2. Die gesetzliche Definition des Sachmangels
Bild 17: Der Sachmangel
3. Die Beweislast
4. Die vereinbarte Beschaffenheit der Kaufsache. 4.1 Die Beschaffenheit der Kaufsache
4.2 Die Vereinbarung einer bestimmten Beschaffenheit der Kaufsache
5. Die Brauchbarkeit der Kaufsache zur vertraglich vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung. 5.1 Der subjektive Verwendungszweck
5.2 Die vertraglich vorausgesetzte und die gewöhnliche Verwendung
5.3 Die Werbeaussage
6. Die fehlerhafte Montage
7. Die Falschlieferung und der Mengenfehler
8. Der Sachmangel beim Gefahrübergang
1. Das gesetzliche System. 1.1 Das Zufallsrisiko
1.2 Die Preisgefahr beim gegenseitigen Vertrag und beim Kauf
Bild 18: Der Übergang der Preisgefahr
2. Der Gefahrübergang durch Übergabe an den Käufer
3. Der Gefahrübergang durch Auslieferung beim Versendungskauf. 3.1 Der Gefahrübergang
3.2 Der Versendungskauf
3.3 Die Auslieferung der Ware an die Transportperson
3.4 Die Transportgefahr
3.5 Die Drittschadensliquidation
3.6 Die Haftung des Verkäufers
4. Die Nutzungen und Lasten der Kaufsache
5. Die Kosten der Übergabe oder Versendung
1. Die Verteidigung des Verkäufers
Bild 19: Einwendungen und Einreden des Verkäufers gegen die Sachmängelrechte des Käufers
2. Die vereinbarte Haftungsbeschränkung. 2.1 Die Individualvereinbarung
2.2 Die Arglist des Verkäufers
2.3 Die Beschaffenheitsgarantie des Verkäufers
2.4 Der Kauf eines neuen Eigenheims
2.5 Die Beschränkung der Sachmängelhaftung durch allgemeine Geschäftsbedingungen
3. Die Kenntnis und die grobfahrlässige Unkenntnis des Käufers vom Sachmangel. 3.1 Die Kenntnis des Käufers
3.2 Die grobfahrlässige Unkenntnis des Käufers
4. Die Haftungsbeschränkung des Verkäufers bei einer öffentlichen Versteigerung
5. Die Entlastung des Verkäufers von der Schadensersatzpflicht. 5.1 Die Beweislast
5.2 Der Umfang der Entlastung
6. Die Verjährung der Sachmängelansprüche. 6.1 Die Verjährungsfristen
6.2 Der Verjährungsbeginn
6.3 Die Verjährung bei Bauwerken und Baustoffen
6.4 Die Arglist des Verkäufers
6.5 Der Ausschluss des Rücktritts und der Minderung durch Verjährung der Nacherfüllung
1. Die vertragliche Garantie einst und jetzt
2. Die Rechtsfolge der Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie
3. Die Voraussetzungen einer Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie
1. Das gesetzliche System der Rechtsmängelhaftung
2. Die Rechtsfolgen des Rechtsmangels der Kaufsache. 2.1 Der Anspruch des Käufers auf Nacherfüllung
2.2 Rücktritt, Minderung, Schadensersatz und Aufwendungsersatz
3. Der Rechtsmangel der Kaufsache. 3.1 Die Beweislast
3.2 Die gesetzliche Definition des Rechtsmangels
3.3 Scheinrechte Dritter
3.4 Öffentlichrechtliche Eigentumsbeschränkungen
3.5 Öffentlichrechtliche Anliegerkosten
4. Die Einwendungen und Einreden des Verkäufers gegen die Rechtsmängelhaftung. 4.1 Die vertragliche Haftungsbeschränkung
4.2 Kenntnis und grobfahrlässige Unkenntnis des Käufers
4.3 Die Verjährung der Rechtsmängelhaftung
1. Aus alt mach neu und aus zwei mach eins
2. Die Ansprüche auf Erfüllung des Kaufvertrags. 2.1 Die Anspruchsgrundlage
2.2 Die Verschaffung des verkauften Rechts
2.3 Die Verschaffung eines sonstigen Gegenstandes
3. Die Rechts- und Sachmängelhaftung beim Rechtskauf
4. Die Rechts- und Sachmängelhaftung beim Unternehmenskauf
1. Der Vorrang des Kaufrechts vor dem allgemeinen Schuldrecht
2. Die unerlaubte Handlung des Verkäufers
3. Die Pflichtverletzung des Verkäufers außerhalb von Mängeln
4. Die Irrtumsanfechtung des Verkäufers
1. Das gesetzliche System
2. Keine vertragliche Haftungsbeschränkung im Voraus
3. Die Umgehung des Verbraucherschutzes
4. Die gesetzliche Vermutung für einen Sachmangel beim Gefahrübergang
5. Die Beschaffenheitsgarantie des Unternehmers
6. Die Verwirkung des Verbraucherschutzes
7. Der Rückgriff des Unternehmers
1. Der Vorbehaltskauf. 1.1 Die rechtliche Konstruktion des Eigentumsvorbehalts
Bild 20: Der Eigentumsvorbehalt
1.2 Die gesetzliche Regelung des Vorbehaltskaufs
1.3 Die gesetzliche Auslegungsregel
1.4 Der Herausgabeanspruch des Verkäufers
1.5 Die Spielarten des Eigentumsvorbehalts
Bild 21: Der verlängerte Eigentumsvorbehalt
1.6 Der nicht vereinbarte einseitige Eigentumsvorbehalt
2. Der Kauf auf Probe
3. Der Wiederkauf
4. Der Vorkauf. 4.1 Die rechtliche Konstruktion
Bild 22: Der Vorkauf
4.2 Die Ansprüche aus dem Vorkauf
4.3 Das Vorkaufsrecht
4.4 Der Vorkaufsfall
4.5 Die Ausübung des Vorkaufsrechts
4.6 Der Kaufvertrag mit dem Inhalt des Drittkaufs
5. Der Handelskauf. 5.1 Das gesetzliche System
5.2 Die Untersuchungs- und Rügelast des Käufers
5.3 Die rechtsvernichtende Einwendung des Ablaufs der Rügefrist
5.4 Der Gegeneinwand der rechtzeitigen Mängelrüge
5.5 Der Arglisteinwand des Käufers
5.6 Falschlieferung und Mengenfehler
1. Kapitel Das gesetzliche System
1. Die Anspruchsgrundlage
2. Die Rechtsfolge des Schenkungsversprechens
3. Die Voraussetzungen des Schenkungsversprechens. 3.1 Die vertragliche Einigung über die Unentgeltlichkeit der Zuwendung
3.2 Die unentgeltliche Zuwendung
3.3 Die gemischte Schenkung
3.4 Die fiktive Annahme des Geschenks
4. Die Form des Schenkungsversprechens
5. Die Haftung des Schenkers
3. Kapitel Die Schenkung unter Auflage
1. Die Notbedarfseinrede des Schenkers
2. Der Anspruch des verarmten Schenkers auf Herausgabe des Geschenks. 2.1 Die Anspruchsgrundlage und ihre Rechtsfolge
2.2 Die Voraussetzungen des Herausgabeanspruchs des Schenkers
2.3 Die Abwendungsbefugnis des Beschenkten
2.4 Der Ausschluss des Herausgabeanspruchs des Schenkers
1. Der Anspruch des Schenkers auf Herausgabe des Geschenks
2. Die Voraussetzungen des Herausgabeanspruchs
3. Der Ausschluss des Widerrufs und andere Einwendungen gegen den Herausgabeanspruch
1. Die gesetzliche Struktur der Miete
2. Die Mietrechtsreform 2001. 2.1 Die Vereinfachung des Mietrechts: Wunsch und Wirklichkeit
2.2 Das neue System des Mietrechts
3. Der Gang der Darstellung
1. Die Anspruchsgrundlage
2. Der Anspruch des Mieters auf Gebrauchsgewährung
3. Der Anspruch des Vermieters auf den Mietzins
4. Der Mietvertrag als Anspruchsvoraussetzung
1. Sachen
2. Wohnräume
3. Andere Räume
4. Grundstücke
5. Bewegliche Sachen
6. Die Mischmiete
1.1 Die freie Vereinbarung des Mietzinses
1.2 Die Mietbremse
2. Die Entstehung und Fälligkeit des Mietzinsanspruchs
3. Die Staffel- und die Indexmiete
4. Die Mieterhöhung
5. Die Betriebskosten der Mietsache. 5.1 Die Vereinbarung über die Betriebskosten
5.2 Die Abrechnung der Betriebskosten
5.3 Die verspätete Nachforderung von Betriebskosten
5.4 Verspätete Einwendungen des Wohnungsmieters gegen die Betriebskostenabrechnung
5.5 Die Abrechnung der Betriebskosten für vermietete Geschäftsräume
5.6 Erhöhung und Herabsetzung der Betriebskosten
5.7 Einseitig zwingendes Recht zum Schutz des Wohnungsmieters
5.8 Die Erstattung rechtsgrundlos bezahlter Betriebskosten
6. Die Schönheitsreparaturen. 6.1 Gesetz und Mietvertrag
6.2 Die Inhaltskontrolle vorformulierter Renovierungsabreden im Wohnmietvertrag
7. Die Mietkaution
8. Die Aufrechnung des Wohnungsmieters
9. Die persönliche Verhinderung des Mieters
1. Die freie Wahl des Vermieters und die vertragliche oder gesetzliche Beschränkung
2. Mehrere Vermieter oder Mieter
3. Der Mieterwechsel. 3.1 Unter Lebenden
3.2 Von Todes wegen
4. Der Vermieterwechsel nach gewerblicher Weitervermietung zum Wohnen
5. Der Vermieterwechsel durch Veräußerung der Mietsache. 5.1 „Kauf bricht nicht Miete“
5.2 Der gesetzliche Übergang des Wohnmietverhältnisses auf den neuen Eigentümer
5.3 Die Voraussetzungen des gesetzlichen Übergangs des Wohnmietverhältnisses
5.4 Die entsprechende Anwendung der §§ 566 ff
5.5 Die Schriftform des langfristigen Mietvertrags
1. Das Mietverhältnis auf bestimmte Zeit
2. Das Mietverhältnis auf unbestimmte Zeit
1. Sonderformen der Miete
2. Die Abgrenzung des Mietvertrags von anderen Vertragstypen
3. Die Miete in Mischverträgen
4. Mietvertragliche Nebenpflichten
1. Das gesetzliche System
Bild 24: Die Gewährleistung des Vermieters
2. Die Minderung des Mietzinses. 2.1 Die Kürzung und das Erlöschen der Mietzinsforderung
2.2 Die Voraussetzungen der Mietzinskürzung
Bild 25: Die Mietzinskürzung
2.3 Der Sachmangel der Mietsache
2.4 Das Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft
2.5 Der Rechtsmangel der Mietsache
3. Der Anspruch des Mieters auf Schadensersatz. 3.1 Die Anspruchsgrundlage und ihre Rechtsfolge
3.2 Die Voraussetzungen des Schadensersatzanspruchs
Bild 26: Der Anspruch des Mieters auf Schadensersatz
4. Der Anspruch des Mieters auf Ersatz seiner Aufwendungen
5. Die Konkurrenz der Mängelrechte des Mieters
6. Die Einwendungen des Vermieters gegen die Mängelrechte des Mieters. 6.1 Die Beweislast
6.2 Die vertragliche Haftungsbeschränkung
6.3 Die Kenntnis des Mieters vom Mangel
6.4 Die grobfahrlässige Unkenntnis des Mieters vom Mangel
6.5 Die vorbehaltlose Annahme der mangelhaften Mietsache
6.6 Die unterlassene Mängelanzeige des Mieters
6.7 Die Verjährung der Mängelansprüche des Mieters
1. Der Anspruch des Vermieters auf Unterlassung vertragswidrigen Gebrauchs
2. Der Anspruch des Vermieters auf Duldung von Erhaltungs- und Verbesserungsmaßnahmen
3. Der Anspruch des Vermieters auf Schadensersatz wegen unterlassener Mängelanzeige
1. Das Wegnahmerecht des Mieters
2. Der Anspruch des Wohnungsmieters auf „Barrierefreiheit“
1. Das gesetzliche System
Bild 27: Die Untermiete
2. Erlaubte und unerlaubte Untervermietung oder sonstige Gebrauchsüberlassung
3. Die Erlaubnis des Vermieters zur Untervermietung oder sonstigen Gebrauchsüberlassung
4. Der Untermieter als Erfüllungsgehilfe des Mieters
1. Ein besitzloses gesetzliches Pfandrecht und seine Rechtsfolgen
2. Die Voraussetzungen des Vermieterpfandrechts
3. Die Einwendungen des Mieters gegen das Vermieterpfandrecht
4. Das Selbsthilferecht des Vermieters
1. Das gesetzliche System. 1.1 Das Mietende als Einwendung und als Anspruchsgrundlage
1.2 Die Beendigungsgründe
Bild 28: Die Beendigung des Mietverhältnisses
1.3 Die Fortsetzung des beendeten Mietverhältnisses
2. Der Anspruch des Vermieters auf Rückgabe der Mietsache. 2.1 Gegen den Mieter
2.2 Gegen einen dritten Besitzer
3. Der Anspruch des Vermieters auf Nutzungsentschädigung. 3.1 Die Anspruchsgrundlage und ihre Rechtsfolge
3.2 Die Voraussetzung der Nutzungsentschädigung
4. Der Anspruch des Mieters auf Rückzahlung vorausbezahlten Mietzinses
5. Das Ende der Mietzeit
1. Kündigungsrecht und Kündigungserklärung
2. Die Kündigungsfrist
3. Die unberechtigte Kündigung
1. Das gesetzliche System
Bild 29: Der Schutz des Wohnungsmieters vor der Beendigung des Mietverhältnisses
2. Die formale Beschränkung der ordentlichen Kündigung von Wohnraum
3. Das berechtigte Interesse des Vermieters, die Mietwohnung ordentlich zu kündigen. 3.1 Das gesetzliche System
3.2 Die erhebliche schuldhafte Vertragsverletzung des Mieters nach § 573 II Nr. 1
3.3 Der Eigenbedarf des Vermieters nach § 573 II Nr. 2
3.4 Die angemessene wirtschaftliche Verwertung des Grundstücks nach § 573 II Nr. 3
3.5 Der Auffangtatbestand des § 573 I 1
4. Ausnahmen vom Kündigungsschutz
5. Der Anspruch des Wohnungsmieters auf Fortsetzung des gekündigten Mietverhältnisses. 5.1 Die Anspruchsgrundlage und ihre Rechtsfolge
5.2 Die Voraussetzungen des Fortsetzungsanspruchs
5.3 Der Widerspruch des Mieters
5.4 Die unzumutbare Härte
5.5 Das Ablehnungsrecht der Vermieters
5.6 Die Schranken der Vertragsfreiheit
1. Kündigungsrecht und Kündigungserklärung
2. Der wichtige Grund zur fristlosen Kündigung des Mietverhältnisses
Bild 30: Die fristlose Kündigung aus wichtigem Grund
3. Das Vorenthalten und die Entziehung des Mietgebrauchs
4. Die Gefährdung der Gesundheit des Mieters
5. Der vertragswidrige Mietgebrauch durch den Mieter
6. Der Zahlungsverzug des Mieters
7. Die Störung des Hausfriedens
8. Die Konkurrenz der Kündigungsgründe
9. Der Ersatz des Kündigungsschadens
10. Die außerordentliche befristete Kündigung des Mietverhältnisses
1. Die kurze Verjährungsfrist
2. Die Verjährung der Ersatzansprüche des Vermieters
3. Die Verjährung der Ansprüche des Mieters
1. Das gesetzliche Vorkaufsrecht des Wohnungsmieters
2. Die gesetzliche Konstruktion des Vorkaufsrechts
3. Der Anspruch des Wohnungsmieters auf Schadensersatz
4. Die Beschränkung der ordentlichen Kündigung
5. Die Realteilung
1. Das Erscheinungsbild des Leasings
2. Leasing und Miete
3. Das Leasing als Miete mit kaufrechtlicher Mängelhaftung
4. Die Abwälzung der Sach- und Preisgefahr auf den Leasingnehmer
5. Die Vollamortisation des Erwerbsaufwandes des Leasinggebers
6. Der Kauf als Geschäftsgrundlage des Leasing. 6.1 Das Dreiecksverhältnis zwischen Lieferant, Leasinggeber und Leasingnehmer
Bild 31: Leasing und Kauf
6.2 Die Störung der Geschäftsgrundlage des Leasingvertrags
7. Die Haftung für Hilfspersonen im Leasingverhältnis
8. Das Ende des Leasingverhältnisses
1. Das gesetzliche System
2. Die Ansprüche auf Erfüllung des Pachtvertrags. 2.1 Die Anspruchsgrundlage und ihre Rechtsfolge
2.2 Die Anspruchsvoraussetzung
2.3 Die Abgrenzung der Pacht zu anderen Nutzungsverträgen
3. Das Pachtinventar
4. Sonstige Besonderheiten der Pacht
5. Die Landpacht
1. Der unentgeltliche Ableger der Miete
2. Die Anspruchsgrundlage
3. Die beschränkte Haftung des Verleihers
4. Die Haftung des Entleihers
5. Das Ende der Leihe
1. Die rechtliche Struktur des Darlehens
2. Die Erscheinungsformen des Darlehens
3. Das Darlehen im System des BGB
1. Der Anspruch des Darlehensnehmers auf Gewährung des Darlehens
2. Der Anspruch des Darlehensgebers auf die vereinbarten Zinsen. 2.1 Die Anspruchsgrundlage und ihre Rechtsfolge
2.2 Zinsen und andere Nebenleistungen
1. Anspruchsgrundlage und Beweislast
2. Der Darlehensvertrag
3. Der Empfang des Darlehens
4. Die Fälligkeit der Rückzahlung des Darlehens. 4.1 Fristablauf und ordentliche Kündigung
4.2 Die außerordentliche Kündigung des Darlehens
4.3 Die fristlose Kündigung des Darlehens aus wichtigem Grund und wegen Störung der Geschäftsgrundlage
1. Die Nichtigkeit des Darlehensvertrags
2. Der Einwendungsdurchgriff
3. Der Tilgungseinwand
4. Die Verjährungseinrede
5. Die Einrede der Wechselhingabe
1. Das gesetzliche System
2. Die Aufklärungspflicht des Darlehensgebers
3. Die Beratungspflicht des Darlehensgebers
4. Versuche des Darlehensgebers, Vertragsverletzungen des Darlehensnehmers abzuwehren
1. Modernisierung total, aber für wen?
2. Das gesetzliche System des Verbraucherdarlehens und seiner Ableger
Bild 32: Das Verbraucherdarlehen
3. Die Voraussetzungen des Verbraucherdarlehens
4. Schriftform und Inhalt des Darlehensvertrags. 4.1 Die Schriftform
4.2 Der Vertragsinhalt
4.3 Vertragsabschrift und Tilgungsplan
4.4 Die Vollmacht
4.5 Erklärungen des Darlehensgebers
5. Formfehler und ihre Rechtsfolgen
6. Die Informationspflicht des Darlehensgebers. 6.1 Die vorvertragliche Information
6.2 Die vertragliche Information
7. Der Widerruf des Verbrauchers. 7.1 Das Widerrufsrecht des Verbrauchers und seine Ausnahmen
7.2 Form und Frist des Widerrufs
7.3 Die Rechtsfolgen des Widerrufs
8. Die verbundenen Verträge. 8.1 Der Widerruf des Verbrauchers
8.2 Die Verbindung eines anderen Verpflichtungsvertrags mit einem Verbraucherdarlehen
8.3 Der finanzierte Erwerb eines Grundstücks
8.4 Der Einwendungsdurchgriff des Verbrauchers
8.5 Zusammenhängende Verträge
8.6 Abschließende gesetzliche Regelung
9. Sonstige Maßnahmen des Verbraucherschutzes. 9.1 Kein Einwendungsverzicht
9.2 Die Information über einen Gläubigerwechsel
9.3 Weder Wechsel noch Scheck
9.4 Der Zahlungsverzug des Verbrauchers
9.5 Die Kündigung des Darlehensgebers
9.6 Kündigung und vorzeitige Rückzahlung des Verbrauchers
10. Das Immobiliar-Verbraucherdarlehen
11. Der Überziehungskredit. 11.1 Drei Möglichkeiten, ein Konto zu überziehen
11.2 Die erlaubte Kontoüberziehung
11.3 Die geduldete Kontoüberziehung
11.4 Die Pflicht des Darlehensgebers, die Kreditwürdigkeit des Darlehensnehmers zu prüfen
12. Die entgeltliche Finanzierungshilfe
13. Das unabdingbare Verbraucherschutzrecht
14. Existenzgründer
15. Unentgeltliche Darlehen und Finanzierungshilfen
1. Kapitel Das gesetzliche System
1. Die Anspruchsgrundlage und ihre Rechtsfolgen
2. Der Vergütungsanspruch
Bild 33: Der Anspruch auf eine Vergütung der Dienste
1. Ein gegenseitiger Verpflichtungsvertrag
2. Eine Verpflichtung nur zur Tätigkeit, nicht zum Erfolg
3. Die bunte Vielfalt der Dienstverträge
4. Die Abgrenzung des Dienstvertrags von anderen Vertragstypen. 4.1 Dienstvertrag und Arbeitsvertrag
4.2 Dienstvertrag und Werkvertrag
4.3 Dienstvertrag und Maklervertrag
4.4 Dienstvertrag und Geschäftsbesorgungsvertrag
1. Allgemeines Schuldrecht
2. Der Anspruch auf Dienstlohn ohne Dienstleistung. 2.1 Zwei Ausnahmen von der Regel des gegenseitigen Vertrags
2.2 Die kurzzeitige Verhinderung des Dienstpflichtigen
2.3 Der Annahmeverzug des Dienstberechtigten
3. Die Fürsorgepflicht des Dienstberechtigten
1. Voraussetzungen und Rechtsfolgen
Bild 34: Das Ende des Dienstverhältnisses
2. Das Ende des Dienstverhältnisses durch Zeitablauf
3. Die Beendigung des Dienstverhältnisses durch Kündigung
4. Die ordentliche befristete Kündigung des Dienstverhältnisses
5. Die fristlose Kündigung des Dienstverhältnisses aus wichtigem Grund. 5.1 Eine unabdingbare Ausstiegsmöglichkeit
5.2 Der wichtige Grund zur Kündigung
5.3 Die Vertragsverletzung als wichtiger Grund zur Kündigung
5.4 Die vertragliche Risikoverteilung
5.5 Die Ausschlussfrist für die fristlose Kündigung
5.6 Die Umdeutung der unwirksamen fristlosen Kündigung
5.7 Die unberechtigte Kündigung
6. Die fristlose Kündigung höherer Dienste
7. Die Vergütung nach fristloser Kündigung
8. Der Anspruch auf Ersatz des Kündigungsschadens
9. Der Anspruch des Dienstpflichtigen auf ein Zeugnis
1. Ein Dienst- und Geschäftsbesorgungsvertrag
2. Die Vergütung des Rechtsanwalts
3. Das Berufsbild des Rechtsanwalts
1. Die Anspruchsgrundlage
2. Die Rechtsfolge: Ein Anspruch des Mandanten auf Schadensersatz
3. Die Voraussetzungen der Anwaltshaftung
Bild 35: Die Beweislast für und gegen die Anwaltshaftung
4. Die Pflichtverletzung des Anwalts. 4.1 Die vertraglichen und vorvertraglichen Pflichten des Anwalts
4.2 Die Verletzung der vertraglichen oder vorvertraglichen Aufklärungspflicht des Anwalts
4.3 Was kann der Anwalt sonst noch falsch machen?
5. Der Schaden des Mandanten
6. Die Schadensverursachung durch den Anwaltsfehler. 6.1 Die Beweislast
6.2 Der Anscheinsbeweis für „aufklärungsrichtiges Verhalten“
6.3 Die Verursachung des Prozessverlustes durch den Anwaltsfehler
6.4 Die Schadensschätzung
7. Einwendungen und Einreden des Anwalts gegen seine Haftung. 7.1 Die vertragliche Haftungsbeschränkung
7.2 Die Weisung des Mandanten
7.3 Die Entlastung des Anwalts vom Schuldvorwurf
7.4 Das Mitverschulden des Mandanten
7.5 Die Verjährung der Anwaltshaftung
1. Drei Varianten
2. Die Krankenhaushaftung. 2.1 Die Vertragshaftung
2.2 Die Haftung aus unerlaubter Handlung
2.3 Die Organisationshaftung
Bild 36: Die Krankenhaushaftung
2.4 Typische Behandlungsfehler im Krankenhaus
2.5 Der Gläubiger des Schadensersatzanspruchs
1. Das gesetzliche System
2. Die Ansprüche aus dem Behandlungsvertrag. 2.1 Die Anspruchsgrundlage und ihre Rechtsfolgen
2.2 Behandlungsvertrag und Behandler
3. Die Informationspflicht des Behandlers
4. Die Einwilligung des Patienten und die Aufklärungspflicht des Behandlers
5. Die Dokumentationspflicht des Behandlers
1. Zwei Anspruchsgrundlagen
2. Die Rechtsfolge: ein Anspruch auf Schadensersatz
3. Das Mitverschulden des Patienten
4. Noch einmal zwei Anspruchsgrundlagen
5. Der Behandlungsfehler als Vertragsverletzung. 5.1 Die Anspruchsgrundlage
5.2 Die Pflichtverletzung des Behandlers
5.3 Der Schaden des Patienten und die Verursachung des Schadens
5.4 Das Verschulden des Behandlers
6. Der Behandlungsfehler als unerlaubte Handlung. 6.1 Die Anspruchsgrundlage
Bild 37: Die Beweislast für und gegen die Haftung des Behandlers nach § 823 I
6.2 Die Rechtfertigung des medizinischen Eingriffs
6.3 Die Einwilligung des Patienten
6.4 Die Aufklärung des Patienten
6.5 Die volle Haftung des Arztes für eine fehlerhafte oder unvollständige Aufklärung des Patienten
6.6 Die hypothetische Einwilligung des Patienten und der Entscheidungskonflikt
7. Der Behandlungsfehler
8. Der Gesundheitsschaden und seine Verursachung
1. Das neue System des Titels 9 im 2. Buch Recht der Schuldverhältnisse des BGB
2. Das System des Werkvertragsrechts
1. Die Anspruchsgrundlagen
2. Die Rechtsfolgen des Werkvertrags. 2.1 Der Anspruch des Bestellers auf mangelfreie Herstellung des Werks
2.2 Der Anspruch des Unternehmers auf die Vergütung
2.3 Der Anspruch des Unternehmers auf Abnahme seines Werks
Bild 38: Die Rechtsfolgen der Abnahme beim Werkvertrag
3. Der Werkvertrag als Anspruchsvoraussetzung. 3.1 Die Eigenart des Werkvertrags
3.2 Werkvertrag und Pauschalreisevertrag
3.3 Werkvertrag und Geschäftsbesorgung
3.4 Werkvertrag und Kauf
3.5 Der Bauvertrag
4. Der Vergütungsanspruch des Unternehmers. 4.1 Drei Möglichkeiten
Bild 39: Der Anspruch des Unternehmers auf den Werklohn
4.2 Die vereinbarte Vergütung des Werks
4.3 Die taxmäßige und die übliche Vergütung des Werks
4.4 Die fiktive Vergütung des Werks
4.5 Der Anspruch des Unternehmers auf Abschlagszahlungen
5. Die Fälligkeit der Vergütung. 5.1 Die Fälligkeit durch Abnahme des Werks
5.2 Die Fälligkeit der Vergütung ohne Abnahme
5.3 Die Fälligkeit der Vergütung, wenn der Besteller das Werk einem Dritten versprochen hat
5.4 Die noch nicht fällige Vergütung und das Zurückbehaltungsrecht des Bestellers
1. Das gesetzliche System der Mängelhaftung des Unternehmers
2. Die Anspruchs- und Rechtsgrundlagen der Mängelrechte und ihre Ausnahmen
Bild 40: Die Mängelrechte des Bestellers
1. Die Anspruchsgrundlage
2. Die Rechtsfolge des Nacherfüllungsanspruchs
3. Die Voraussetzungen des Nacherfüllungsanspruchs. 3.1 Werkvertrag, Abnahme, Mangel
3.2 Der Sachmangel des Werks
3.3 Der Rechtsmangel des Werks
3.4 Mängel des Architektenwerks und Baumängel
3.5 Mangelhafte Vorgaben des Bestellers und mangelhafte Vorleistungen anderer Unternehmer
3.6 Die arbeitsteilige Herstellung eines Werks
4. Die Verletzung des Nacherfüllungsanspruchs
5. Das Erlöschen des Nacherfüllungsanspruchs
1. Die Erstattung der Mängelbeseitigungskosten
2. Die Anspruchsvoraussetzungen
3. Der Vorschuss auf die Mängelbeseitigungskosten
4. Die abschließende gesetzliche Regelung
1. Rechtsgrundlage und Rechtsfolge
2. Die Voraussetzungen des Rücktritts und der Minderung
1. Die bunte Vielfalt der Ersatzansprüche
Bild 41: Der Anspruch des Bestellers auf Schadensersatz
2. Die Abgrenzung zwischen den verschiedenen Ersatzansprüchen
3. Der Anspruch des Bestellers auf „einfachen“ Schadensersatz
4. Der Anspruch des Bestellers auf Schadensersatz statt der Leistung
5. Der Anspruch des Bestellers auf Ersatz seines Verzögerungsschadens
6. Der Anspruch des Bestellers auf Ersatz seiner nutzlosen Aufwendungen
8. Kapitel Die Mängeleinrede des Bestellers und seine Aufrechnung
1. Das Wohnungseigentum
2. Mängel des Sondereigentums
3. Mängel des gemeinschaftlichen Eigentums
1. Die vertragliche Beschränkung der Mängelrechte
2. Die Mangelkenntnis des Bestellers bei der Abnahme
3. Die Entlastung des Unternehmers
4. Das Mitverschulden des Bestellers. 4.1 Eine Einwendung des Unternehmers
4.2 Das Mitverschulden des Bauherrn durch Architektenfehler
4.3 Die Rechtsfolge des Mitverschuldens des Bestellers
5. Der Vorteilsausgleich für „Sowieso-Kosten“
6. Die Verjährung der Mängelansprüche. 6.1 Die besondere Verjährung
6.2 Die besonderen Verjährungsfristen
6.3 Der Beginn der besonderen Verjährung
6.4 Rücktritt und Minderung nach Verjährung des Nacherfüllungsanspruchs
1. Der Vorrang der Mängelrechte
2. Die Unmöglichkeit der Herstellung und die Vergütungsgefahr. 2.1 Die gesetzliche Regel
2.2 Die gesetzlichen Ausnahmen
3. Sonstige Vertragsverletzungen des Unternehmers
4. Die vorvertragliche Pflichtverletzung des Unternehmers
5. Die unerlaubte Handlung des Unternehmers
6. Der Annahmeverzug des Bestellers
1. Das Unternehmerpfandrecht. 1.1 Ein gesetzliches Faustpfandrecht
1.2 Der Umfang der Sicherheit
1.3 Die Voraussetzungen des Unternehmerpfandrechts
1.4 Das Eigentümer-Besitzer-Verhältnis
2. Der Anspruch des Inhabers einer Schiffswerft auf eine Sicherungshypothek
1. Die ordentliche Kündigung des Bestellers und der Werklohn
2. Die fristlose Kündigung aus wichtigem Grund
1. Das Architekten- und Ingenieurwerk
2. Anwendbare Vorschriften
3. Das Sonderkündigungsrecht des Bestellers und weitere Sonderregeln
4. Der vereinbarte Umfang der Architektenleistung
5. Die Architektenvollmacht
6. Das Architektenhonorar. 6.1 Ja oder Nein
6.2 Die Honorarordnung für Architekten
6.3 Für wen gilt die HOAI?
6.4 Die Preisbindung
6.5 Das Architektenhonorar für Planungsleistungen
6.6 Die Fälligkeit des Architektenhonorars
1. Der Vertragsinhalt
2. Die Erscheinungsformen des Bauvertrags
3. Die Änderung des Bauvertrags und das Anordnungsrecht des Bestellers
4. Die Sicherungsrechte des Unternehmers. 4.1 Der Anspruch des Unternehmers auf eine Sicherungshypothek
4.2 Die Anspruchsvoraussetzungen
4.3 Der Anspruch des Unternehmers auf eine Bauhandwerkersicherung
5. Die Feststellung des Bautenstandes
6. Die Schriftform der Kündigung
16. Kapitel Der Verbraucherbauvertrag
17. Kapitel Der Bauträgervertrag
1. Die VOB und andere AGB
2. Die Vereinbarung der VOB/B
3. Wer stellt wem die VOB/B?
4. Der Werklohn nach der VOB/B. 4.1 Die Abrechnungsarten
4.2 Die Fälligkeit des Werklohns nach der VOB/B
4.3 Die Abnahme der Bauleistung nach der VOB/B
4.4 Die Schlusszahlungseinrede nach der VOB/B
4.5 Der Zahlungsverzug des Bauherrn
4.6 Die Vergütungsgefahr
5. Die Bauausführung nach der VOB/B. 5.1 Die vertraglichen Rechte und Pflichten
5.2 Die Bauverzögerung
5.3 Die Behinderung oder Unterbrechung der Bauleistung
5.4 Die Kündigung des Bauvertrags
6. Die Mängelhaftung des Unternehmers nach der VOB/B. 6.1 Vertragserfüllung und Mängelhaftung
6.2 Die Mängelansprüche des Bauherrn
6.3 Einwendungen des Unternehmers gegen die Mängelhaftung
6.4 Die Sicherung der Mängelrechte
1. Das gesetzliche System
2. Die Ansprüche und Verpflichtungen des Pauschalreisevertrags. 2.1 Die Anspruchsgrundlage und ihre Rechtsfolgen
2.2 Die Pauschalreise
2.3 Der Reiseveranstalter
2.4 Der Reisende
2.5 Die Fälligkeit des Reisepreises
2.6 Die Buchung der Pauschalreise
2.7 Die vorvertragliche Information
2.8 Die Vertragsübertragung
2.9 Die Vertragsänderung
3. Die Haftung des Reiseveranstalters für Reisemängel. 3.1 Das gesetzliche System
3.2 Der Anspruch des Reisenden auf Abhilfe
3.3 Die Minderung des Reisepreises
3.4 Das Kündigungsrecht des Reisenden
3.5 Der Anspruch des Reisenden auf Schadensersatz
3.6 Die Mängelanzeige des Reisenden
3.7 Die Verjährung der Mängelansprüche des Reisenden
3.8 Die Beschränkung der Haftung des Reiseveranstalters
4. Der Rücktritt vor Reisebeginn
5. Die Beistandspflicht des Reiseveranstalters
6. Die Insolvenzsicherung
7. Der Gastschulaufenthalt
8. Die Reisevermittlung
9. Die Haftung für Buchungsfehler
10. Abweichende Vereinbarungen
1. Erfolgsprovision und Entscheidungsfreiheit des Kunden
2. Sonderregeln
1. Die Anspruchsgrundlage und ihre Rechtsfolge
2. Die Anspruchsvoraussetzungen
Bild 42: Der Anspruch auf Maklerlohn
3. Die erste Anspruchsvoraussetzung: ein Maklervertrag. 3.1 Ein einseitig verpflichtender Vertrag
3.2 Der Mindestinhalt des Maklervertrags
3.3 Der Abschluss eines Maklervertrags durch schlüssiges Verhalten
3.4 Der Maklervertrag zugunsten Dritter
3.5 Die Form des Maklervertrags
3.6 Die Beweislast des Maklers
4. Die zweite Anspruchsvoraussetzung: eine erfolgreiche Maklertätigkeit. 4.1 Nachweis oder Vermittlung
4.2 Der erfolgreiche Nachweis oder die erfolgreiche Vermittlung
4.3 Der nachgewiesene oder vermittelte Vertrag des Kunden mit dem Dritten
4.4 Die wirtschaftliche Identität des geschlossenen mit dem vorgesehenen Vertrag
5. Einwendungen des Kunden gegen den Provisionsanspruch des Maklers. 5.1 Die Beweislast
Bild 43: Einwendungen gegen den Anspruch auf Maklerlohn
5.2 Die Unwirksamkeit des Maklervertrags
5.3 Das Erlöschen des Maklervertrags
5.4 Die Unwirksamkeit des Vertrags mit dem Dritten
5.5 Die wirtschaftliche Verflechtung zwischen Makler und Drittem
5.6 Der Ausschluss des Maklerlohns durch vertragswidrige Doppelvermittlung
5.7 Die Verwirkung des Maklerlohns durch schweren Vertrauensbruch
5.8 Der Anspruch des Kunden auf Schadensersatz
5.9 Die Herabsetzung des Maklerlohns
1. Der Alleinauftrag
2. Der Maklerdienst- und Maklerwerkvertrag
3. Die Darlehensvermittlung
4. Die Heiratsvermittlung. 4.1 Keine Provisionspflicht, nur Rechtsgrundabrede
4.2 Der Bereicherungsanspruch des Kunden
4.3 Zwingendes Recht
4.4 Die Partnerschaftsvermittlung
5. Die Vermittlung von Kaufverträgen über Wohnungen und Einfamilienhäuser
6. Die Wohnungsvermittlung
1. Das gesetzliche System
2. Der Anspruch des Auftraggebers auf die vereinbarte Geschäftsbesorgung. 2.1 Die Anspruchsgrundlage
2.2 Die Vertragsfreiheit und das Verschulden bei Vertragsverhandlungen
2.3 Die Weisungen des Auftraggebers
2.4 Die Übertragung des Auftrags und die Ausführung durch Dritte
3. Der Anspruch des Auftraggebers auf Auskunft und Rechnungslegung
4. Der Anspruch des Auftraggebers auf Herausgabe. 4.1 Der Gegenstand der Herausgabe
4.2 Die Herausgabe eines Geldbetrags
5. Der Anspruch des Beauftragten auf Ersatz seiner Aufwendungen. 5.1 Die Aufwendungen des Beauftragten
5.2 Der Schaden des Beauftragten
6. Der Anspruch auf Schadensersatz wegen Verletzung des Auftrags. 6.1 Die vertraglichen Verhaltenspflichten
6.2 Die Haftung des Beauftragten für jede Fahrlässigkeit
7. Das Ende des Auftrags
1. Die entgeltliche Besorgung eines fremden Geschäfts
2. Die Ansprüche aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag
1. Das alte BGB und der moderne Zeitgeist
2. Die modernisierte Stoffgliederung
3. Die modernisierte Begriffswelt des Bankvertragsrechts
4. Die Rechte und Pflichten der an einem Zahlungsvorgang Beteiligten. 4.1 Die Informationspflicht
4.2 Die Beschränkung der Vertragsfreiheit
4.3 Der Zahlungsdiensterahmenvertrag
4.4 Der Einzahlungsvertrag
4.5 Die Autorisierung eines Zahlungsvorgangs
4.6 Die Ausführung des Zahlungsvorgangs
5. Die Gutschrift
6. Das Kontokorrent
7. Die Vergütung der Zahlungsdienstleistung
8. Die Haftung des Zahlungsdienstleisters. 8.1 Der nicht autorisierte Zahlungsvorgang
8.2 Der zweifelhafte Zahlungsvorgang
8.3 Der nicht oder nicht richtig ausgeführte Zahlungsvorgang
8.4 Die abschließende gesetzliche Regelung
8.5 Die Beweislast
8.6 Der Regress
8.7 Die Anzeigepflicht
9. Die Haftung des Zahlers
10. Der Haftungsausschluss
11. Das Lastschriftverfahren
12. Das Scheckinkasso
13. Der Scheckvertrag
14. Das Akkreditiv
1. Die rechtliche Konstruktion
2. Die Abgrenzung
3. Die Haftung des Baubetreuers
4. Die Baugeldsicherung
5. Die Bauträgerverordnung
1. Die rechtliche Konstruktion
2. Rechtliches Können und rechtliches Dürfen
3. Verwaltungs- und Sicherungstreuhand
1. Die Haftung für einen falschen Rat
2. Der Auskunfts- oder Beratungsvertrag. 2.1 Der stillschweigende Vertragsschluss
2.2 Der Anspruchsberechtigte
2.3 Die Haftung für eine falsche Auskunft oder Beratung
1. Kapitel Das gesetzliche System
1. Der Anspruch des Hinterlegers auf Verwahrung
2. Der Anspruch des Verwahrers auf Vergütung und Aufwendungsersatz
3. Der Anspruch des Hinterlegers auf Herausgabe
4. Der Schadensersatzanspruch des Hinterlegers
5. Der Schadensersatzanspruch des Verwahrers
1. Die Gesellschaft als Schuldverhältnis
2. Die Gesamthandsgemeinschaft der Gesellschafter
3. Die Rechts- und Parteifähigkeit der Außengesellschaft
4. Die rechtsfähige Gesamthand – ein moderner Zwitter
5. Innen- und Außengesellschaft. 5.1 Die Außengesellschaft
5.2 Die Innengesellschaft
5.3 Die Ehegatteninnengesellschaft
5.4 Die nichteheliche Lebensgemeinschaft als Innengesellschaft
6. Erscheinungsformen der BGB-Gesellschaft. 6.1 Die Anwaltssozietät
6.2 Die Gemeinschaftspraxis
6.3 Die ARGE
6.4 Die Bauherrengemeinschaft
6.5 Der Sicherheitenverwertungsvertrag
6.6 Die Handelsgesellschaft
6.7 Die Gründungsgesellschaft
6.8 Die Lottospielgemeinschaft
6.9 Der partiarische Vertrag
1. Die Ansprüche auf Erfüllung und auf Abwicklung des Gesellschaftsvertrags
2. Die Ansprüche auf Schadensersatz wegen Verletzung des Gesellschaftsvertrags
3. Die Ansprüche der Gesellschaft gegen Dritte
1. Der Anspruch des Gesellschafters und der Anspruch der Gesellschaft
2. Die Gesellschafterbeiträge
3. Der Gesellschaftsvertrag als Anspruchsvoraussetzung
4. Die Einwendungen des Gesellschafters gegen die Beitragspflicht. 4.1 Der unwirksame Gesellschaftsvertrag und die fehlerhafte Gesellschaft
4.2 Die Leistungsstörung im Gesellschaftsverhältnis
5. Die Beitragserhöhung
4. Kapitel Die Gewinn- und Verlustbeteiligung des Gesellschafters
1. Die Gesellschaftsschulden aus Vertrag
2. Die vertragliche Haftungsbeschränkung
3. Die Gesellschaftsschulden aus Bereicherung
4. Die Haftung der Gesellschaft und der Gesellschafter aus unerlaubter Handlung
5. Der Gesamtschuldnerausgleich
1. Die rechtliche Struktur der Gesellschaft
2. Der Gesellschafterbeschluss. 2.1 Der Gesellschafterbeschluss als Rechtsgeschäft
2.2 Der einstimmige Beschluss der Gesellschafter
2.3 Der Mehrheitsbeschluss der Gesellschafter
2.4 Das Stimmrecht und die Freiheit der Abstimmung
2.5 Der Ausschluss von der Abstimmung
2.6 Der unwirksame Mehrheitsbeschluss
3. Die Geschäftsführung der Gesellschaft. 3.1 Das Innen- und Außenverhältnis
3.2 Die Geschäftsführungsbefugnis
3.3 Die gemeinschaftliche Geschäftsführung
3.4 Die Einzelgeschäftsführungsbefugnis und das Widerspruchsrecht
3.5 Der Ausschluss von der Geschäftsführung
3.6 Abberufung und Kündigung des Geschäftsführers
3.7 Die Rechte und Pflichten des Geschäftsführers
4. Die Vertretung der Gesellschaft
1. Die Summe der Gesellschafterrechte
2. Die Übertragbarkeit der Mitgliedschaft
3. Der Eintritt eines neuen Gesellschafters in die Gesellschaft
1. Der Anspruch des Gesellschafters auf Auseinandersetzung der aufgelösten Gesellschaft und auf Auszahlung seines Auseinandersetzungsguthabens. 1.1 Die Anspruchsgrundlage
1.2 Die Auseinandersetzung Schritt für Schritt
1.3 Der erste Schritt
1.4 Der zweite Schritt
1.5 Der dritte Schritt
1.6 Der vierte Schritt
1.7 Der Anspruch auf das Auseinandersetzungsguthaben
1.8 Innen- und Außenverhältnis
1.9 Die Innengesellschaft
2. Die Auflösung der Gesellschaft. 2.1 Die Rechtsfolge der Auflösung
2.2 Die Auflösung der Gesellschaft durch Zeitablauf und fristlose Kündigung
2.3 Die Auflösung der Gesellschaft durch ordentliche Kündigung
2.4 Die Auflösung der Gesellschaft durch fristlose Kündigung eines Gesellschaftsgläubigers
2.5 Die Auflösung der Gesellschaft durch Zweckerreichung und -verfehlung
2.6 Die Auflösung der Gesellschaft durch den Tod eines Gesellschafters
2.7 Die Auflösung der Gesellschaft durch Insolvenz eines Gesellschafters
1. Das Ausscheiden eines Gesellschafters aus der Gesellschaft. 1.1 Der Gesellschaftsvertrag
1.2 Das Anwachsen des Gesellschaftsanteils
1.3 Die Ansprüche des ausscheidenden Gesellschafters
1.4 Die vertragliche Beschränkung des Abfindungsanspruchs
1.5 Die Verjährung des Abfindungsanspruchs
1.6 Der Verlustausgleich
2. Das Ausscheiden des einen Gesellschafters und die Übernahme des Gesellschaftsvermögens durch den anderen
3. Der Ausschluss eines Gesellschafters
4. Das Recht eines Gesellschafters auf Übernahme des Gesellschaftsvermögens
1. Entweder Gesamthands- oder Bruchteilsgemeinschaft
2. Die Entstehung der Gemeinschaft
3. Ein gesetzliches Schuldverhältnis
4. Die Verfügung über den Anteil und über das gemeinschaftliche Recht
1. Die Nutzung des gemeinschaftlichen Gegenstandes
2. Die Kosten und Lasten des gemeinschaftlichen Gegenstandes
1. Das gesetzliche System
2. Die Verwaltungsvereinbarung
3. Der Mehrheitsbeschluss
4. Die gemeinschaftliche Verwaltung
5. Der Anspruch des Teilhabers auf eine billige Neuregelung
6. Das Notverwaltungsrecht des Teilhabers
1. Das gesetzliche System
2. Realteilung oder Versilberung des gemeinschaftlichen Gegenstandes
3. Die Tilgung der gemeinschaftlichen Schulden
4. Die Verteilung des Reinerlöses
5. Die Beschränkung der Aufhebung der Gemeinschaft
6. Das Ende der Gemeinschaft
1. Natürliche und juristische Person
2. Die körperschaftliche Organisation
3. Die Rechtsgrundlagen der juristischen Person
1. Die Vereinsgründung. 1.1 Eine Geburt in zwei Akten
1.2 Die Satzung des Vereins
2. Das Ende des Vereins
3. Die Vereinsorgane. 3.1 Die Mitgliederversammlung
3.2 Der Vorstand
1. Die Geschäfts- und Deliktsfähigkeit des Vereins
2. Die Haftung des Vereins
1. Der Beitritt zum und die Aufnahme in den Verein
2. Die Vereinsmitgliedschaft
3. Der Ausschluss aus dem Verein und andere Vereinsstrafen. 3.1 Die Vereinsgewalt
3.2 Die Ausschlussgründe
3.3 Die gerichtliche Kontrolle
5. Kapitel Das Vereinsregister
6. Kapitel Der nichtrechtsfähige Verein
7. Kapitel Die Stiftung
1. Eine schuldrechtliche, forderungsabhängige Sicherheit
Bild 44: Sicherheiten
2. Das hohe Risiko des Bürgen
3. Das Dreiecksverhältnis
Bild 45: Die Bürgschaft vor und nach Leistung des Bürgen
4. Anspruchsgrundlagen und Gegennormen
5. Sonderformen der Bürgschaft
1. Die Anspruchsgrundlage und ihre Rechtsfolge
2. Die Anspruchsvoraussetzungen
3. Die erste Anspruchsvoraussetzung: ein Bürgschaftsvertrag. 3.1 Ein einseitig verpflichtender Vertrag
3.2 Die schriftliche Erteilung der Bürgschaftserklärung
3.3 Die Auslegung der Bürgschaft
3.4 Die Fälligkeit der Bürgschaft
3.5 Die Geltungsdauer der Bürgschaft
4. Die zweite Anspruchsvoraussetzung: eine verbürgte Hauptschuld. 4.1 Entstehung und Fälligkeit der verbürgten Hauptschuld
4.2 Der Umfang der verbürgten Hauptschuld
5. Einwendungen und Einreden des Bürgen. 5.1 Das gesetzliche System
5.2 Einwendungen und Einreden des Bürgen gegen den Bürgschaftsvertrag
5.3 Die Verjährung der Bürgschaftsschuld
5.4 Einwendungen und Einreden des Bürgen gegen die verbürgte Hauptschuld
5.5 Die Einreden der Anfechtbarkeit und der Aufrechenbarkeit
5.6 Die Einrede der Vorausklage
5.7 Der Einwand der Pfandfreigabe
6. Der Schadensersatzanspruch des Bürgen gegen den Gläubiger
1. Der Anspruch des Bürgen auf Ersatz seiner Aufwendungen
2. Der gesetzliche Forderungsübergang
3. Die Voraussetzung des gesetzlichen Forderungsübergangs
4. Einwendungen und Einreden des Hauptschuldners
1. Die Bürgschaft auf erstes Anfordern. 1.1 Die vereinbarte Lockerung der Akzessorietät
1.2 Der Bürgschaftsprozess
1.3 Der Regressprozess des Bürgen gegen den Gläubiger
1.4 Der Anspruch des Hauptschuldners gegen den Gläubiger aus der Sicherungsabrede
2. Die Ausfallbürgschaft
3. Die Höchstbetragsbürgschaft
4. Die Mitbürgschaft
5. Die Nachbürgschaft
6. Die Rückbürgschaft
7. Die Prozessbürgschaft
8. Die Zeitbürgschaft
9. Gesetzliche Bürgschaften
10. Wechsel- und Scheckbürgschaft
1. Der Schuldbeitritt
2. Der Garantievertrag. 2.1 Das gesetzliche System
2.2 Die Garantie auf erstes Anfordern
1. Der Vergleich im Gesetz und im Rechtsleben
2. Die rechtliche Struktur des Vergleichs
3. Der Vergleich als Anspruchsgrundlage
4. Die Nichtigkeit des Vergleichs wegen eines gemeinsamen Irrtums über die Vergleichsgrundlage. 4.1 Die Beweislast
4.2 Der Vergleich
4.3 Der gemeinsame Irrtum über die Vergleichsgrundlage
5. Die Geschäftsgrundlage des Vergleichs
6. Sonstige Nichtigkeitsgründe
1. Der Abfindungsvergleich
2. Der Prozessvergleich
3. Der Anwaltsvergleich
4. Der Sanierungsvergleich
5. Das Teilungsabkommen
1. Selbstständige, abstrakte Verpflichtungen
2. Das Anerkenntnis im Rechtsleben
1. Die Anspruchsgrundlage und ihre Rechtsfolge
2. Die Anspruchsvoraussetzung: ein Vertrag über eine selbstständige Verpflichtung
3. Die Form des selbstständigen Schuldversprechens oder Schuldanerkenntnisses
4. Die Einwendungen des Schuldners gegen das selbstständige Schuldversprechen oder Schuldanerkenntnis. 4.1 Der Einwand der Nichtigkeit
4.2 Die Bereicherungseinrede
4.3 Die Verjährungseinrede
1. Ein vertraglicher Einwendungsverzicht
2. Das deklaratorische Anerkenntnis als Anspruchsgrundlage
3. Die Voraussetzung eines deklaratorischen Anerkenntnisses
1. Das verbriefte Recht
Bild 46: Wertpapiere
2. Das Namenspapier
3. Das Inhaberpapier
4. Das Orderpapier
1. Das gesetzliche Muster für Wechsel und Scheck
2. Die Anweisung als Doppelermächtigung
3. Das Valuta- und das Deckungsverhältnis
Bild 47: Die Anweisung
4. Form, Widerruf und Übertragung der Anweisung
5. Die Annahme der Anweisung. 5.1 Die Anspruchsgrundlage
5.2 Die Anspruchsvoraussetzungen
5.3 Die Einwendungen des Angewiesenen
1. Der Anspruch aus der Inhaberschuldverschreibung. 1.1 Die Anspruchsgrundlage
1.2 Der Erwerb einer Inhaberschuldverschreibung
2. Einwendungen des Ausstellers gegen die Inhaberschuldverschreibung. 2.1 Nur dreierlei Einwendungen
2.2 Die Ausschlussfrist
2.3 Leistung nur gegen Aushändigung der Schuldverschreibung
2.4 Die Kraftloserklärung
4. Kapitel Das Namenspapier mit Inhaberklausel
5. Kapitel Der Anspruch auf Vorlegung einer Sache und auf Einsicht in eine Urkunde
1. Ein einseitiges Verpflichtungsgeschäft
2. Das Preisausschreiben
3. Die Gewinnmitteilung
2. Kapitel Die Leibrente
1. Die unvollkommene Verbindlichkeit
2. Der verbindliche Spielvertrag
3. Der Spielsperrvertrag
1. Ein gesetzliches Schuldverhältnis
Bild 48: Die Geschäftsführung ohne Auftrag
2. Die berechtigte Geschäftsführung ohne Auftrag
3. Die unberechtigte Geschäftsführung ohne Auftrag
4. Die vermeintliche und die unechte Geschäftsführung ohne Auftrag
1. Der Anspruch des Geschäftsführers auf Ersatz seiner Aufwendungen. 1.1 Die Anspruchsgrundlage und ihre Rechtsfolge
Bild 49: Die berechtigte Geschäftsführung ohne Auftrag
1.2 Die Anspruchsvoraussetzung
1.3 Das fremde Geschäft
1.4 Das objektiv fremde Geschäft
1.5 Das objektiv neutrale Geschäft
1.6 Die berechtigte Übernahme des fremden Geschäfts
1.7 Einwendungen und Einreden des Geschäftsherrn
2. Die Ansprüche des Geschäftsherrn aus einer auftraglosen Geschäftsführung
1. Der Anspruch des Geschäftsführers auf Herausgabe der Bereicherung
2. Der Anspruch des Geschäftsherrn auf Schadensersatz
4. Kapitel Die vermeintliche und die unechte Geschäftsführung ohne Auftrag
1. Der Ausgleich rechtsgrundloser Vermögensverschiebungen
Bild 50: Die ungerechtfertigte Bereicherung
2. Die Anspruchsgrundlagen
3. Die Gegennormen
4. Die Abgrenzung des Bereicherungsanspruchs von anderen Ausgleichsansprüchen. 4.1 Der Vorrang des Vertragsrechts
4.2 Der Vorrang des Verbraucherschutzrechts
4.3 Das Eigentümer-Besitzer-Verhältnis
4.4 Die gesetzliche Verweisung auf das Bereicherungsrecht
4.5 Die Bereicherung im öffentliches Recht
1. Die Anspruchsgrundlage und ihre Rechtsfolge. 1.1 Der Anspruch auf Herausgabe der Bereicherung
1.2 Der Anspruch auf Wertersatz
1.3 Der Anspruch auf Herausgabe der Nutzungen
1.4 Mehrere Bereicherte
2. Die Anspruchsvoraussetzungen der Leistungskondiktion und die Beweislast
3. Die Leistung des Anspruchstellers
4. Die Bereicherung des Anspruchsgegners
5. Die Bereicherung auf Kosten des Anspruchstellers
6. Die Bereicherung durch eine Leistung ohne rechtlichen Grund. 6.1 Der Rechtsgrund der Leistung
6.2 Die Fälle einer rechtsgrundlosen Leistung
Bild 51: Die Leistungskondiktion
6.3 Das Fehlen des Rechtsgrundes
6.4 Der spätere Wegfall des Rechtsgrundes
6.5 Die Zweckverfehlung der Leistung
6.6 Die Leistung trotz eines Leistungsverweigerungsrechts
6.7 Die verbotene oder sittenwidrige Annahme der Leistung
1. Das Problem
2. Die Leistung durch oder an einen Vertreter
3. Die Leistung durch Vertrag zugunsten Dritter. 3.1 Der Leistungszweck im Deckungs- und im Valutaverhältnis
3.2 Der Doppelmangel im Deckungs- und im Valutaverhältnis
4. Die Leistung auf Anweisung. 4.1 Der Leistungszweck im Deckungs- und im Valutaverhältnis
4.2 Der Bereicherungsdurchgriff gegen den wissenden Anweisungsempfänger
4.3 Der Doppelmangel im Deckungs- und im Valutaverhältnis
4.4 Die irrige Annahme einer Anweisung und die unwirksame Anweisung
5. Die Leistung durch Banküberweisung. 5.1 Das Deckungs- und das Valutaverhältnis
5.2 Der Bereicherungsdurchgriff der Bank gegen den Überweisungsempfänger
6. Die Leistung auf fremde Schuld. 6.1 Die „Drittzahlung“
6.2 Die Versicherungsleistung
7. Die Leistung nach Abtretung der Forderung. 7.1 Die Leistung an den bisherigen Gläubiger
7.2 Die Leistung an den Abtretungsempfänger
1. Die Anspruchsgrundlage und ihre Rechtsfolge. 1.1 Der Anspruch auf Herausgabe der Bereicherung
1.2 Der Anspruch auf Wertersatz
2. Die Voraussetzungen einer Bereicherung „in sonstiger Weise“ 2.1 Nicht durch Leistung
2.2 Die Eingriffskondiktion
2.3 Die Bereicherung „in sonstiger Weise“ durch Vollstreckung in schuldnerfremdes Vermögen
2.4 Die Bereicherung „in sonstiger Weise“ durch eine Handlung des Entreicherten
2.5 Die Bereicherung „in sonstiger Weise“ durch Handlungen Dritter
2.6 Die Bereicherung in sonstiger Weise „auf dessen Kosten“
2.7 Die Bereicherung in sonstiger Weise „ohne rechtlichen Grund“
1. Das gesetzliche System
2. Der unberechtigte Eingriff durch entgeltliche Verfügung über ein fremdes Recht. 2.1 Die Anspruchsgrundlage und ihre Rechtsfolge
2.2 Die Anspruchsvoraussetzung
3. Der unberechtigte Eingriff durch unentgeltliche Verfügung über ein fremdes Recht. 3.1 Die Anspruchsgrundlage und ihre Rechtsfolge
3.2 Die Anspruchsvoraussetzung
4. Der unberechtigte Eingriff durch schuldbefreiende Annahme einer Leistung. 4.1 Die Anspruchsgrundlage und ihre Rechtsfolge
4.2 Die Anspruchsvoraussetzung
1. Die Anspruchsgrundlage
2. Die Rechtsfolge
3. Die Anspruchsvoraussetzungen
7. Kapitel Die Einrede der Bereicherung
1. Das gesetzliche System
2. Die Einwendung der Entreicherung aus § 818 III. 2.1 Der Grundgedanke des Bereicherungsrechts
2.2 Die Saldierung aller Vor- und Nachteile des Bereicherungsvorgangs
2.3 Die Saldierung der beiderseitigen Leistungen aus einem unwirksamen gegenseitigen Vertrag
2.4 Die verschärfte Haftung des Bereicherungsschuldners
3. Die Einwendung aus § 814 gegen die Leistungskondiktion wegen einer Nichtschuld
4. Die Einwendung aus § 815 gegen die Leistungskondiktion wegen Zweckverfehlung
5. Die Einwendung aus § 817 S. 2 gegen die Leistungskondiktion. 5.1 Die Rechtsfolge
5.2 Die Voraussetzung der Einwendung
5.3 Der Umfang des Anspruchsverlustes
6. Der Einwand des Rechtsmissbrauchs
7. Der Einwand der aufgedrängten Bereicherung
8. Die Verjährungseinrede
1. Die Vielfalt der Anspruchsgrundlagen mit und ohne Verschulden
2. Die unterschiedlichen Haftungssysteme. 2.1 Die vertragliche und die außervertragliche Haftung
2.2 Die Verschuldenshaftung
2.3 Die Haftung für vermutetes Verschulden
2.4 Die Erfolgs- oder Gefährdungshaftung
2.5 Die gesetzlichen Kriterien
Bild 52: Haftungssysteme
3. Die Konkurrenz der Schadensersatzansprüche. 3.1 Die Anspruchskonkurrenz
3.2 Die Gesetzeskonkurrenz
4. Die Anspruchsgrundlagen des Rechts der unerlaubten Handlung
5. Die Einwendungen und Einreden des Rechts der unerlaubten Handlung
6. Der Gang der Darstellung
1. Art und Umfang des Schadensersatzes
2. Der Ersatz des Verdienstausfalls
3. Die Schadensrente für Mehrbedarf und Verdienstausfall
4. Das Schmerzensgeld. 4.1 Die Anspruchsgrundlage
4.2 Die billige Entschädigung für einen Nichtvermögensschaden
4.3 Die Funktion des Schmerzensgeldes
4.4 Keine Zweckbindung des Schmerzensgeldes
5. Der Schadensersatz wegen der Entziehung oder Beschädigung einer Sache
6. Schadensersatz, Beseitigung vorhandener und Unterlassung künftiger Störungen
1. Der Ersatzberechtigte. 1.1 Der unmittelbar und der nur mittelbar Verletzte
1.2 Der Ersatz der Beerdigungskosten
1.3 Der Ersatz des Unterhaltsschadens
1.4 Das Schmerzensgeld
1.5 Der Schadensersatz für den Verlust gesetzlicher Dienste
1.6 Das Mitverschulden des Verletzten
1.7 Der gesetzliche Forderungsübergang
2. Der Schadensersatzschuldner. 2.1 Allein oder mit anderen
2.2 Mittäter, Anstifter und Gehilfen
2.3 Der Nebentäter und die gesetzliche Kausalitätsvermutung
2.4 Die Mitverursachung fremder Selbstschädigung
1. Anspruchsvoraussetzungen und Beweislast
2. Die Rechtsgutsverletzung
2.1 Das Leben eines anderen
2.2 Die körperliche Unversehrtheit eines anderen
2.3 Die Freiheit eines anderen
2.4 Das fremde Eigentum
2.5 Das sonstige Recht eines anderen
3. Die Verletzungshandlung
4. Das pflichtwidrige Unterlassen. 4.1 Garantenstellung und Garantenpflicht
4.2 Die Garantenstellung aus gefährlichem Tun und die Verkehrssicherungspflicht
4.3 Die Verkehrssicherungspflicht auf Privatgrundstücken
4.4 Die Verkehrssicherungspflicht beim Umgang mit gefährlichen Sachen
4.5 Die Verkehrssicherungspflicht in öffentlichen Anlagen
4.6 Die Verkehrssicherungspflicht auf öffentlichen Straßen und Wegen
4.7 Die Wegreinigungs- und Streupflicht
5. Die Schadensverursachung durch die Verletzungshandlung
6. Die Rechtswidrigkeit der Rechtsgutsverletzung. 6.1 Die Vermutung der Rechtswidrigkeit und die besondere Rechtfertigung
6.2 Die Einwilligung des Verletzten
6.3 Die Notwehr des Verletzers
6.4 Der Notstand des Verletzers
6.5 Die erlaubte Selbsthilfe des Verletzers
6.6 Das verkehrsrichtige Verhalten des Verletzers
6.7 Die Wahrnehmung berechtigter Interessen durch den Verletzer
6.8 Die Rechtswidrigkeit als Anspruchsvoraussetzung
7. Das Verschulden des Verletzers. 7.1 Vorsatz oder Fahrlässigkeit
7.2 Die Schuldunfähigkeit
7.3 Die Schuldunfähigkeit Minderjähriger
7.4 Die Billigkeitshaftung des Schuldunfähigen
7.5 Der schuldausschließende Rechtsirrtum
1. Das gesetzliche System
2. Der Anspruch des Namensträgers auf Beseitigung der Namensstörung. 2.1 Die Verletzung des Namensrechts
2.2 Der Anspruchsberechtigte
2.3 Der Anspruchsgegner
3. Der Anspruch auf Unterlassung weiterer Namensstörungen
1. Ein Rahmenrecht ohne scharfe Konturen
2. Die Rechtsgrundlage des allgemeinen Persönlichkeitsrechts
3. Die Abwehransprüche. 3.1 Die Anspruchsgrundlage und ihre Rechtsfolge
3.2 Der Anspruchsberechtigte
3.3 Der Anspruchsgegner
4. Der Anspruch auf Schadensersatz. 4.1 Der Ersatz des materiellen Schadens
4.2 Der Ersatz des immateriellen Schadens
5. Die rechtswidrige Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. 5.1 Tatbestand und Rechtswidrigkeit
5.2 Ein abgestufter Schutz nach der Schwere der Rechtsverletzung
6. Die Menschenwürde
7. Das Recht auf ein ungestörtes Intimleben
8. Das Recht auf ein ungestörtes Privatleben
9. Das Privatleben Prominenter
10. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung
11. Das Recht am eigenen Wort
12. Das Recht am eigenen Bild
1. Das gesetzliche System
2. Der Anspruch auf Schadensersatz. 2.1 Die Rechtsfolge
2.2 Die üble Nachrede
2.3 Die Rechtfertigung durch Wahrnehmung berechtigter Interessen
2.4 Die Wahrheit und Unwahrheit einer ehrenrührigen Behauptung
2.5 Der Auffangtatbestand der Beleidigung
3. Der Anspruch auf Beseitigung der Störung und auf Widerruf. 3.1 Die Anspruchsgrundlage und ihre Rechtsfolge
3.2 Die Voraussetzungen des Widerrufsanspruchs
4. Der Anspruch auf Unterlassung weiterer Ehrverletzungen. 4.1 Die Anspruchsgrundlage und ihre Rechtsfolge
4.2 Die Anspruchsvoraussetzungen
4.3 Die Rechtfertigung der ehrenrührigen Äußerung
5. Der Anspruch auf Gegendarstellung
1. Der Widerstreit zweier Grundrechte
2. Die Kriterien der Abwägung
3. Tatsachenbehauptungen und Werturteile. 3.1 Die Abgrenzung
3.2 Die Tatsachenbehauptungen der Medien
3.3 Die Tatsachenbehauptungen vor Gericht, gegenüber Behörden und durch Rechtsanwälte
4. Die Freiheit der Rede im öffentlichen Meinungskampf. 4.1 Die freie Rede des Staatsbürgers
4.2 Die Pressefreiheit
4.3 Der öffentliche Boykottaufruf
5. Die Schmähkritik
6. Die Freiheit von Kunst und Wissenschaft
1. Die Anspruchsgrundlage für Schadensersatz
2. Ein Rahmenrecht und Auffangtatbestand
3. Das Unternehmen
4. Der unmittelbare Eingriff in das Unternehmen. 4.1 Ein fragwürdiges Kriterium
4.2 Die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung
4.3 Der unberechtigte Boykottaufruf
4.4 Die unberechtigte Kritik an Waren oder Dienstleistungen
4.5 Weitere Beispiele
5. Die Abwehransprüche
1. Die Anspruchsvoraussetzungen
2. Das Schutzgesetz
3. Das Verschulden
1. Der Schutzumfang des § 826
2. Die sittenwidrige Schädigung
3. Der Schädigungsvorsatz
4. Typische Fälle einer vorsätzlich sittenwidrigen Schädigung
1. Die Anspruchsgrundlage und ihre Rechtsfolge
2. Die Anspruchsvoraussetzungen
13. Kapitel Die Bestimmung zu sexuellen Handlungen
1. Die Haftung für vermutetes Auswahl- und Überwachungsverschulden
2. Die Anspruchsgrundlage und ihre Rechtsfolge
3. Die Anspruchsvoraussetzungen. 3.1 Die Beweislast
3.2 Der Verrichtungsgehilfe
3.3 Die widerrechtliche Schädigung in Ausführung der Verrichtung
4. Der Einwand der Entlastung
1. Die Haftung für vermutetes Aufsichtsverschulden
2. Die Anspruchsgrundlage und ihre Rechtsfolge
3. Die Anspruchsvoraussetzungen. 3.1 Die Beweislast
3.2 Die Aufsichtspflicht
3.3 Die widerrechtliche Schädigung
4. Der Einwand der Entlastung
5. Typische Fälle einer Verletzung der Aufsichtspflicht
1. Das gesetzliche System. 1.1 Die Gefährdungshaftung für Tiere als gesetzliche Regel
1.2 Die Haftungsbeschränkung für Nutz-Haustiere als gesetzliche Ausnahme
2. Die Anspruchsgrundlage und ihre Rechtsfolge
3. Die Anspruchsvoraussetzungen. 3.1 Die typische Tiergefahr
3.2 Der Tierhalter
4. Die Entlastung für ein Nutz-Haustier. 4.1 Die Beweislast
4.2 Das Nutz-Haustier
4.3 Die Entlastung des Tierhalters
5. Der Tierhüter
6. Der vertragliche Haftungsausschluss und die Selbstgefährdung
1. Die Haftung für vermutetes Verschulden
2. Die Anspruchsgrundlage und ihre Voraussetzungen
3. Anspruchsberechtigter und Anspruchsgegner
4. Der Einwand der Entlastung
1. Staatshaftung statt Beamtenhaftung
2. Die Konkurrenz der Amtshaftung mit anderen Schadensersatzansprüchen
3. Die Rechtsfolge der Amtshaftung
4. Das System der Amtshaftung und die Beweislast
5. Gläubiger und Schuldner des Schadensersatzanspruchs
6. Die Staatshaftung nur für hoheitliche Verwaltungstätigkeiten
7. Die Verletzung einer Amtspflicht gegenüber einem Dritten. 7.1 Der Schutzzweck der Amtspflicht
7.2 Die Amtspflichtverletzung durch Verwaltungsakt
7.3 Das breite Spektrum der Amtspflichtverletzungen
8. Der Schaden und seine Verursachung
9. Das Verschulden des Beamten
10. Das Fehlen einer anderen Ersatzmöglichkeit. 10.1 Eine negative Anspruchsvoraussetzung
10.2 Die Beschränkung der Verweisung auf eine andere Ersatzmöglichkeit
11. Das „Spruchrichterprivileg“
12. Der Ausschluss der Amtshaftung durch Versäumung von Rechtsmitteln
13. Die Entschädigung für überlange Verfahrensdauer
14. Die Notarhaftung. 14.1 Die Berufsordnung des Notars
14.2 Die Anspruchsgrundlage für Schadensersatz
14.3 Die fahrlässige Amtspflichtverletzung
14.4 Die notarielle Beurkundung
15. Die Haftung des gerichtlichen Sachverständigen und des Zeugen
1. Regelverjährung statt Sonderregel
2. Der Beginn der Regelverjährung
3. Der Anspruch auf Herausgabe der Bereicherung trotz Verjährung
4. Die Einrede der unerlaubten Handlung
1. Unerlaubte Handlung oder Gefährdungshaftung
2. Die Abgrenzung
3. Die Gefährdungshaftung nach dem ProdHaftG. 3.1 Die Anspruchsgrundlage und ihre Rechtsfolge
3.2 Die Anspruchsvoraussetzungen
4. Der gesetzliche Haftungsausschluss
5. Das Mitverschulden des Geschädigten
6. Verjährung und Ausschlussfrist
1. Das gesetzliche System. 1.1 Die Halterhaftung
1.2 Die Fahrerhaftung
1.3 Die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung
1.4 Der Vorrang des StVG vor dem BGB
2. Die Halterhaftung: Rechtsfolgen und Voraussetzungen. 2.1 Die Anspruchsgrundlage und ihre Rechtsfolge
2.2 Die Voraussetzungen der Halterhaftung
2.3 Der Halter eines Kraftfahrzeugs
2.4 Der Schaden beim Betrieb eines Kraftfahrzeugs
3. Der Ausschluss der Halterhaftung
4. Das Mitverschulden des Geschädigten
5. Die mitwirkende Betriebsgefahr des anderen unfallbeteiligten Kraftfahrzeugs. 5.1 Das gesetzliche System
5.2 Die Abwägung der Betriebsgefahren
5.3 Die Erhöhung der Betriebsgefahr durch Verschulden des Fahrers
5.4 Der Ausschluss der Betriebsgefahr
5.5 Die Beweislast für und gegen eine schadensursächliche Betriebsgefahr
6. Die Schwarzfahrt
7. Sonstige Einwendungen gegen die Halterhaftung
8. Die Fahrerhaftung
1. Der Anspruch des Gastes auf Schadensersatz
2. Der Haftungsausschluss
1. Kapitel Allgemeines und besonderes Schuldrecht
1. Der Gegenstand des Schuldverhältnisses
2. Die Rechtsfolge des Schuldverhältnisses
3. Die Voraussetzungen des Schuldverhältnisses
Bild 53: Das Schuldverhältnis
4. Das Schuldverhältnis im engeren und im weiteren Sinn
5. Schuldverhältnisse außerhalb des Schuldrechts
6. Die Relativität des Schuldverhältnisses
7. Schuld und Haftung
8. Kein Schuldverhältnis durch unbestellte Leistung
1. Das gesetzliche System
2. Der Gegenstand der Leistung im Prozess und in der Zwangsvollstreckung
Bild 54: Die Leistung nach BGB und ZPO
3. Die Leistungshandlung und der Leistungserfolg
1. Der Geltungsbereich
2. Die Grundwerte der Verfassung als Maßstab
3. Das Gebot von Treu und Glauben als vielschichtige Generalklausel. 3.1 Der Schutz vor unerträglichen Rechtsfolgen
3.2 Die Fallgruppen von Treu und Glauben
1. Anspruch oder Einwendung
2. Die Ansprüche aus Treu und Glauben. 2.1 Der Anspruch auf Auskunft
2.2 Weitere Ansprüche aus Treu und Glauben
3. Die gebotene Rücksicht auf den anderen
4. Die fristlose Kündigung des Dauerschuldverhältnisses. 4.1 Ein unverzichtbares Recht
4.2 Das Dauerschuldverhältnis
4.3 Der wichtige Grund zur fristlosen Kündigung
4.4 Die Vertragsverletzung als wichtiger Grund
4.5 Die Ausschlussfrist
4.6 Kündigung und Schadensersatz
1. Die Rechtsfolge. 1.1 Eine rechtsvernichtende Einwendung
1.2 Der Gegenstand des Rechtsmissbrauchs
1.3 Die Fallgruppen des Rechtsmissbrauchs
2. Der unredliche Rechtserwerb
3. Die unredliche Verhinderung fremden Rechtserwerbs
4. Das widersprüchliche Verhalten
5. Die Verpflichtung zur sofortigen Rückgabe der geforderten Leistung
6. Das fehlende Eigeninteresse des Berechtigten
7. Unzumutbarkeit und Übermaßverbot. 7.1 Die Unzumutbarkeit
7.2 Das Übermaßverbot
8. Der Einwendungsdurchgriff
9. Die Durchgriffshaftung
10. Die Inhaltskontrolle von Verträgen nach Treu und Glauben
11. Das nachbarrechtliche Gemeinschaftsverhältnis
1. Die Risikoverteilung zwischen Vertragspartnern. 1.1 Die vertragliche oder gesetzliche Risikoverteilung
1.2 Die Antwort der Schuldrechtsreform
2. Geschäftsgrundlage und Geschäftsinhalt
3. Die Vertragstreue und ihre Ausnahmen
4. Die Rechtsfolgen einer Störung der Geschäftsgrundlage. 4.1 Die Anpassung des Vertrags an die veränderte Lage
4.2 Rücktritt vom oder Kündigung des gestörten Vertrags
4.3 Die Beweislast
5. Wann ist die vertragliche Geschäftsgrundlage gestört? 5.1 Die Unzumutbarkeit der Vertragstreue
5.2 Der Verpflichtungsvertrag
5.3 Die Geschäftsgrundlage
5.4 Die Störung der Geschäftsgrundlage
1. Ein außerordentlicher Rechtsbehelf
2. Die Rechtsfolge der Verwirkung
3. Die Voraussetzungen der Verwirkung
23. Teil Der Gegenstand der Leistung
1. Das gesetzliche System
2. Die Vereinbarung
3. Die Rechtsfolgen der Gattungsschuld. 3.1 Die geschuldete Qualität
3.2 Das Beschaffungsrisiko
3.3 Der Übergang der Gattungs- zur Stückschuld
1. Das gesetzliche System
2. Das Geld. 2.1 Das gesetzliche Zahlungsmittel
2.2 Bargeld und Buchgeld
2.3 Nennwert und Kaufkraft
3. Geldsummen- und Geldwertschuld
4. Das Nominalprinzip
5. Die Wertsicherung der Geldschuld. 5.1 Wertsicherung und Währungsrecht einst und jetzt
5.2 Die verbotene Gleitklausel und die Ausnahmen
5.3 Der vertragliche Leistungsvorbehalt
6. Die Fremdwährungsschuld
7. Die Zinsschuld
1. Der geschuldete Erfolg
2. Die Anspruchsgrundlage
3. Die Abtretung des Schuldbefreiungsanspruchs
4. Die Verjährung der Schuldbefreiungsanspruchs
1. Hilfsansprüche auf Mitteilung von Tatsachen
2. Die Auskunft
3. Die Rechenschaft
4. Das Bestandsverzeichnis
5. Die eidesstattliche Versicherung
6. Die Erfüllung der Auskunftspflicht
1. Die Wahlschuld
2. Die Ersetzungsbefugnis
1. Das gesetzliche System
2. Der vereinbarte Schadensersatz
3. Individueller und sozialer Schadensausgleich
4. Der Gang der Darstellung
1. Unmittelbar und mittelbar Geschädigter
2. Die Drittschadensliquidation. 2.1 Eine Erfindung der Rechtsprechung
Bild 55: Die Drittschadensliquidation
2.2 Die Schadensverlagerung
2.3 Die mittelbare Stellvertretung
2.4 Die Gefahrentlastung beim Versendungskauf und Werkvertrag
2.5 Der Verzug des Schuldners nach stiller Abtretung
2.6 Die Obhut für fremde Sachen
1. Herstellung und Wertersatz, entgangener Gewinn und Mitverschulden
2. Die besonderen Probleme des Schadensersatzrechts
1. Mittelbarer und unmittelbarer Schaden
2. Vermögens- und Nichtvermögensschaden. 2.1 Der Vermögensschaden
2.2 Der Nichtvermögensschaden
3. Nichterfüllungs- und Vertrauensschaden. 3.1 Vor der Schuldrechtsmodernisierung
3.2 Nach der Schuldrechtsmodernisierung
3.3 Das Recht der unerlaubten Handlung
4. Differenzschaden und normativer Schaden. 4.1 Die „Differenzhypothese“
4.2 Der normative Schaden
5. Die Art und Weise der Schadensberechnung. 5.1 Die konkrete Schadensberechnung
5.2 Die abstrakte Schadensberechnung
5.3 Dreierlei Schadensberechnung
6. Der Schadensnachweis
7. Der Zeitpunkt der Schadensberechnung
1. Das ungeschriebene gesetzliche System
2. Haftungsbegründende und haftungsausfüllende Kausalität. 2.1 Das unterschiedliche Beweismaß
2.2 Die Vermutung eines beratungsrichtigen Verhaltens
3. Conditio sine qua non und Äquivalenz. 3.1 Die Mindestvoraussetzung jeder Schadensersatzpflicht
3.2 Die Gleichwertigkeit aller Ursachen
3.3 Die Doppelkausalität
3.4 Die seelische Reaktion des Verletzten
3.5 Die Schadensanlage des Verletzten
3.6 Der Abbruch der Kausalreihe
1. Die Adäquanz als Korrektiv einer uferlosen Kausalität. 1.1 Keine Frage der Verursachung, sondern der rechtlichen Zurechnung eines Schadens
1.2 Keine Zurechnung inadäquater Schadensfolgen
1.3 Die „Selbstschädigung“ des Retters oder Verfolgers oder des Verletzten
2. Der Schutzzweck der verletzten Vertrags- oder Rechtsnorm. 2.1 Schadensersatz oder allgemeines Lebensrisiko des Verletzten
2.2 Die seelische Reaktion des Verletzten
2.3 Der Schockschaden
3. Die hypothetische Schadensursache. 3.1 Hypothetische und reale Ursachen
3.2 Körper- und Sachschäden
3.3 Vermögensschäden
4. Das rechtmäßige Alternativverhalten
1. Die Vor- und Nachteile einer Schädigung. 1.1 Die Beweislast
1.2 Die Rechtsfolge des Vorteilsausgleichs
2. Die Voraussetzungen des Vorteilsausgleichs
3. Die Schadensminderung durch den Geschädigten
4. Die Freigebigkeit Dritter
5. Die Lohn- oder Gehaltsfortzahlung
6. Die Versicherungsleistung
7. Die Unterhaltsleistung Dritter
8. Der vorzeitige Anfall einer Erbschaft
9. Ersparte Aufwendungen des Geschädigten
10. Der Steuervorteil
11. Die Wertsteigerung durch Schadensersatz
Bild 56: Die Art und Weise der Schadensersatzleistung
1. Die Herstellung eines schadensfreien Zustands
2. Der Ersatz der „erforderlichen“ Herstellungskosten. 2.1 Eine Ersetzungsbefugnis des Geschädigten
2.2 Die Voraussetzungen der Ersetzungsbefugnis
2.3 Die Höhe der erforderlichen Herstellungskosten
2.4 Die erforderlichen Heilungskosten
2.5 Die nach einer Sachbeschädigung erforderlichen Herstellungskosten
2.6 Die Reparaturkosten
2.7 Die Wiederbeschaffungskosten
2.8 Die Mietwagenkosten
2.9 Der Nutzungsausfall des Geschädigten
2.10 Die Kreditkosten des Geschädigten
2.11 Die Gutachterkosten des Geschädigten
2.12 Die Rechtsverfolgungskosten des Geschädigten
2.13 Die höheren Versicherungsprämien des Geschädigten
2.14 Verdorbener Urlaub und vergeudete Freizeit
2.15 Die Herstellungskosten nach Fristsetzung
3. Der Anspruch auf Wertersatz. 3.1 Geldersatz statt Herstellung
3.2 Die unmögliche Herstellung eines schadensfreien Zustandes
3.3 Die ungenügende Herstellung eines schadensfreien Zustandes
3.4 Der unverhältnismäßige Herstellungsaufwand
4. Der Gewinn- oder Verdienstausfall. 4.1 Rechtsfolge und Beweiserleichterung
4.2 Die begründete Gewinnaussicht
4.3 Der Verdienstausfall des Arbeitnehmers
4.4 Der Verdienstausfall des Selbstständigen
1. Das gesetzliche System. 1.1 Die Verteilung des Schadens
1.2 Der Geltungsbereich des Mitverschuldens
1.3 Die rechtliche Struktur des § 254
1.4 Die Einwendung des Mitverschuldens
2. Die Rechtsfolge des Mitverschuldens. 2.1 Die Anspruchskürzung als Normalfall
2.2 Die Abwägung der beiderseitigen Verursachungsbeiträge
2.3 Die Abwägung von Verschulden und Mitverschulden
2.4 Faustregeln für die Schadensabwägung
2.5 Die Schadensabwägung gegenüber mehreren Schädigern
3. Das Mitverschulden des Geschädigten an der Entstehung des Schadens. 3.1 Eine Obliegenheitsverletzung
3.2 Die zurechenbare Mitverursachung
3.3 Die Schuldunfähigkeit des Geschädigten
4. Das Mitverschulden durch Unterlassen einer Schadensminderung
5. Das Mitverschulden der Hilfspersonen des Geschädigten. 5.1 Das gesetzliche System
5.2 Das Schuldverhältnis zwischen Schädiger und Geschädigtem
5.3 Die Hilfspersonen des Geschädigten
5.4 Sonderfälle
6. Das Handeln auf eigene Gefahr. 6.1 Ein Schlagwort, das nicht hält, was es verspricht
6.2 Gefährliche Sportarten
6.3 Der Beifahrer
6.4 Der ungebetene Gast
6.5 Die Tiergefahr
1. Die Leistung eines Dritten. 1.1 Persönliche und unpersönliche Verpflichtungen
1.2 Die Erfüllungswirkung
1.3 Der Dritte und seine Leistungsbestimmung
2. Die Leistung des Schuldners an einen Dritten
3. Das Ablösungsrecht des Dritten
1. Die gesetzliche Regel
2. Die vertraglichen und gesetzlichen Ausnahmen
3. Teilbare und unteilbare Leistungen
1. Der Ort der Leistungshandlung
2. Hol-, Bring- und Schickschulden
3. Der Maßstab im Einzelfall
4. Einheitlicher oder gespaltener Leistungsort für Ansprüche aus dem. Vertrag
5. Der Zahlungsort. 5.1 Die Geldschuld als Schickschuld
5.2 Zahlungserfolg, Verlust- und Verzögerungsrisiko
1. Die Fälligkeit und die Erfüllbarkeit der Leistungspflicht
2. Vereinbarte und gesetzliche Leistungszeit
3. Die Stundung und ähnliche Abreden
4. Die Fälligkeit nach den Umständen
5. Die Fälligkeit der Geldforderung und die Rechnung
6. Die Vereinbarung der Fälligkeit einer Entgeltforderung
1. Ein Gegenrecht des Schuldners
2. Das gesetzliche System
3. Die Rechtsfolge der berechtigten Leistungsverweigerung. 3.1 Nach materiellem Recht
3.2 Nach Prozessrecht
4. Die Voraussetzungen des Zurückbehaltungsrechts. 4.1 Anspruch und Gegenanspruch
4.2 Der Schuldner als Gläubiger der Gegenforderung
4.3 Dasselbe rechtliche Verhältnis
5. Die Einwendungen des Gläubigers gegen das Zurückbehaltungsrecht des Schuldners
6. Der Anspruch auf Verwendungsersatz gegen den Herausgabeanspruch
1. Das gesetzliche System
2. Der Verpflichtungsvertrag und das gesetzliche Schuldrecht
3. Das gesetzliche Leitbild für Allgemeine Geschäftsbedingungen
4. Änderung, Ersetzung und Aufhebung eines Schuldverhältnisses. 4.1 Die Änderung eines Schuldverhältnisses
4.2 Die Ersetzung des alten durch ein neues Schuldverhältnis
4.3 Die Aufhebung des Schuldverhältnisses
4.4 Die Beweislast
1. Die Vereinbarung einer Verpflichtung
2. Der einseitig, mehrseitig oder gegenseitig verpflichtende Vertrag
3. Die kausale und die abstrakte Verpflichtung
4. Typische und atypische Verpflichtungsverträge. 4.1 Die gesetzlichen Vertragstypen
4.2 Mischverträge
4.3 Atypische Verträge
5. Die Form des Verpflichtungsvertrags. 5.1 Formfreiheit und Formzwang
5.2 Der Formzwang für die Verpflichtung zur Übertragung des Vermögens
1. Der Zweck der notariellen Beurkundung
2. Der Formfehler und seine Rechtsfolge. 2.1 Die Formnichtigkeit
2.2 Die fehlende, unvollständige oder falsche Beurkundung
3. Die vertragliche Verpflichtung zur Veräußerung oder zum Erwerb eines Grundstücks
4. Die unmittelbare vertragliche Verpflichtung zur Veräußerung oder zum Erwerb eines Grundstücks
5. Die mittelbare und die bedingte vertragliche Verpflichtung zur Veräußerung oder zum Erwerb eines Grundstücks
6. Die Beurkundung des ganzen Verpflichtungsvertrags
7. Die Beurkundung mehrer zusammengehöriger Verträge
8. Die Änderung oder Aufhebung der vertraglichen Verpflichtung zur Veräußerung oder zum Erwerb eines Grundstücks
9. Die Heilung des Formmangels. 9.1 Die Rechtsfolge der Heilung
9.2 Die Heilung durch Auflassung und Eintragung
9.3 Die Heilung einer formnichtigen mittelbaren oder bedingten Verpflichtung
9.4 Die Verhinderung der Heilung
1. Die vertragliche Verpflichtung zur Übertragung des künftigen Vermögens
2. Der Verpflichtungsvertrag über den Nachlass eines lebenden Dritten
1. Das gesetzliche System
2. Die nachträgliche Bestimmung der Leistung durch eine Partei. 2.1 Die Vereinbarung des Bestimmungsrechts
2.2 Die Leistungsbestimmung durch eine Partei nach „billigem Ermessen“
3. Die nachträgliche Bestimmung der Leistung durch einen Dritten. 3.1 Die Vereinbarung des Bestimmungsrechts
3.2 Die Leistungsbestimmung durch den Dritten nach billigem Ermessen
3.3 Die „offenbar unbillige“ Leistungsbestimmung des Dritten
4. Das Schiedsgutachten
1. Eine gesetzlich nicht geregelte Rechtsfigur des allgemeinen Schuldrechts
2. Die Rechtsfolge des Vorvertrags
3. Die Voraussetzungen des Vorvertrags. 3.1 Die vertragliche Verpflichtung zum Abschluss eines Hauptvertrags
3.2 Der versprochene Hauptvertrag
4. Ähnliche rechtliche Konstruktionen
1. Eine gesetzliche Rechtsfigur des allgemeinen Schuldrechts
2. Die Dreiecksbeziehung zwischen den Vertragspartnern und dem Dritten. 2.1 Die schuldrechtliche Konstruktion
2.2 Das Deckungsverhältnis
2.3 Das Zuwendungsverhältnis
2.4 Der Bereicherungsausgleich
3. Die Rechtsfolge des Vertrags zugunsten Dritter
Bild 58: Der Vertrag zugunsten Dritter
4. Die Voraussetzungen des Vertrags zugunsten Dritter. 4.1 Der Mindestinhalt des Vertrags zugunsten Dritter
4.2 Die Auslegung des Verpflichtungsvertrags
4.3 Die gesetzliche Auslegungsregel für eine Erfüllungsübernahme und gegen einen Schuldbeitritt
4.4 Die gesetzliche Auslegungsregel für einen Vertrag zugunsten Dritter
4.5 Die gesetzliche Auslegungsregel für den Zeitpunkt des Anspruchserwerbs
4.6 Der Erwerb des Dritten unmittelbar aus dem Vertrag unter Lebenden
5. Einwendungen des Versprechenden gegen den Anspruch des Dritten
6. Der Rechtsgrund der Zuwendung an den Dritten
7. Der Anspruch des Versprechensempfängers
1. Eine gesetzlich nicht geregelte Rechtsfigur des allgemeinen Schuldrechts
2. Die Rechtsfolge der vertraglichen Schutzwirkung für Dritte
3. Die Voraussetzungen des Schadensersatzanspruchs des Dritten. 3.1 Die Anspruchsgrundlage
3.2 Ein Verpflichtungsvertrag oder ein vorvertragliches Schuldverhältnis
3.3 Die Einbeziehung des Dritten in den Schutz des Vertrags oder des vorvertraglichen Schuldverhältnisses
3.4 Die Schädigung des schutzbedürftigen Dritten
4. Die Einwendungen des Schuldners
5. Die Verjährungseinrede des schutzbedürftigen Dritten
1. Das gesetzliche System
2. Die Rechtsfolge der vereinbarten Vertragsstrafe. 2.1 Der Anspruch auf die Vertragsstrafe
2.2 Die Vertragsstrafe statt der Vertragserfüllung
2.3 Die Vertragsstrafe neben der Vertragserfüllung
3. Die Voraussetzungen des Anspruchs auf die Vertragsstrafe. 3.1 Die Anspruchsgrundlage
3.2 Das Vertragsstrafeversprechen
3.3 Ohne Hauptschuld keine Vertragsstrafe
3.4 Die Abgrenzung der Vertragsstrafe von anderen Sanktionen
3.5 Die Verwirkung der Vertragsstrafe
4. Einwendungen des Schuldners gegen die Vertragsstrafe. 4.1 Die Beweislast
4.2 Die Annahme der Erfüllung ohne Vorbehalt der Vertragsstrafe
4.3 Die Herabsetzung der überhöhten Vertragsstrafe
1. Das gesetzliche System
2. Der Rücktritt als Einwendung gegen Vertragsansprüche
3. Der Anspruch auf Rückgewähr der Leistung oder auf Wertersatz. 3.1 Die Rückgewähr der Leistung
3.2 Der Wertersatz
3.3 Die Anspruchsvoraussetzungen
3.4 Der Verpflichtungsvertrag
3.5 Der vertragliche Rücktrittsvorbehalt
3.6 Das gesetzliche Rücktrittsrecht
3.7 Die Rücktrittserklärung
4. Einwendungen gegen den Rückgewähranspruch nach Rücktritt. 4.1 Der Verzicht auf das Rücktrittsrecht
4.2 Der verspätete Rücktritt
4.3 Die Aufrechnung des Anspruchsgegners
4.4 Das Reuegeld
4.5 Rechtsmissbrauch und Verwirkung
4.6 Die Verjährung des Rückgewähranspruchs
4.7 Die Rückgewähr nur Zug um Zug
4.8 Die Unmöglichkeit der Rückgewähr
5. Einwendungen gegen den Anspruch auf Wertersatz nach Rücktritt
6. Die Haftung des Vertragspartners nach Rücktritt vom Vertrag. 6.1 Der Anspruch auf Schadensersatz
6.2 Der Anspruch auf Nutzungsersatz
6.3 Der Anspruch auf Verwendungsersatz
1. Die Erlöschensgründe. 1.1 Die Erfüllung und ihre Surrogate
Bild 59: Erfüllung und Erfüllungsersatz
1.2 Andere Erlöschensgründe
2. Die Beweislast für das Erlöschen des Schuldverhältnisses
1. Der Leistungserfolg
2. Die Rechtsfolge der Erfüllung
3. Die Voraussetzung der Erfüllung. 3.1 Die Beweislast
3.2 Das Bewirken der geschuldeten Leistung
3.3 Die Leistung auf eine künftige Schuld
3.4 Die Abschlagszahlung
3.5 Die vorläufige und die bedingte Leistung
3.6 Die Leistung unter Vorbehalt
3.7 Die Zwangsvollstreckung
3.8 Die falsche, unvollständige und mangelhafte Leistung
3.9 Die Leistung eines Dritten
3.10 Die Leistung an einen Dritten
4. Die Leistung an Erfüllungs Statt. 4.1 Die Einigung zwischen Schuldner und Gläubiger
4.2 Die bargeldlose Zahlung
4.3 Die Haftung des Schuldners für seine Ersatzleistung
5. Die Leistung erfüllungshalber
6. Die unzureichende Leistung auf mehrere Verpflichtungen. 6.1 Die Leistungsbestimmung des Schuldners
6.2 Die gesetzliche Reihenfolge der Tilgung
7. Die Leistung auf das Darlehen oder auf die Grundschuld?
8. Der Anspruch des Schuldners auf eine Quittung
9. Der Anspruch des Schuldners auf Rückgabe des Schuldscheins
1. Das gesetzliche System
2. Die anspruchsvernichtende Einwendung der Hinterlegung. 2.1 Die Rechtsfolge
2.2 Die Voraussetzungen der schuldbefreienden Hinterlegung
2.3 Was darf der Schuldner hinterlegen?
2.4 Wann darf der Schuldner befreiend hinterlegen?
2.5 Wo soll der Schuldner hinterlegen?
2.6 Der Verlust des Rücknahmerechts
3. Die anspruchshemmende Einrede der Hinterlegung
4. Der Anspruch des Gläubigers auf die hinterlegte Sache oder Geldsumme. 4.1 Gegen den Schuldner
4.2 Gegen die Hinterlegungsstelle
4.3 Gegen andere Prätendenten
5. Der Selbsthilfeverkauf
1. Eine Rechtsgestaltung mit doppelter Wirkung
2. Das gesetzliche System
3. Die Rechtsfolge der Aufrechnung
4. Die Voraussetzungen der Aufrechnung. 4.1 Die Beweislast
Bild 60: Die Beweislast für und gegen die Aufrechnung
4.2 Die Aufrechnungserklärung
4.3 Die Aufrechnungslage
4.4 Zwei gegenseitige Forderungen
4.5 Zwei Forderungen auf gleichartige Leistungen
4.6 Die erfüllbare Hauptforderung
4.7 Die fällige Gegenforderung
5. Die Aufrechnung im Prozess. 5.1 Die Hilfsaufrechnung im Prozess
5.2 Die rechtskräftige Entscheidung über die Aufrechnung
5.3 Die Aufrechnung gegen eine Teilklage
6. Die Aufrechnungshindernisse. 6.1 Das gesetzliche System
6.2 Das vereinbarte Aufrechnungshindernis
6.3 Die Aufrechnung mit einer einredebehafteten Gegenforderung
6.4 Die Aufrechnung gegen eine Forderung aus vorsätzlich unerlaubter Handlung
6.5 Die Aufrechnung gegen eine unpfändbare Forderung
6.6 Die rechtsmissbräuchliche Aufrechnung
7. Der Aufrechnungsvertrag
1. Eine schuldrechtliche Verfügung über die Forderung
2. Der Erlassvertrag
3. Das negative Schuldanerkenntnis
4. Die Skontoabrede
1. Der gesetzliche Normalfall
2. Die abnormalen Störfälle
3. Das alte BGB und die Schuldrechtsmodernisierung
4. Der Gang der Darstellung
1. Eine bunte Vielfalt
2. Die Unmöglichkeit der Leistung nach altem Recht
3. Der Schuldnerverzug nach altem Recht
4. Die positive Forderungsverletzung nach altem ungeschriebenem Recht
5. Das Verschulden bei Vertragsverhandlungen nach altem ungeschriebenem Recht
1. Die Schuldrechtsmodernisierung
2. Die neue Einheit statt der alten Vielfalt. 2.1 Die Verletzung einer schuldrechtlichen Pflicht
Bild 61: Die Verletzung einer schuldrechtlichen Pflicht
2.2 Die alte Vielfalt hinter der neuen Einheit
3. Die Unmöglichkeit der Leistung nach neuem Recht
4. Der Schuldnerverzug nach neuem Recht
5. Die positive Forderungsverletzung nach neuem Recht
6. Das Verschulden bei Vertragsverhandlungen nach neuem Recht
1. Ein Grundtatbestand und mehrere spezielle Tatbestände
Bild 62: Der Anspruch des Gläubigers auf Schadensersatz
2. Keine Verschuldenshaftung, sondern Haftung für vermutetes Verschulden
3. Die Abgrenzung der unterschiedlichen Ansprüche auf Schadensersatz
4. Die Anspruchsgrundlagen und Gegennormen
5. Die Gläubigerrechte nach einer Pflichtverletzung des Schuldners
1. Die Anspruchsgrundlage
2. Die Rechtsfolge
3. Die Voraussetzungen des Anspruchs auf einfachen Schadensersatz
4. Die Entlastung des Schuldners
1. Die Anspruchsgrundlagen
2. Die Rechtsfolge. 2.1 Der Schadensersatz statt der Leistung
2.2 Der Schaden durch Ausbleiben der Leistung
2.3 Der Schadensersatz statt der Leistung als großer und kleiner Schadensersatz
2.4 Der Schadensersatz statt der Leistung im Dauerschuldverhältnis
2.5 Der Schadensersatz statt der Leistung und der Rücktritt
2.6 Das Erlöschen des vertraglichen Erfüllungsanspruchs
2.7 Der Anspruch des Schuldners auf Rückgewähr seiner Leistung
3. Die Voraussetzungen des Anspruchs auf Schadensersatz statt der Leistung. 3.1 Das gesetzliche System
3.2 Die Verletzung einer schuldrechtlichen Leistungspflicht
3.3 Die Nachfrist für die Leistung
3.4 Der Schadensersatz statt der Leistung ohne Nachfrist
3.5 Der Schadensersatz statt der Leistung nach einer Teilleistung
3.6 Die Verletzung einer schuldrechtlichen Pflicht zur Rücksicht
4. Der Ausschluss des Schadensersatzes statt der Leistung. 4.1 Die Entlastung des Schuldners
4.2 Die unerhebliche Schlechtleistung
1. Die Anspruchsgrundlage
2. Die Rechtsfolge. 2.1 Der Verzögerungsschaden
2.2 Die Berechnung des Verzögerungsschadens
3. Die Voraussetzungen des Anspruchs auf Ersatz des Verzögerungsschadens
4. Der Ausschluss des Anspruchs auf Ersatz des Verzögerungsschadens
1. Die Anspruchsgrundlage und ihre Rechtsfolge
2. Die Anspruchsvoraussetzungen
3. Der Ausschluss des Anspruchs auf Ersatz der Aufwendungen
1. Die Anspruchsgrundlage und ihre Rechtsfolge
2. Die Anspruchsvoraussetzungen
1. Die Rechtsgrundlage
2. Die Rechtsfolge
3. Der Rücktritt wegen Verletzung einer vertraglichen Leistungspflicht. 3.1 Der gesetzliche Normalfall
3.2 Der sofortige Rücktritt ohne Nachfrist
3.3 Der Rücktritt vor Fälligkeit der Leistung
3.4 Der Ausschluss des Rücktrittsrechts
4. Der Rücktritt wegen Verletzung einer vertraglichen Pflicht zur Rücksicht
5. Der Rücktritt wegen Unmöglichkeit der Leistung
1. Die unberechtigte Leistungsverzögerung
2. Die Rechtsfolgen des Schuldnerverzugs. 2.1 Das gesetzliche System
2.2 Der Anspruch des Geldgläubigers auf Verzugszinsen
2.3 Die Haftungsverschärfung durch Verzug
3. Die Voraussetzungen des Schuldnerverzugs. 3.1 Die Beweislast
Bild 63: Die Beweislast für und gegen den Schuldnerverzug
3.2 Der Schuldnerverzug durch Mahnung
3.3 Der Schuldnerverzug ohne Mahnung
3.4 Der Schuldnerverzug mit einem Entgelt
3.5 Abweichende Abreden
4. Der Ausschluss des Schuldnerverzugs. 4.1 Die rechtzeitige Leistung des Schuldners
4.2 Das Leistungsverweigerungsrecht des Schuldners
4.3 Die Entlastung des Schuldners
4.4 Die vereinbarte Haftungsbeschränkung
4.5 Die Vertragsuntreue des Gläubigers
4.6 Das Ende des Schuldnerverzugs
1. Das gesetzliche System
2. Die Rechtsfolgen der Unmöglichkeit
3. Die Befreiung des Schuldners von der unerfüllbaren Leistungspflicht. 3.1 Entstehungshindernis oder Erlöschensgrund
3.2 Die Beweislast für die Unmöglichkeit der Leistung
3.3 Die Unmöglichkeit der Leistung
4. Das Leistungsverweigerungsrecht des Schuldners. 4.1 Das grobe Missverhältnis zwischen dem Aufwand des Schuldners und dem Leistungsinteresse des Gläubigers
4.2 Die persönliche Unzumutbarkeit der Leistung
5. Die Unmöglichkeit der Leistung im gegenseitigen Vertrag. 5.1 Das Erlöschen des Anspruchs auf die Gegenleistung
5.2 Die Ausnahmen
5.3 Die Zufallsgefahr
1. Das gesetzliche System
2. Der Anspruch auf Schadensersatz wegen Verletzung der schuldrechtlich gebotenen Rücksicht
3. Die Anspruchsvoraussetzungen und die Beweislast. 3.1 Der gesetzliche Normalfall und seine Ausnahmen
3.2 Die Verletzung einer vertraglichen Aufklärungspflicht
3.3 Der grobe ärztliche Behandlungsfehler
3.4 Der Kassenfehlbetrag
4. Das Rücktrittsrecht des Gläubigers
5. Die schuldrechtliche Pflicht zur Rücksicht. 5.1 Das Schuldverhältnis
5.2 Zu welcher Rücksicht ist der Schuldner verpflichtet?
5.3 Die schuldrechtliche Unterlassungspflicht
5.4 Die schuldrechtliche Aufklärungspflicht
5.5 Die schuldrechtliche Mitwirkungspflicht
5.6 Die schuldrechtliche Fürsorge- und Obhutspflicht
5.7 Die nachvertragliche Pflicht zur Rücksicht
5.8 Die unberechtigte Leistungsverweigerung
6. Die Entlastung des Schuldners
7. Die Verjährung
1. Das gesetzliche System
2. Der Anspruch auf Schadensersatz wegen Verletzung einer vorvertraglichen Pflicht zur Rücksicht
3. Die Rechtsfolge: ein Anspruch auf Schadensersatz. 3.1 Der Ersatz des Vertrauensschadens
3.2 Der Ersatz des Schadens durch einen nachteiligen Vertrag
3.3 Der Ersatz des Nichterfüllungsschadens
4. Das vorvertragliche Schuldverhältnis
5. Die Verletzung einer vorvertraglichen Pflicht zur Rücksicht. 5.1 Treu und Glauben
5.2 Der Abbruch der Vertragsverhandlungen
5.3 Die Verursachung eines Dissenses oder Nichtigkeitsgrundes
5.4 Die Übervorteilung des Verhandlungsgegners
5.5 Die Verursachung eines Personen- oder Sachschadens
6. Der Schuldner des Schadensersatzes. 6.1 Der Verhandlungsgegner
6.2 Der Sachwalter
6.3 Die Prospekthaftung
7. Einwendungen des Schuldners gegen den Schadensersatzanspruch. 7.1 Die Entlastung des Schuldners
7.2 Die vertragliche Haftungsbeschränkung
7.3 Die Verjährung
1. Das gesetzliche System
2. Das Verschulden des Schuldners
3. Der Vorsatz des Schuldners
4. Die Fahrlässigkeit des Schuldners. 4.1 Die Verletzung der gebotenen Sorgfalt
4.2 Der objektive Maßstab
4.3 Die erforderliche Sorgfalt
4.4 Die Gruppenfahrlässigkeit
4.5 Die Grade der Fahrlässigkeit
5. Die Schuldunfähigkeit des Schuldners
6. Der vertragliche Haftungsausschluss
7. Das Verschulden der Hilfspersonen des Schuldners. 7.1 Die Beweislast
7.2 Der gesetzliche Vertreter des Schuldners
7.3 Der Erfüllungsgehilfe des Schuldners
8. Das Beschaffungsrisiko des Schuldners
9. Die Zahlungsunfähigkeit des Schuldners
10. Die Haftungsverschärfung durch Verzug des Schuldners
11. Die verschärfte Haftung des Herausgabeschuldners ab Rechtshängigkeit
1. Das System des gegenseitigen Vertrags
2. Die Rechtsfolge der Einrede des nicht erfüllten gegenseitigen Vertrags
3. Die Voraussetzungen der Einrede des nicht erfüllten gegenseitigen Vertrags
4. Die Einwendungen gegen die Einrede des nicht erfüllten gegenseitigen Vertrags. 4.1 Die Beweislast
4.2 Die Vorleistungspflicht des Schuldners
4.3 Die Erfüllung des Gegenanspruchs
4.4 Die Verjährung des Gegenanspruchs
4.5 Die endgültige Erfüllungsverweigerung des Schuldners
4.6 Die Leistungsverweigerung des Schuldners wider Treu und Glauben
5. Das Zurückbehaltungsrecht trotz Vorleistungspflicht des Schuldners
6. Der gegenseitige Vertrag in der Insolvenz des Schuldners
1. Die Verletzung einer Obliegenheit
2. Die Rechtsfolgen des Annahmeverzugs
3. Die Voraussetzungen des Annahmeverzugs
4. Das Unvermögen des Schuldners
1. Die Abtretung als Anspruchsgrundlage und Anspruchsverlust
2. Der Schuldnerschutz
3. Der gesetzliche Forderungsübergang und die Übertragung anderer Rechte
4. Die Wertpapiere
1. Der Übergang der Forderung
2. Der Übergang forderungsabhängiger Sicherheiten und Vorzugsrechte
1. Die Beweislast
2. Der Abtretungsvertrag. 2.1 Der Inhalt des Abtretungsvertrags
2.2 Die Abtretung als abstrakte Verfügung und ihr Rechtsgrund
2.3. Die Form des Abtretungsvertrags
3. Die Blankozession
4. Die Teilabtretung
5. Die Vorausabtretung. 5.1 Die Abtretung einer künftigen Forderung
5.2 Die Rechtsfolge der Vorausabtretung
5.3 Der Rang der Vorausabtretung
5.4 Die ausreichende Bestimmung der abgetretenen künftigen Forderung
6. Die Sicherungsabtretung. 6.1 Eine Abtretung mit Sicherungsabrede
Bild 64: Die Sicherungsabtretung
6.2 Eine selbstständige Sicherheit
6.3 Ein Treuhandgeschäft
6.4 Die stille Abtretung
6.5 Die Mehrfachabtretung durch Globalzession und verlängerten Eigentumsvorbehalt
6.6 Die Übersicherung des Sicherungsnehmers
7. Die Inkassozession
8. Das Factoring
9. Die Einziehungsermächtigung. 9.1 Das Recht, eine fremde Forderung im eigenen Namen einzuziehen
9.2 Der Umfang der Einziehungsermächtigung
9.3 Einziehungsrecht und Prozessführungsbefugnis
1. Die Beweislast
2. Der vertragliche Ausschluss der Abtretung. 2.1 Die Rechtsfolge
2.2 Die Ausschlussvereinbarung
2.3 Der vorformulierte Ausschluss der Abtretung
2.4 Der unwirksame Ausschluss der Abtretung
3. Der Ausschluss der Abtretung wegen Veränderung des Inhalts der Forderung
4. Der Ausschluss der Abtretung unpfändbarer Forderungen
5. Die verbots- und die sittenwidrige Abtretung
1. Das gesetzliche System
2. Die Einwendungen des Schuldners gegen die abgetretene Forderung. 2.1 Der Umfang der Einwendungen
2.2 Begründete Einwendungen
2.3 Der Einwendungsverzicht des Schuldners
3. Der Aufrechnungseinwand des Schuldners gegen. die abgetretene Forderung. 3.1 Die unterschiedlichen Fallgruppen
3.2 Das erweiterte Aufrechnungsrecht des Schuldners gegenüber dem Zessionar
4. Die Leistung des Schuldners an den Zedenten und sonstige Rechtsgeschäfte des Schuldners mit dem Zedenten über die abgetretene Forderung. 4.1 Der Schuldnerschutz
4.2 Die Kenntnis des Schuldners als Ausnahme vom Schuldnerschutz
5. Der Prozesssieg des Schuldners über den Zedenten
6. Die Mehrfachabtretung
7. Die Abtretungsanzeige des Zedenten
8. Die Leistung des Schuldners an den Zessionar nur gegen Aushändigung der Abtretungsurkunde
9. Kein gutgläubiger Forderungserwerb vom Nichtberechtigten
6. Kapitel Der gesetzliche Forderungsübergang
7. Kapitel Die Übertragung anderer Rechte
8. Kapitel Die Verpfändung und Pfändung der Forderung
1. Kapitel Das gesetzliche System
Bild 65: Die Schuldübernahme
2. Kapitel Die Rechtsfolge der Schuldübernahme
1. Die Schuldübernahme zwischen Übernehmer und Gläubiger
2. Die Schuldübernahme zwischen Übernehmer und Schuldner. 2.1 Der Schuldübernahmevertrag
2.2 Die Genehmigung des Gläubigers
2.3 Die Verweigerung der Genehmigung durch den Gläubiger
3. Die Übernahme einer Hypothekenschuld
1. Die Einwendungen gegen die Schuldübernahme
2. Die Einwendungen gegen die übernommene Schuld
3. Die Einwendungen aus dem Schuldverhältnis zwischen Schuldner und Übernehmer
1. Die rechtliche Konstruktion und ihre Rechtsfolge
2. Die Voraussetzungen des vertraglichen Schuldbeitritts
3. Die Einwendungen des beitretenden Schuldners
1. Das gesetzliche System
2. Die Rechtsfolge der Vertragsübernahme
3. Die Vereinbarung der Vertragsübernahme
4. Der Vertragsbeitritt
5. Die Entlassung aus einem Vertrag
1. Kapitel Das gesetzliche System
1. Eine gesetzliche Auslegungsregel
2. Die teilbare Leistung
1. Die gesetzliche Konstruktion der Gesamtschuld
2. Die Rechtsfolge der Gesamtschuld
3. Die Voraussetzungen der Gesamtschuld. 3.1 Die Gesamtschuld kraft Gesetzes
3.2 Die Gesamtschuld als Tilgungsgemeinschaft
3.3 Die Gesamtschuld trotz unterschiedlicher Schuldgründe
4. Die Gesamtwirkung der Erfüllung durch einen Gesamtschuldner
5. Die Gesamtwirkung des Erlasses der Schuld eines Gesamtschuldners
6. Die Gesamtwirkung weiterer Rechtsfolgen
7. Die Einzelwirkung aller anderen Tatsachen
1. Das gesetzliche System. 1.1 Das Innenverhältnis der Gesamtschuld
1.2 Die Anspruchsgrundlage und ihre Rechtsfolge
1.3 Die gesetzliche Regel und ihre Ausnahme
2. Der Gesamtschuldnerausgleich zu gleichen Anteilen
3. Der Gesamtschuldnerausgleich, „soweit ein anderes bestimmt ist“ 3.1 Andere ungleiche Anteile
3.2 Die abweichende Bestimmung durch den Vertrag
3.3 Die abweichende Bestimmung durch das Gesetz
3.4 Die abweichende Bestimmung durch die eheliche oder nichteheliche Lebensgemeinschaft
3.5 Die unterschiedlichen Verursachungsbeiträge mehrerer Schädiger
3.6 Die Leistungsunfähigkeit eines Gesamtschuldners
4. Die Anspruchsvoraussetzungen des Gesamtschuldnerausgleichs
5. Die Einwendungen gegen den Gesamtschuldnerausgleich
6. Der gesetzliche Forderungsübergang
7. Der Ausgleich im „gestörten Gesamtschuldverhältnis“
1. Die Rechtsfolge
2. Die Voraussetzung
3. Gesamtwirkung und Einzelwirkung
4. Der Gesamtgläubigerausgleich
1. Die Rechtsfolge
2. Die Voraussetzung
7. Kapitel Die Gesamthandsgläubiger
8. Kapitel Die Gesamthandsschuldner
1. Die vergebliche Suche nach einem gesetzlichen System
2. Die verstreuten Standorte des Verbraucherschutzrechts
2. Kapitel Der Verbrauchervertrag
1. Der außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Vertrag, vormals das Haustürgeschäft
2. Der Fernabsatzvertrag
3. Der elektronische Geschäftsverkehr
4. Abweichende Vereinbarung und Beweislast
4. Kapitel Der Ratenlieferungsvertrag
5. Kapitel Teilzeit-Wohnrechteverträge, Verträge über langfristige Urlaubsprodukte, Vermittlungsverträge und Tauschsystemverträge
1. Kapitel Die Rechtsgrundlage der Privatautonomie
Bild 66: Die Privatautonomie
1. Die Aspekte der Vertragsfreiheit
2. Vertragsfreiheit und Wirtschaftsordnung
3. Vertragsfreiheit und Grundgesetz
3. Kapitel Abschlussfreiheit und Abschlusszwang nach dem BGB
1. Die freie Vereinbarung des Vertragsinhalts
2. Der schuldrechtliche Verpflichtungsvertrag. 2.1 Der Vertrag und das Gesetz
2.2 Zwingende Rechtssätze
2.3 Die rechtliche Eigenart des Verpflichtungsvertrags
3. Dingliche und schuldrechtliche Verfügung
4. Ehe- und Erbvertrag
1. Das gesetzliche System
2. Das zivilrechtliche Benachteiligungsverbot. 2.1 Die unzulässige Benachteiligung
2.2 Die zulässige Benachteiligung
3. Die Rechtsfolgen einer unzulässigen Benachteiligung
4. Die unabsehbaren Folgen des AGG
1. Der Grundsatz der Formfreiheit
2. Wirk- oder Zweckform
3. Die Beweislast. 3.1 Für die gesetzliche Form
3.2 Für die vereinbarte Form
3.3 Für Abreden außerhalb der Vertragsurkunde
4. Die Rechtsfolge eines Formfehlers. 4.1 Der Mangel der gesetzlichen Form
4.2 Der Mangel der vereinbarten Form
4.3 Der Arglisteinwand gegen die Formnichtigkeit
4.4 Formfehler und Verschulden bei Vertragsverhandlungen
5. Die gesetzliche Form
Bild 67: Gesetzliche Formen des Rechtsgeschäfts
5.1 Die gesetzliche Schriftform
5.2 Die notarielle Beurkundung
5.3 Die öffentliche Beglaubigung
5.4 Die Erklärung vor einer Behörde oder vor Zeugen
5.5 Die Prozessform
6. Die rechtsgeschäftliche Form
1. Instrumente der Privatautonomie und Grundbegriffe des Vertragsrechts
2. Die Willenserklärung
3. Der Vertrag
4. Das Rechtsgeschäft. 4.1 Die rechtliche Konstruktion
4.2 Der Beschluss
4.3 Die Zustimmung Dritter
5. Die Grundformen privatautonomen Handelns
Bild 68: Das Rechtsgeschäft im System des BGB
1. Die verschiedenen Schubladen
Bild 69: Einseitiges und mehrseitiges Rechtsgeschäft
3. Verpflichtung und Verfügung. 3.1 Schuld- und Sachenrecht
Bild 70: Verpflichtung und Verfügung
3.2 Der Verpflichtungsvertrag
3.3 Die Verfügung
3.4 Kauf und Übereignung als Modelle für Verpflichtungsvertrag und dingliche Verfügung
4. Kausales und abstraktes Rechtsgeschäft. 4.1 Das gesetzliche System
4.2 Die Zuwendung
4.3 Der Rechtsgrund der Zuwendung
4.4 Das kausale Verpflichtungsgeschäft
4.5 Das abstrakte Verpflichtungsgeschäft
4.6 Die abstrakte Verfügung
4.7 Die Sicherungsvereinbarung
5. Rechtsgeschäfte unter Lebenden und von Todes wegen. 5.1 Die Überlebensbedingung als Kriterium
5.2 Die Formstrenge des Erbrechts
5.3 Die Rechtsfolgen von Todes wegen
5.4 Das Rechtsgeschäft unter Lebenden auf den Todesfall
1. Die juristische Auslegung
2. Willenserforschung oder Sinnermittlung?
Bild 71: Die Vertragsauslegung
3. Willenserklärung: ja oder nein?
1. Die Rechtsfolge
2. Die Beweislast für das übereinstimmende Verständnis
3. Die Falschbezeichnung und der gesetzliche Formzwang. 3.1 Falschbezeichnung und Formzweck
3.2 Falschbezeichnung und „Andeutungstheorie“
3.3 Die unterschiedliche Behandlung von Grundstückskauf und Testament
3.4 Falschbezeichnung und Falschbeurkundung
1. Ein Notbehelf im Auslegungsstreit
2. Die Beweislast im Auslegungsstreit
3. Normative Auslegung und Vertragsfreiheit
4. Das Ziel der normativen Auslegung
5. Der Maßstab der normativen Auslegung
6. Der Gegenstand der normativen Auslegung
7. Das Material der normativen Auslegung
8. Die normative Auslegung in der Praxis
9. Die objektive Auslegung im öffentlichen Interesse
10. Gesetzliche Auslegungsregeln
11. Die Vertragsauslegung im Prozess
1. Das lückenhafte Rechtsgeschäft
2. Die Ergänzung des lückenhaften Vertrags durch das Gesetz
3. Die Ergänzung des lückenhaften Vertrags durch Auslegung
4. Die ergänzende Vertragsauslegung in der Praxis
5. Ergänzende Vertragsauslegung und Störung der Geschäftsgrundlage
1. Die Erklärung eines Rechtsfolgewillens
2. Der Rechtsfolgewille und seine Erklärung
3. Der Handlungs-, Erklärungs- und Geschäftswille. 3.1 Die Facetten des Rechtsfolgewillens
3.2 Die gesunde und die kranke Willenserklärung
3.3 Der Handlungswille
3.4 Das Erklärungsbewusstsein
3.5 Der Geschäftswille
3.6 Die Moral von der Geschicht
1. Die Kundgabe einer Rechtsfolge
2. Die ausdrückliche Willenserklärung
3. Die stillschweigende Willenserklärung durch schlüssiges Verhalten. 3.1 Das schlüssige Verhalten
3.2 Die Verwahrung gegen Rechtsfolgen des eigenen Tuns
4. Das Schweigen als Willenserklärung
5. Das Schweigen an Erklärungs Statt
6. Die geschäftsähnliche Handlung
1. Das gesetzliche System
2. Die Rechtsfolge der Willenserklärung
3. Die Beweislast für das Wirksamwerden der Willenserklärung
4. Die empfangsbedürftige Willenserklärung. 4.1 Die Willenserklärung und ihr Adressat
4.2 Die Abgabe der Willenserklärung
4.3 Der Zugang der Willenserklärung
4.4 Die Übermittlung einer Willenserklärung an eine Hilfsperson
4.5 Die Zustellung der Willenserklärung
4.6 Die Störung des Zugangs einer Willenserklärung
5. Die Willenserklärung unter Anwesenden
6. Die Willenserklärung ohne Adressaten
1. Kapitel Das gesetzliche System
1. Der Mindestinhalt des Vertrags
2. Die vertraglichen Nebenabreden
3. Die gesetzliche Ergänzung des Vertragsinhalts
4. Der rechtliche Zusammenhang zwischen vertraglicher und gesetzlicher Regelung
1. Die Vertragsverhandlungen
2. Die vertragliche Bindung
1. Entweder – oder
2. Ein Problem der Auslegung
3. Die Gefälligkeitsfahrt
1. Die vertragliche Einigung
Bild 72: Konsens und Dissens
2. Das Ergebnis der Auslegung: Konsens, Dissens oder Irrtum?
3. Die Beweislast für die vertragliche Einigung
4. Die Methode der rechtlichen Prüfung
5. Der offene Dissens
6. Der versteckte Dissens
1. Die gesetzliche Konstruktion. 1.1 Die Annahme eines Angebots
1.2 Die Beweislast
2. Das Vertragsangebot. 2.1 Eine empfangsbedürftige Willenserklärung und ihr Inhalt
2.2 Vertragsangebot oder Werbung
2.3 Die Bindung des Anbieters an sein Angebot
2.4 Das Erlöschen des Vertragsangebots
3. Die Annahme des Vertragsangebots. 3.1 Das vorbehaltlose Ja zum Angebot
3.2 Die Annahme des Vertragsangebots durch Erklärung gegenüber dem Anbieter
3.3 Die Annahme des Vertragsangebots ohne Erklärung gegenüber dem Anbieter
4. Der Vertragsschluss durch eine Versteigerung
5. Der „faktische“ Vertrag
1. Das Diktat des Stärkeren und die Abwehr des Schwächeren
2. Was unterscheidet den AGB-Vertrag vom BGB-Vertrag?
3. Die Beweislast für und gegen die Vereinbarung von AGB
4. Die Methode der rechtlichen Prüfung
5. Der Geltungsbereich des AGB-Rechts
6. Allgemeine Geschäftsbedingungen. 6.1 Vertragsbedingungen
6.2 Vorformulierte Vertragsbedingungen
6.3 Der Verwender allgemeiner Geschäftsbedingungen
6.4 AGB und Individualabreden
6.5 Allgemeine Geschäftsbedingungen im notariellen Vertrag
7. Die Vereinbarung allgemeiner Geschäftsbedingungen. 7.1 Die gesetzlichen Voraussetzungen
7.2 Der Hinweis des Verwenders auf seine AGB
7.3 Die zumutbare Möglichkeit der Kenntnisnahme für den Kunden
7.4 Das Einverständnis des Kunden mit den fremden AGB
7.5 Die erleichterte Zustimmung des Unternehmers oder Sonderkunden
7.6 Vorformulierte Abwehrklauseln gegen fremde AGB
8. Überraschende allgemeine Geschäftsbedingungen
9. Der Vorrang der Individualabrede vor allgemeinen Geschäftsbedingungen
10. Die Auslegung allgemeiner Geschäftsbedingungen. 10.1 Die gesetzliche Regel
10.2 Die objektive Auslegung allgemeiner Geschäftsbedingungen
10.3 Die enge Auslegung allgemeiner Geschäftsbedingungen gegen den Verwender
10.4 Keine Auslegung für den Verwender
10.5 Die ergänzende Auslegung allgemeiner Geschäftsbedingungen
11. Die Unwirksamkeit allgemeiner Geschäftsbedingungen. 11.1 Die Rechtsfolge für den restlichen Vertrag
11.2 Die Teilnichtigkeit einer AGB
11.3 Die Inhaltskontrolle allgemeiner Geschäftsbedingungen
11.4 Die Schranken der Inhaltskontrolle
12. Die Verbandsklage auf Unterlassung und Widerruf
1. Das kaufmännische Bestätigungsschreiben
2. Die Rechtsfolge: Schweigen als Zustimmung
3. Das Bestätigungsschreiben und die Beweislast
Bild 74: Die Beweislast für und gegen Vertrag durch kaufmännisches Bestätigungsschreiben
4. Das Bestätigungsschreiben als Anspruchsgrundlage
5. Die Einwendungen gegen das Bestätigungsschreiben
1. Das gesetzliche System
2. Die Bedingung
3. Die Potestativbedingung
4. Die Wollensbedingung
5. Die aufschiebende und die auflösende Bedingung
1. Die Vereinbarung der Bedingung
2. Das einseitige Setzen der Bedingung
3. Die wirksame und die unwirksame Bedingung
4. Die Beweislast für und gegen einen bedingten Vertrag
1. Die Rechtsfolge der aufschiebenden Bedingung
2. Die Rechtsfolge der auflösenden Bedingung
3. Das Anwartschaftsrecht
4. Der Eintritt der Bedingung
5. Der Schadensersatzanspruch des bedingt Berechtigten
6. Die Zwischenverfügung während der Schwebezeit einer bedingten Verfügung. 6.1 Die Unwirksamkeit der Zwischenverfügung
6.2 Der wirksame Erwerb vom Nichtberechtigten
7. Der Ausfall der Bedingung
8. Die Manipulation der Bedingung. 8.1 Eine gesetzliche Fiktion als Rechtsfolge
8.2 Die Wollensbedingung als Ausnahme
8.3 Die Verhinderung einer Genehmigung
4. Kapitel Die rechtsgeschäftliche Befristung
1. Ein Instrument der Privatautonomie
2. Die Stellvertretung im rechtsgeschäftlichen System
Bild 75: Die Stellvertretung
1. Das Vertretergeschäft und seine Rechtsfolge
2. Eigengeschäft und Vertretergeschäft, Regel und Ausnahme
1. Der Vertreter
2. Der amtliche Verwalter eines Sondervermögens
3. Der Bote
4. Der mittelbare Vertreter
5. Strohmann und Treuhänder
6. Die Verfügung über ein fremdes Recht
7. Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfe
8. Der Besitzdiener
1. Das Offenlegen der Stellvertretung. 1.1 Die Auslegung der Erklärung
1.2 Der Irrtum des Erklärenden
1.3 Die Zeichnung des Vertreters
2. Das unternehmensbezogene Geschäft
3. Das Handeln unter fremdem Namen. 3.1 Die Lüge
3.2 Die Namenstäuschung
3.3 Die Identitätstäuschung
4. Das Geschäft für den, den es angeht
1. Die Rechtsgrundlage
Bild 76: Die Vertretungsmacht
2. Vertretungsmacht und Schuldverhältnis. 2.1 Können und Dürfen, Außen und Innen
Bild 77: Die rechtsgeschäftliche Vertretung innen und außen
2.2 Mehr Können als Dürfen
2.3 Der Missbrauch der Vertretungsmacht als Grenzfall
3. Einzel- und Gesamtvertretungsmacht
4. Die gesetzliche Vertretungsmacht
1. Die rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht
Bild 78: Die Vollmacht
2. Die Erteilung der Vollmacht. 2.1 Ein einseitiges Rechtsgeschäft
2.2 Innen- und Außenvollmacht
2.3 Die stillschweigende Bevollmächtigung
2.4 Die Form der Bevollmächtigung
3. Die Vollmachtsurkunde
4. Der Umfang der Vollmacht
5. Das Erlöschen der Vollmacht. 5.1 Der Widerruf der Vollmacht
5.2 Das Ende des Schuldverhältnisses
5.3 Der Tod des Auftraggebers und die Vollmacht über den Tod hinaus
5.4 Der Schutz des Geschäftsgegners
6. Die unwiderrufliche Vollmacht
7. Die Untervollmacht
8. Die Duldungs- und die Anscheinsvollmacht
9. Die Prokura. 9.1 Eine besondere Vollmacht des Kaufmanns
9.2 Die Erteilung der Prokura
9.3 Der gesetzliche Umfang der Prokura
9.4 Das Erlöschen der Prokura
10. Die Handlungsvollmacht
11. Die Ladenvollmacht
12. Die Vollmacht des Versicherungsvertreters
13. Die Prozessvollmacht
1. Die Willenserklärung des Vertreters
2. Der Willensmangel des Vertreters
3. Das Wissen oder Wissenmüssen des Vertreters
4. Das Wissen oder Wissenmüssen des Vollmachtgebers
5. Der Wissensvertreter
1. Die Rechtsfolgen rechtsgeschäftlichen Handelns ohne Vertretungsmacht
2. Der Mangel der Vertretungsmacht
3. Der Vertrag ohne Vertretungsmacht
1. Das gesetzliche System
2. Die Garantiehaftung des Vertreters ohne Vertretungsmacht. 2.1 Die Anspruchsgrundlage und ihre Rechtsfolge
2.2 Die Voraussetzungen der Garantiehaftung des Vertreters
2.3 Die Haftung des Untervertreters
3. Die Vertrauenshaftung des Vertreters ohne Vertretungsmacht
4. Der Ausschluss der Vertreterhaftung
1. Die Rechtsfolge
2. Eine Einwendung gegen das Vertretergeschäft
3. Der Missbrauch des Vertreters
4. Die Kenntnis oder das Kennenmüssen des Geschäftsgegners
1. Das gesetzliche System
2. Die Rechtsfolge des Insichgeschäfts
3. Die Voraussetzungen des Insichgeschäfts. 3.1 Das Vertretergeschäft
3.2 Der einsame Vertreter
3.3 Der rechtliche Vorteil des Insichgeschäfts
3.4 Umgehungsversuche
4. Das wirksame Insichgeschäft als Ausnahme. 4.1 Die Beweislast
4.2 Die Gestattung des Insichgeschäfts
4.3 Die Erfüllung einer Verpflichtung durch das Insichgeschäft
5. Die Kundgabe des Insichgeschäfts
1. Das gesetzliche System
2. Gesetzliche und vereinbarte Zustimmung
3. Die behördliche und gerichtliche Genehmigung
4. Die Zustimmung des Dritten als einseitiges Rechtsgeschäft
5. Die Einwilligung des Dritten
6. Die Genehmigung des Dritten
1. Die Verfügung des Nichtberechtigten
2. Die Verfügungsermächtigung
3. Keine Verpflichtungsermächtigung
4. Die Genehmigung der unberechtigten Verfügung des Nichtberechtigten
5. Die Heilung der unwirksamen Verfügung des Nichtberechtigten
1. Nichtigkeit, Unwirksamkeit, Anfechtbarkeit
Bild 79: Die Rechtsfolgen des fehlerhaften Rechtsgeschäfts
2. Absolute und relative Unwirksamkeit
3. Nichtiges und unfertiges Rechtsgeschäft
4. Die Rechtsfolge Nichtigkeit
5. Die Beweislast für den Nichtigkeitsgrund
1. Die gesetzliche Auslegungsregel für Totalnichtigkeit und die Beweislast
2. Das teilbare Rechtsgeschäft
3. Der rechtliche Zusammenhang mehrerer Rechtsgeschäfte. 3.1 Der Parteiwille
3.2 Der Anscheinsbeweis für und gegen den Zusammenhang mehrerer Rechtsgeschäfte
3.3 Verpflichtungsvertrag und Verfügung
3.4 Die Geschäftsgrundlage
4. Die personelle Teilbarkeit eines Rechtsgeschäfts
5. Die Teilwirksamkeit eines Rechtsgeschäfts durch Auslegung
6. Die Grenzen der Totalnichtigkeit
1. Die Rechtsfolge der Umdeutung
2. Das nichtige und das andere Rechtsgeschäft
3. Die Umdeutung des nichtigen Rechtsgeschäfts durch Auslegung
4. Die Bestätigung des nichtigen Rechtsgeschäfts
1. Das gesetzliche System
2. Der Schutz des Geschäftsunfähigen
3. Die Einwendung der Geschäftsunfähigkeit
4. Die Rechtsfolge der Geschäftsunfähigkeit oder sonstigen Geistesstörung
5. Die Geschäftsunfähigkeit
6. Die partielle Geschäftsunfähigkeit
1. Das gesetzliche System
2. Die Einwendung der beschränkten Geschäftsfähigkeit
3. Das zustimmungsbedürftige Geschäft des Minderjährigen. 3.1 Der Vertrag des Minderjährigen
3.2 Das einseitige Rechtsgeschäft des Minderjährigen
3.3 Der gesetzliche Vertreter des Minderjährigen
3.4 Die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters
3.5 Die fiktive Einwilligung des gesetzlichen Vertreters
3.6 Die Genehmigung des gesetzlichen Vertreters
4. Das zustimmungsfreie Geschäft des Minderjährigen. 4.1 Der rechtliche Vorteil des Minderjährigen
4.2 Die volle Geschäftsfähigkeit des Minderjährigen für besondere Lebensbereiche
5. Umfang und Grenzen des Minderjährigenschutzes
1. Eine anspruchshindernde Einwendung
2. Die Rechtsfolge des verbotenen Rechtsgeschäfts. 2.1 Die unheilbare Nichtigkeit
2.2 Total- oder Teilnichtigkeit
3. Das gesetzliche Verbot. 3.1 Rechtliches Dürfen und rechtliches Können
3.2 Die Verbotsnorm mit Nichtigkeitsfolge
3.3 Die verbotene Rechtsfolge
3.4 Das gewerbepolizeiliche Verbot
3.5 Die verbotene Rechtsdienstleistung (vormals Rechtsberatung)
3.6 Die verbotene Berufsausübung ohne Konzession
3.7 Die Strafbarkeit eines Rechtsgeschäfts
3.8 Der Verstoß gegen die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
3.9 Sonstige Übertretungen eines gesetzlichen Verbots
4. Umgehungsgeschäfte
1. Eine anspruchshindernde Einwendung
2. Die Rechtsfolgen des sittenwidrigen Rechtsgeschäfts. 2.1 Die unheilbare Nichtigkeit
2.2 Die ungerechtfertigte Bereicherung
2.3 Das Verschulden bei Vertragsverhandlungen
3. Die guten Sitten. 3.1 Ein unbestimmter Rechtsbegriff
3.2 Der Zeitgeist und die Sozialmoral
3.3 Die Wertordnung des Grundgesetzes
4. Der Verstoß gegen die guten Sitten. 4.1 Der „Gesamtcharakter“ des Rechtsgeschäfts
4.2 Der sittenwidrige Inhalt des Rechtsgeschäfts
4.3 Das objektive Unwerturteil und das Wissen um den Sittenverstoß
4.4 Der sittenwidrige Verpflichtungsvertrag und die sittenwidrige Verfügung
4.5 Der maßgebliche Zeitpunkt des Sittenverstoßes
5. Die Fallgruppen des sittenwidrigen Rechtsgeschäfts
6. Die sittenwidrige Vertragsbindung
7. Die maßlose Vertragsbindung
8. Die sittenwidrige Leistung und die Bestechlichkeit
9. Der Wucher. 9.1 Ein gesetzliches Beispiel für das sittenwidrige Rechtsgeschäft
9.2 Das auffällige Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung
9.3 Die besondere Schwäche des Opfers
9.4 Die Ausbeutung der Schwäche des Opfers
10. Das wucherähnliche Geschäft. 10.1 Das anstößige Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung
10.2 Das wucherähnliche Kreditgeschäft
10.3 Der wucherähnliche Kauf und andere Austauschverträge
11. Der sittenwidrige Geschäftszweck
12. Das standeswidrige Rechtsgeschäft
1. Eine Verfügungsbeschränkung
2. Das absolute gesetzliche „Veräußerungsverbot“
3. Das relative behördliche „Veräußerungsverbot“ 3.1 Eine Verfügungsbeschränkung zum Schutze einzelner Personen
3.2 Die Rechtsfolge der relativen Verfügungsbeschränkung
3.3 Die Verletzung des relativen „Veräußerungsverbots“ und ihre Rechtsfolge
3.4 Der Schutz des guten Glaubens
4. Das relative Erwerbsverbot
5. Keine rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkung
1. Der Willensmangel
2. Die Beweislast für den Willensmangel
1. Der geheime Vorbehalt
2. Die Scherzerklärung
3. Die Abgrenzung
1. Die Rechtsfolge des Scheingeschäfts
2. Die Voraussetzungen des Scheingeschäfts
3. Das verdeckte Rechtsgeschäft
1. Selbstbestimmung und Vertrauensschutz
2. Das gesetzliche System der Anfechtung
Bild 80: Die Anfechtung der Willenserklärung
3. Die Rechtsfolge der Anfechtung
4. Die Anfechtungserklärung. 4.1 Ein einseitiges Rechtsgeschäft
4.2 Die Begründung der Anfechtungserklärung
4.3 Die bedingte Anfechtung
4.4 Die Teilanfechtung
4.5 Der Anfechtungsberechtigte
4.6 Der Anfechtungsgegner
5. Der Anfechtungsgrund und die Kausalität
6. Der Irrtum als Anfechtungsgrund. 6.1 Die falsche Vorstellung
6.2 Der rechtserhebliche Irrtum
6.3 Der Vorrang der Auslegung vor einer Anfechtung
7. Der Erklärungsirrtum. 7.1 Der Irrtum über die Erklärungshandlung
7.2 Die Blankettfälschung
7.3 Die falsche Übermittlung der Erklärung
7.4 Die Abgrenzung der Irrtumsarten
8. Der Inhaltsirrtum. 8.1 Der Irrtum über die erklärte Rechtsfolge
8.2 Erklärte und gesetzliche Rechtsfolgen
8.3 Der Inhalt der Vertragserklärung
8.4 Der Irrtum über die gesetzlichen Rechtsfolgen
8.5 Der Identitätsirrtum
8.6 Der Kalkulationsirrtum
9. Der Motivirrtum
10. Der Eigenschaftsirrtum
11. Die arglistige Täuschung als Anfechtungsgrund. 11.1 Das gesetzliche System
11.2 Die Täuschung
11.3 Die arglistige Täuschung
11.4 Die Kausalität der arglistigen Täuschung
11.5 Die arglistige Täuschung durch einen Dritten
12. Die widerrechtliche Drohung als Anfechtungsgrund. 12.1 Die Drohung
12.2 Die widerrechtliche Drohung
12.3 Die vorsätzliche Drohung
12.4 Die Kausalität der widerrechtlichen Drohung
13. Die Anfechtungsfrist. 13.1 Eine gesetzliche Ausschlussfrist
13.2 Der verfallene Anfechtungsgrund
13.3 Beginn und Dauer der Anfechtungsfrist
14. Die Bestätigung des anfechtbaren Rechtsgeschäfts
15. Die rechtsmissbräuchliche Anfechtung
16. Der Anspruch auf Schadensersatz nach einer Irrtumsanfechtung
1. Kapitel Die Modernisierung einer altmodischen Verjährung
1. Verjährung und Ausschlussfrist
2. Verjährung und Gerechtigkeit
3. Die Methode der rechtlichen Prüfung und die Beweislast
1. Leistungsverweigerungsrecht und Verjährungseinrede des Schuldners
2. Die Erfüllbarkeit des verjährten Anspruchs
3. Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht trotz Verjährung
4. Die dingliche Sicherheit für einen verjährten Anspruch
1. Die gesetzliche Regel und ihre Ausnahmen
2. Die selbstständige Verjährung jedes Anspruchs
1. Regelfrist und Sonderfristen
2. Die Verjährungsfrist von 10 Jahren als Ausnahme
3. Die Verjährungsfrist von 30 Jahren als Ausnahme mit Gegenausnahmen
4. Die Regelverjährung von 3 Jahren
1. Das gesetzliche System
2. Der Beginn der Regelverjährung im Normalfall. 2.1 Eine komplexe Formel
2.2 Die Entstehung des Anspruchs
2.3 Das Jahresende nach Kenntnis oder grobfahrlässiger Unkenntnis
3. Die Höchstfristen für den Beginn der Regelverjährung
4. Der Beginn der anderen Verjährungsfristen
1. Das gesetzliche System
2. Die Rechtsfolge des Neubeginns der Verjährung
3. Das Anerkenntnis des Schuldners
4. Die Vollstreckungshandlung des Gläubigers
1. Die Rechtsfolge der Hemmung
2. Die Hemmung der Verjährung durch Verhandlungen
3. Die Hemmung der Verjährung durch Rechtsverfolgung. 3.1 Der gesetzliche Katalog der Hemmungsgründe
3.2 Die Rechtsverfolgung durch Klage
3.3 Das Ende der Hemmung
4. Sonstige Hemmungsgründe
5. Die Ablaufhemmung
1. Die Vertragsfreiheit
2. Vorformulierte Verjährungsabreden
3. Der Verbrauchsgüterkauf
Sachregister