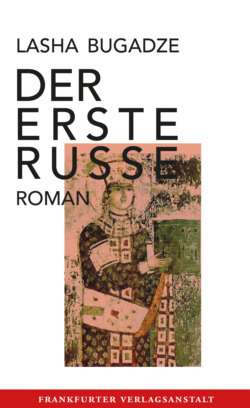Читать книгу Der erste Russe - Lasha Bugadze - Страница 7
ОглавлениеMeine Eltern gegen Georgien
Meine Eltern hatten von meiner Geburt an nicht mit Lob gegeizt, war ich doch ganze dreiundzwanzig Jahre lang – objektiv betrachtet – lobenswert gewesen. Jetzt jedoch tauchten völlig fremde Leute auf und sagten ihnen, dass dieser dreiundzwanzigjährige Mensch – objektiv betrachtet – nichts tauge und wenn er sich nicht so benähme, wie es sich gehöre, verdiene er nicht einmal die Bezeichnung »verlorener Sohn«.
»Heutzutage werden Menschen ja so leicht umgebracht …«
Auch das bekam mein Vater zu hören. Noch dazu an einem Ort, an dem normalerweise, wenn auch nur anstandshalber, über Tugend gesprochen werden sollte: neben dem Ruhezimmer des orthodoxen Patriarchen.
»Es ist deine Schuld«, sollte der Patriarch später zu meinem Vater sagen, »du hast das Kind nicht ordentlich erzogen.«
Dabei war ich in den Augen meiner Eltern (also auch in denen meines über die Bemerkung des Patriarchen zutiefst verletzten Vaters) – objektiv betrachtet – ein liebes, kluges, gutes, zweifellos ordentliches und begabtes dreiundzwanzigjähriges Kind, ungewöhnlich, schon als Junge allen bekannt als Schriftsteller und somit ein berühmter Jugendlicher, knapp zehn Jahre älter als das junge Land Georgien, ein Kind, dem eigentlich niemand etwas hätte vorwerfen können.
Das Kind meiner Eltern war nicht durch die 90er-Jahre gebrandmarkt: Es streifte nicht zusammen mit den nach Blut dürstenden Kindern der 90er durch die Straßen, sondern schrieb, malte oder sprach (was es seiner Großmutter zufolge schon mit acht Monaten konnte), war ein Karikaturist, konnte jeden beliebigen Menschen parodieren (ohne Rücksicht auf dessen Alter, Geschlecht und Gefühle), sang Opernarien, war in der frühen Kindheit dick (wodurch es nur noch vertrauenswürdiger und sympathischer erschien). Es war begabt, und sein Vater hätte – wenn er die Gelegenheit bekommen hätte oder vielmehr, wenn er sich die Freiheit genommen hätte – jedem, der an seinen Erziehungsmethoden etwas auszusetzen hatte, mit Vergnügen die positiven Eigenschaften des Kindes aufzählen können. Er hätte beispielsweise erzählt, dass es »mit elf Jahren, Eure Heiligkeit, jawohl, mit elf, Hochwürden, mit den Nachbarsmädchen (mit den Mädchen deshalb, weil niemand anderes mitmachen wollte) nichts Geringeres als Goethes ›Faust‹ aufgeführt hat! Versteht Ihr? Mit elf Jahren den ›Faust‹! Bloß eben im Garten, und er selbst spielte Mephisto, den Teufel, Eure Heiligkeit (Entschuldigung, dass ich hier einen der Namen des Teufels erwähnen muss), aber er spielte einen dicken und süßen Mephisto, weil er selbst sehr süß war, sogar beim Darstellen des Teufels, Eure Heiligkeit, wenn er Fausts Geliebter Serenaden vorsang. Übrigens gibt es als Beweis sogar Videoaufnahmen von der Veranstaltung: Es war 1989, Juni, im Hof des Hauses meiner Exfrau, der Mutter meines Kindes, und das Kind rezitiert mit elf Jahren die Texte des Mephisto; ein Scheidungskind, Eure Heiligkeit, aber trotzdem stets mit Aufmerksamkeit bedacht, besonders von den Großmüttern! Es ist ein von den Großmüttern aufgezogenes Kind, die ihm nie etwas Schlechtes und Wertloses beigebracht haben, wie Ihnen unbedacht herausgerutscht ist. Daher ist das etwas anderes – ich bitte um Entschuldigung, es geht hier um ein besonderes Kind. Den Kameramann habe ich, sein Vater, dazugeholt, weil ich merkte, dass da etwas Ungewöhnliches vor sich ging, jawohl, es ist ungewöhnlich, wenn ein elfjähriges Kind ein Theaterstück über eine Abmachung zwischen Gott und dem Teufel aufführt, noch dazu nur mit Unterstützung der Nachbarsmädchen, wenn er mit der Bedeutungsschwere des mit dem Teufel geschlossenen Paktes den ganzen Hof zusammentrommelt, einen von der Tante genähten Frack trägt und uns über die Bedeutung der Seelenrettung aufklärt: Wen sollen wir nicht ordentlich erzogen haben?«
»Schon von Kindesbeinen an ging er auf antisowjetische Treffen«, würden die Großmütter sagen, wenn man sie fragen würde, und eine, die sentimentalste und emotionalste von ihnen, würde sehr entschlossen die Kirchenvertreter angreifen, die das Verhalten des Enkels nun kritisierten: »Mein Enkel war ein durch und durch einzigartiges Kind, sittsam und ordentlich; während andere Kinder schon am ersten Tag ihr Spielzeug kaputt machen (manche können es ja kaum erwarten, dem Teddy oder der Giraffe den Bauch aufzuschlitzen), führte mein Enkel Tetralogien auf, mit den Teddys oder Giraffen, die es in den leer gefegten Spielzeugläden der Sowjetunion nicht zu kaufen gab und die der eine oder andere aus Ländern des sozialistischen Lagers besorgt hatte. Wo andere übermütig wurden und deren arme Eltern schon nicht mehr wussten, womit sie das Kind überschütten könnten, beschäftigte sich dieses Kind von Anfang an mit sich selbst: Es legte sich ein Zeichenbrett auf die Knie, ein Blatt Papier darauf und malte die kompliziertesten Karikaturen, da staunten die Leute! Allein wie seine Gemälde entstanden – bei Menschen (meistens malte er Politiker) begann er mit den Schuhabsätzen und füllte dermaßen schnell und gewitzt das Blatt, dass selbst berühmte Maler verblüfft gewesen wären. Einmal brachte er eine Lehrerin in Schwierigkeiten, vor deren Strenge die ganze Schule zitterte: Die Frau lehrte Deutsch, und als sie anfing, den Kindern irgendeinen Unsinn zu erzählen und die Nibelungen erwähnte, nannte mein neunjähriger Enkel sofort Siegfried, seinen Lieblingshelden, und noch viele andere, von denen die Deutschlehrerin noch nicht einmal gehört hatte. Als er noch ganz klein und noch nicht dick war, nahm ihn der Vater auf die Schultern, und sie hörten zusammen die alten, unter der Nadelberührung kratzenden, aber trotzdem dröhnenden (für mich ein bisschen zu pompösen) Wagner-Schallplatten, das Kind tanzte dem Vater im wahrsten Sinne des Wortes auf der Nase herum! Vater und Sohn waren nicht eine Minute getrennt! Bevor der Sohn selbst lesen konnte, lasen wir ihm Bücher vor, und später ließ er sich den Lesestoff kaum entreißen; er las nicht nur brav Seite für Seite, um zur Belohnung in den Hof gehen zu dürfen (wie die anderen Kinder das taten), und niemand brauchte sich darüber den Kopf zu zerbrechen, womit man ihn beschäftigen könnte. Hatte er sich als Neunjähriger noch einen Welpen gewünscht, kaufte er sich nun auf Kosten meiner Rente zu seinem elften Geburtstag Mozarts Flötenkonzert. Er war ein intellektuelles Kind, aber weder verschlossen noch melancholisch oder boshaft, sondern offen, humorvoll und schon als Kind unterhaltsam. Wir können uns an große Festtafeln erinnern, da saßen viele Leute am Tisch, und dieses Kind, das damit beschäftigt war, andere zu erfreuen, sprach mal mit der von Medikamenten abgestumpften Stimme Leonid Breschnews, mal mit der Stimme Eduard Schewardnadses, den wir alle zu jener Zeit für einen Vaterlandsverräter hielten. Der Vater hatte Verständnis für den Jungen, denn er war wie geschaffen für die Kunst, aber seine Mutter verstand ihn nicht und gab ihn, um den Mann in ihm zu wecken, erst in die Obhut von Skiläufern und Rugbyspielern, dann von Wasserballern, doch das Kind fand keinen Zugang zur kumpelhaften Grobheit der Trainer, denn derartige Ungezogenheit und ungehobeltes Benehmen waren für meinen Enkel noch nie erstrebenswert, und wenn jemand denkt, er habe jemanden beleidigen oder kränken wollen, da irrt derjenige sich gewaltig: Keiner kann behaupten, dieses Kind habe im Laufe seiner dreiundzwanzig Lebensjahre jemals irgendjemanden beleidigt. Das ist eine Ungerechtigkeit!«
Wer weiß, wie viel sie ihnen noch erzählen wollen würde, den Leuten, die uns beim Patriarchen Tbilissis in jenem Raum mit der vergilbten Tapete eingeschlossen hatten und mich mit vorgefertigten Dokumenten mit der Androhung des Kirchenausschlusses oder dem Angebot, als verlorener Sohn zurückzukehren, einschüchtern wollten.
An jenem Tag aber vernahm leider niemand jene Argumente, die meine Vortrefflichkeit bestätigt hätten, die nicht gesprochenen Worte der verzweifelten Großmütter gingen in den Drohungen des Patriarchats unter.
Das Wort »Sünde« war in aller Munde.
Sündenliste. Der Weg der heiligen Nino
Ende der 80er war ich – objektiv betrachtet – frei von Sünde.
Meine Mutter, die versuchte, mich zu körperlicher Aktivität zu mobilisieren (mit Rugby und Skifahren hatte sie bei mir keinen Erfolg gehabt – ich ging hauptsächlich zu den Sitzungen der in der Klasse gegründeten »Nationalen Freiheitspartei« oder widmete mich dem Fernsehen, das während Gorbatschows »Reformen« wiederbelebt worden war), machte mit mir ein eigenartiges, sportlich-religiöses Experiment: Sie schickte mich für drei Tage auf den »Weg der heiligen Nino«, unter Aufsicht meiner vierzehn Jahre älteren Tante.
Einer neuen Tradition folgend, die der Katholikos, Georgiens Patriarch, unter den Reformbedingungen eingeführt hatte, sollten die Leute, sollte die ganze neue Kirchgemeinde, jenen Weg gehen, den die christliche Missionarin der Georgier, die heilige Nino, im vierten Jahrhundert gegangen sein soll, vom Parawani-See in die alte Hauptstadt Mzcheta.
Das war eine große Strecke, ein großes Spektakel und ein großes Abenteuer, das mir weder gefiel noch mich reizte, aber damals hatte ich offenbar noch keine Ambitionen, mich gegen meine Mutter aufzulehnen, und konnte mich daher der dreitägigen Expedition nicht entziehen, zumal sie mich bat, diesen Gang auf dem Weg der heiligen Nino als kulturell-erkenntnisbringenden Spaziergang anzusehen und keinesfalls als sportlich-religiösen (weil ich das Wort »Sport« hasste). Sie belog mich und gaukelte mir vor, ich müsste nicht viel wandern (dabei war das Wandern der eigentliche Sinn der Sache), und falls ich dennoch viel wandern müsste (die Großmütter ereiferten sich, das Kind habe Plattfüße, ihm würden die Füße wehtun), würden sie mich mit dem Auto des Beichtvaters meiner Tante zurückholen (»der Beichtvater meiner Tante« – diese Worte wirkten therapeutisch auf mich). Meine Mutter erwähnte meinen Mitschüler (kein Mitglied unserer schulischen »Nationalen Freiheitspartei«, aber dennoch ein Klassenkamerad), der von seinem mit »Sünden beladenen« Vater auf den Weg der heiligen Nino mitgenommen worden war.
Aber es kam zur Katastrophe: Die Tante wandelte schon eine Woche lang auf dem Pfad, welchen die Heilige, zu der damaligen Zeit zwei Jahre älter als sie, gegangen war. Sie hatte sich unterwegs in Dorfschulen, Flüssen und Seen gewaschen (manchmal mit dem Wunsch oder Vorwand, sich erneut taufen zu lassen), aber dann hatte sie doch die Lust auf die heimische Dusche überkommen, sie hatte sich höflich bei ihrem Priester den Segen dafür geholt und war just in dem Moment nach Hause aufgebrochen, als ich mich – mich auf sie verlassend – zu ihr auf den Weg gemacht hatte.
Ich kam also an und kriegte zu hören: »Deine Tante ist fort. Hier ist nur die Kirchgemeinde.«
Ich war unter fremden Leuten und Geistlichen.
Natürlich weinte ich. Für meine elf Jahre unverhältnismäßig viel, und ich flehte den an, der mich hergebracht hatte (ebenjenen sündenbeladenen Vater meines Mitschülers), das Auto, mit dem wir gekommen waren, solle mich wieder mitnehmen, wenn es zurückführe. Es stellte sich aber heraus, dass dieses Auto (mitsamt seinem Fahrer) kein gewöhnliches Auto war, vielmehr musste es selbst eine Strecke auf dem Weg der heiligen Nino zurücklegen und würde erst dann zurückfahren (falls es den Segen bekäme, mit mir), wenn es mindestens um die zweihundert Kilometer zusammen mit den Betenden zurückgelegt hätte.
Aber wie sollte ich nun diese zweihundert Kilometer überleben und hinter mich bringen?
Das Angenehme war, dass alle mich beruhigten, auch mein Klassenkamerad, der mir unerwarteterweise gleich mitgeteilt hatte, er faste schon seit einem Monat und sei – was die Hauptsache war – noch nicht einmal in die Versuchung gekommen zu masturbieren.
Ich hatte sowieso nicht vermutet, dass er das überhaupt machte, denn ich selbst war in dieser Hinsicht vollkommen frei von Sünde. Wir waren elf, zwölf und ich hatte leichte Zweifel: War bei ihm etwa schon die Pubertät ausgebrochen? Weil ich zeichnen konnte, hatten mich meine Klassenkameraden manchmal gebeten, ich solle »Sex malen«, aber wie hätte ich denn etwas malen sollen, was ich nicht kannte? Ich versuchte es ein paarmal, aber alle bemängelten die Unglaubwürdigkeit meiner Bilder.
Jedenfalls stellte sich heraus, dass mein Klassenkamerad schon seine erste Beichte abgelegt und dem Geistlichen von seiner Hauptsünde erzählt hatte. Er hatte doch nicht etwa gelogen?
Über mangelnde Fürsorge konnte ich mich zumindest nicht beklagen – es schienen alle auf meiner Seite zu sein. Ich aß Fladenbrot, Käse und Tomaten, zeichnete Karikaturen, die mir beruhigende Aufmerksamkeit verschafften, und lauschte den fürsorglichen und rührenden Worten Vater Dawits, des Oberpriesters, was sich therapeutisch auf mein Selbstwertgefühl auswirkte. Ich war froh, dass dieser Mann, der hier die oberste Autorität darstellte, ausgesprochen viel Anteilnahme daran zeigte, dass meine Tante und ich uns so katastrophal verpasst hatten.
Er machte mir Mut genug, dass ich auf die Idee kam, im leeren, akustisch reizvollen Lehrerzimmer der Dorfschule, die von den Pilgern provisorisch als Nachtlager genutzt wurde, so etwas wie eine Arie zu singen (aus dem kürzlich im Hof aufgeführten »Faust«). Ich fühlte mich in dieser Umgebung schließlich sicher und überwand die Angst vor der Fremde, aber dass dies kein passender Ort für Unterhaltung war, darauf wies mich sofort ein junger rothaariger, unrasierter und pausbäckiger junger Mann hin (Vikarsanwärter nennt man solche Leute), indem er die Tür des Lehrerzimmers öffnete, mich aus trüben Augen anblickte und mit einer spröden, brüchigen Stimme einen Verweis aussprach, als wäre er gerade aufgewacht oder hätte lange nicht gesprochen: »Hier wird nicht gesungen, die Leute beten.«
Der rothaarige Mann (oder eher Junge, denn wie ein Erwachsener sah er nicht aus) hatte dunkle Augenringe, und man sah ihm an, dass er im Falle von Widerworten zu strengeren Ermahnungen fähig wäre. Genau wegen solchen »Fremden« wollte ich nicht bleiben. Scheinbar zurückhaltende, aber aggressive Unbekannte, die mich nicht zur Ruhe kommen ließen.
Natürlich verstummte ich sofort. Der Rothaarige schloss die Tür.
Jetzt war ich wieder unerträglich einsam und schutzlos und wollte deshalb nicht mehr im Lehrerzimmer bleiben, ich öffnete die Tür und ging auf den Flur. Überall lagen Rucksäcke herum. An der Wand lehnten, die Schuhe ausgezogen, in sich selbst versunkene oder einfach nur müde Leute.
Unweit der Schule standen Hütten, die Dorffrauen saßen an den Zäunen und schauten mit einem Lächeln, das Unbehagen ausdrückt, zu dem Priester, der neben einem verrosteten Fußballtorpfosten hockte. Der arrogante Tonfall des Priesters schien den Provinzialismus der Frauen zu unterstreichen, salopp, aber gleichzeitig von oben herab machte er ihnen Vorwürfe: »Nun, wie oft habt ihr wohl eine Abtreibung machen lassen, habt ihr mitgezählt? Zwanzigmal? Vierzigmal?«
Ich wusste schon, was dieses Wort bedeutete, und hielt am Pfosten inne.
»Was gibt es da zu lachen? Ich frage euch ernsthaft!«
Es war noch zur Zeit der Sowjetunion, die Dorffrauen wussten noch nicht, dass Priester solche Fragen zu stellen pflegten. Sie fürchteten sich noch nicht vor deren Gott, hielten sich die schwieligen Finger vor die zahnlosen oder goldzahnbestückten Münder und lachten: »Was der Irre uns für Sachen fragt!«
Der Priester war für sie ein Verrückter.
Aber auch der Priester lächelte – er sprach mit Dorffrauen und wusste, dass er es mit der ungebildeten Sowjetmasse zu tun hatte, noch dazu in der Provinz, in einem meßchischen Dorf; ein Priester zählte zur Elite. So sah er sich selbst, besonders ihnen gegenüber.
»Ihr denkt, Abtreibung ist kein Mord? Marx und Engels können euch dann nicht helfen. Nun, welche von euch ist kirchlich getraut worden? Wer nur standesamtlich getraut ist, wird nicht als Ehefrau gelten, wisst ihr das nicht? So bleibt der Beischlaf sündhaft. Was, ihr glaubt, ich denke mir das aus? Was lacht ihr? Du da, hast du einen Mann?«, fragte er eine von ihnen. Die Frau lachte, winkte ab: »Mensch, lass mich doch in Ruhe.«
»Sag, hast du einen oder nicht?«
»Hat sie, hat sie!«, antworteten die anderen. »Sie hat zwei große Söhne.«
»Hat sie kirchlich geheiratet? Wenn man nicht kirchlich getraut worden ist, dann ist es Hurerei und Schluss. Ich traue dich, wenn du’s noch nicht bist.«
Die Frauen antworteten nicht mehr.
Schon zum zweiten Mal seit meiner Ankunft wurde ich Zeuge einer Geschlechterdiskussion: Erstens hatte mich mein Klassenkamerad wissen lassen, dass er einen Monat »nichts Schlechtes« getan hatte, nun sagte dieser Priester den Dorffrauen, sie seien Sünderinnen, weil sie Kinder geboren hatten, ohne kirchlich getraut worden zu sein. Mir war nicht klar, wer über wen lachte – die Frauen über den Priester oder der Priester über die Frauen?
»Das ist euch doch klar, oder?« Der Priester schaute in meine Richtung und dachte wahrscheinlich, er hätte viel Publikum, aber weil er außer mir niemanden sah, sagte er nur: »Wie soll man diese Leute nur aufklären, wohin soll das noch führen?« Und den Frauen rief er noch nach: »Glaubt ihr wenigstens an Gott?«
Seine Frage wurde vom Wind fortgetragen.
Der Priester stand seufzend auf, obwohl er eigentlich zu jung zum Seufzen war.
Mein Klassenkamerad, sein sündenbeladener Vater und ich übernachteten nicht in der Dorfschule, sondern in einem Bauernhaus, in dem für Gäste vorgesehenen, besonders gepflegten ersten Stock.
Nahezu alle Häuser in georgischen Dörfern haben einen solchen besonderen ersten Stock: Die Bauern selbst schlafen unten in einem kellerlochartigen Halbgeschoss, doch jeder fühlt sich verpflichtet, den ersten Stock möglichst wie einen Schlosssaal auszustatten. Unabdingbare Bestandteile dieses ersten Stocks sind ein muffiger Geruch, ein hohes Bett mit durchgelegenen dicken Matratzen und Schlummerrolle, ein glänzendes Klavier (mit Puppen darauf), auf dem niemand jemals spielt, ein ausziehbarer Tisch und Schwarz-Weiß-Fotos von den toten Eltern (oder Großeltern) an der Wand. Die Toten schauen üblicherweise vorwurfsvoll und finster von der Wand auf einen herab: Denen gefällt es nicht, wenn sich jemand auch nur für einen Tag im ersten Stock einquartiert.
In diesem Haus übernachtete auch mein Beschützer, der Oberpriester Vater Dawit; wenn er zum Abort auf dem Hof ging, übergab er mir ein an einer dicken Kette hängendes Kreuz und nahm es erst zurück, wenn er danach die vom Wasser nassen Hände am Bart abgewischt hatte.
»Sorgst du dich?«, fragte er, wartete jedoch meine Antwort nicht ab, sondern fuhr fort: »Wir passen auf dich auf, keine Angst, du gehst nicht verloren.«
Ich sagte nichts, obwohl ich mir sehr wünschte, sie würden mir ein Auto organisieren und mich zurückbringen, nach Hause. Gut, dass ich nichts sagte, denn Vater Dawit teilte mir plötzlich eine wichtige Neuigkeit mit: »Morgen ist dein großer Tag, du sollst das Kreuz tragen und unserer Kirchgemeinde vorangehen.«
Ich sollte das Kreuz tragen?
Vater Dawit führte nicht näher aus, was er meinte, er ging zum Halbgeschoss, wo ihn ein Mädchenchor freudig erwartete.
»Vielleicht stellt er dich ganz vorn hin«, erklärte mir mein Klassenkamerad, »an die Spitze.«
Und tatsächlich, als sich die Menschen in Zehnergruppen zum Abmarsch bereit machten, überreichte mir Vater Dawit das ziemlich große hölzerne Andreaskreuz und sagte, ich solle langsamen Schrittes vorangehen.
»So wie du gehst, gehen auch wir«, sagte er.
Anscheinend gab es den Brauch, dass Kinder nach vorn gestellt wurden, auch wenn meine Mutter und meine Tante Vater Dawits Verhalten im Nachhinein mit seiner Beobachtungsgabe und seinen kinderpsychologischen Kenntnissen erklärten: Hätte er mich wie die anderen behandelt, hätte ich mich gelangweilt oder wäre müde geworden, so aber überwog die Begeisterung über die Verantwortung für das Kreuz.
Wie dem auch sei, mein Klassenkamerad hatte sich einen Monat lang zusammengerissen und keine Hand angelegt, und nun latschte er irgendwo hinten in der Masse mit, während mir die Ehre des Vorangehens zuteilwurde.
Es war unglaublich, aber mir folgten so viele Leute (den Weg wiesen mir natürlich die Priester, unter ihnen auch jener, der gestern die Dorffrauen belehren wollte), sogar der rothaarige Priesteranwärter, der mich im Lehrerzimmer wegen des Singens gerügt hatte. Nur wurde das Kreuz mit der Zeit ein bisschen schwer, und der Mönch hinter mir ermahnte mich ständig: »Halte es hoch, Junge, hoch. Dass es jeder sehen kann.« Ich begriff, dass Karikaturenzeichnen und lautes Singen völlig überflüssig gewesen waren, ich konnte anderweitig Aufmerksamkeit auf mich ziehen: Ich hatte das größte Kreuz und dachte, meine Eltern würden verblüfft sein, wenn sie davon erführen.
Das Kind trägt das Kreuz!
Den ganzen Weg hatte ich diese Vorstellung im Kopf, wie begeistert man in der Schule von meinem Auftritt sein würde, was die Mädchen aus der Klasse sagen würden, wie meiner superstrengen Deutschlehrerin der Mund offen stehen bliebe: »Wie, der hat mit dem Kreuz in der Hand das Heer der Gläubigen angeführt?!« Mit welchem Jubel mich die Leute in den nächstgelegenen Siedlungen, sagen wir, in Bordschomi, empfangen, wie mich unsere Führer der Nationalbewegung loben würden – Swiad Gamsachurdia und Merab Kostawa! Sicher hätte mich jener überhebliche Priester, der die Dorffrauen wegen der Abtreibungen beschämt hatte, aufgrund meiner hochmütigen Gedanken gescholten, aber eine Weile träumte ich davon, wie er zum Beispiel auf einer Demonstration einem als Nationalhelden geltenden Dissidenten bekannt gab, wir trügen jetzt aufs Neue das Christentum nach Georgien. »Schauen Sie sich diesen Jungen mit dem Kreuz an!« Ich stellte mir vor, welche Ovationen seiner lauten Verkündung folgen würden. Wir würden uns mit der Demonstration zusammenschließen, ich würde an in Decken eingewickelten Hungerstreikenden vorbei die Stufen emporsteigen und mich mit meinem Kreuz neben die Fahnenträger stellen, meinen Blick über den Pöbel nach hinten zu den Mädchen aus meiner Klasse schweifen lassen, die verliebt von unten zu mir aufschauen würden. Ganz besonders die eine, die ich stumm fragen würde: »Bestimmt bereust du jetzt, dass du mich nicht zum Geburtstag eingeladen hast, stimmt’s?«
Unterwegs tauften die Priester Leute im Mtkwari. In einem der Dörfer, schon kurz vor Bordschomi, hatten Mitglieder unserer Kirchgemeinde eine Diskussion mit irgendeinem bedeutenden Intellektuellen, und es fehlte nicht viel und ein beflissener Oberpriester hätte ihn geschnappt und mit Gewalt zum Fluss geschleppt. Der Heide stellte sich als Physiker heraus, der zusammen mit Frau und Kind in der Nähe von Bordschomi Urlaub machte. Mit ein wenig eigenartigem und blödem Trotz rief er, dass selbst wenn er an die Existenz von Göttern glauben würde, dann nur an die von altgeorgischen, und er behauptete allen Ernstes, das Bekenntnis zum Dali[1]-Kult sei wesentlich wichtiger für das Selbstverständnis der Georgier als der orthodoxe Glaube: »Gerade erwacht der Nationalismus in uns, und deshalb brauchen wir auch einen nationalen Glauben, das ist besser für unser Land!«
Der Heide trug eine Brille mit dicken Gläsern (so eine, die jeder Durchschnittsphysiker Ende der Sowjet-80er hatte) und ein abgetragenes weißes Hemd, unter dem ein lumpiges ärmelloses Unterhemd zu erkennen war. Neben ihm stand eine junge Frau, die Ehefrau, ein zwei- bis dreijähriges Kind auf dem Arm, die verängstigt den skandalösen, patriotischen Ausführungen ihres heidnischen Gatten lauschte. Die Frau merkte, dass ihr Mann möglicherweise bald Prügel beziehen würde.
»Wodurch sollte sich ein Georgier in der heutigen Welt von anderen Nationen abheben? Nur durch die Sprache? Die Schrift? Seine Traditionen?«, fragte der Heide den Oberpriester, der die Diskussion mit ihm vom Zaun gebrochen hatte. »Das reicht nicht. Die Georgier sollten ein vorzeigbares Pantheon der Götter haben, wie wir es schon mal hatten. Natürlich sollte es die Orthodoxie geben, aber warum nicht auch einen Dali-Tempel? Was ist falsch an Armasi[2] – und am Armasi-Kult?«
Der Heide spielte mit dem Feuer: Er diskutierte über den Armasi-Kult mit den Leuten, die einen Monat lang dem Weg jener Heiligen folgten, die ebendiesen Kult zerschlagen hatte.
»Er ist besessen«, sagte jemand.
»Das waren Götzen, sollen die Georgier etwa Satan preisen und ihrer eigenen Religion abschwören?«, schrie ihn der Oberpriester an.
»Man sollte preisen, wen man will, und Religionsfreiheit haben: Man kann in die Kirche gehen oder in die Armasi-Tempel. Für die Welt wäre das interessant zu sehen, sie würden sagen: Wie seltsam, diese historische Nation scheint einen eigenen alten Glauben zu haben.«
»Ist das Christentum etwa nicht alt?« Der Oberpriester ließ nicht locker.
»Lass ihn doch, der ist besessen«, sagten andere.
»Christen sind wir erst seit dem vierten Jahrhundert – genauer gesagt, ihr seid es.« Der Heide brachte den Oberpriester absichtlich zur Weißglut und maßregelte gleichzeitig seine Frau: »Warte, lass mich mit diesen Leuten reden, geht ihr schon mal heim, legt euch schlafen. Schaut mal, wie lange schon halten uns die Ausländer für Russen, fast zwei Jahrhunderte. Und viele wissen bis heute nicht, dass wir eine völlig andere Nation sind … Wir und Russen! Auch die Sprache ist eine andere, die Schrift und die Kultur, kann dann nicht auch die Religion eine andere sein? Warum sollten wir Orthodoxe sein oder Katholiken, wenn wir den Amirani haben!«
»Ich werde dem eine Tracht Prügel verpassen«, murmelte ein Mann neben dem Oberpriester, die Frau fasste ihren Heiden bei der Hand und zog ihn wie ein kleines Kind in Richtung eines heruntergekommenen Landhauses, dabei fing das Kind an zu weinen, aber auch der Oberpriester gab auf, obwohl die Taufe seiner Meinung nach der Kulminationspunkt der Diskussion gewesen wäre.
Der heidnische Physiker war die Ausnahme, denn es wurden alle getauft, denen wir unterwegs begegneten, und deren Familienmitglieder gleich mit – meistens Kinder, Enkelkinder und wegen der Sowjetzeit ungetauft gebliebene Großeltern. Unser pflichtbewusster Oberpriester sagte: »Früher tauften die Eltern ihre Kinder, jetzt taufen die Kinder ihre Eltern.«
In Bordschomi sahen wir uns Tausenden Heiden gegenüber: Schullehrer, ehemalige Parteisekretäre, ehemalige Parteifunktionäre, ehemalige und immer noch aktive Oktoberrevolutionäre, Pioniere, Veteranen des Zweiten Weltkriegs, Helden der Arbeit, Dorfintelligenzler, Chauffeure und Ärzte …
Sie ließen sich zu zehnt, ja zu Hunderten taufen. Sei es ein Bach, Wasserfall, Kanal oder Fluss, überall standen halb nackte Leute Schlange. Die Frauen gingen im Kleid ins Wasser, die Männer zogen sich ab der Taille aufwärts aus, krempelten die Hosenbeine hoch oder entkleideten sich komplett. Die Priester gingen bis zur Gürtellinie ins Wasser und tunkten (das Wort – tunken – mochten alle) die umstehenden Männer, Frauen und Kinder ohne Umschweife, gekonnt, eilig und irgendwie unfeierlich unter. Sie standen mit durchnässten, beschwerten Soutanen mitten im Wasser und wiederholten freudig, würdevoll und seufzend ein und dieselben Worte: »Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, amen!« Für viele war es noch ungewohnt, sich zu bekreuzigen, sie schienen sich unbehaglich zu fühlen, wussten nicht, wohin mit ihren Händen, hielten sie mal hoch oder legten sie auf die Brust und warteten geduldig, bis sie an der Reihe waren.
Ein allgemeiner Enthusiasmus griff um sich, in den Menschen erwachte ein neuartiger Instinkt. Es war, als wenn sie Teil von etwas Bedeutendem und Besserem würden.
Die alten Frauen und Männer näherten sich jetzt schüchtern lächelnd den im Wasser stehenden starken Riesen mit den nassen Haaren und Bärten (als Täufer brauchte man offenbar eine Menge Kraft), die ihnen neue Bedeutsamkeit schenken sollten. Manche hielten die Taufe sogar für einen Teil von Gorbatschows Reformen und vermuteten, wer sich dem allgemeinen Enthusiasmus nicht anschließe, würde es im weiteren Leben schwer haben. Wer fürchtete, in der Minderheit zu sein, wollte jetzt auf der Seite der Mehrheit stehen, wo sich wiederum die wiederfanden, die jahrzehntelang gerade wegen ihrer Zugehörigkeit zur Kirche unterdrückt worden waren.
Es gab Leute, die ließen sich vier-, ja fünfmal taufen. Sie liefen mutig ins Wasser und baten die gleichen Priester um ein neuerliches Untertunken. Sie gingen in Gruppen, mit der Familie, ihren nackten Kindern, gebrechlichen Rentnern und auch skeptischen Familienmitgliedern (meist Ehemänner, die von ihren Frauen genötigt worden waren). Selbst wenn einer nur mitgekommen war, um der Taufe eines Verwandten zuzusehen, wurde er nicht dem Heidentum überlassen – sein Kopf wurde garantiert ebenso untergetaucht.
In Mzcheta, in der Nähe von Swetizchoweli, fielen am allgemeinen Tauftag so viele Leute über den Mtkwari-Fluss und den Aragwi-Fluss her, dass im Wasser kein Platz mehr zum Stehen war.
Zum Taufen hatte man auch meinen Großvater mitgenommen, ein extrem passives Mitglied der Kommunistischen Partei und Direktor des wissenschaftlich-technischen Büros des Instituts für Arbeitsschutz, der noch einige Nachbarn mitbrachte. Sie ließen sich gemeinsam in den Fluten des Aragwi taufen.
Von meiner Taufe wusste ich nur aus Erzählungen, denn damals war ich noch kein Jahr alt, und mir hätte auch keiner davon erzählt, hätte nicht der Bart meines jungen Paten Feuer gefangen. Er war Maler, genauso wie mein Vater, und ein aufmüpfiger Student. Er war von der Kunstakademie geflogen, weil er in der Sioni-Kathedrale Messdiener gewesen war, und unheimlich erschrocken über den kleinen Brand (vielleicht dachte er, es seien vom Heiligen Geist gesandte Feuerzungen). Es war der Mann, der sechs Jahre nach meiner Taufe versuchte, ein Tu-134-Flugzeug aus der Sowjetunion zu entführen, und dabei unter ungeklärten Umständen tödlich verletzt wurde.
Jetzt jedoch, immer noch in der Nähe von Bordschomi, dort, wo der Mtkwari-Fluss flacher wurde und sich die Prozessionsteilnehmer zum zweiten, fünften oder zehnten Mal taufen ließen, fand auch ich mich unerwartet im Wasser wieder. »Komm herein, komm tiefer herein«, sagte der nasse, pflichtbewusste Priester, ein Hüne mit zerzaustem Bart- und Kopfhaar. Ich, Enkel meiner Großmütter und ein anspruchsvolles und skeptisches Kind, ging sogar bis zur Hüfte hinein. Der Priester fackelte nicht lange, sobald ich bei ihm war, legte er die Hand auf meinen Kopf und drückte mich fast schon grob und beängstigend unter Wasser. Er tauchte mich, wartete einen Moment, sagte etwas (dasselbe, was er immer sagte), zog mich wieder hoch, tunkte mich noch tiefer und ließ mich noch ein bisschen länger unter Wasser; so lange, dass ich genug Zeit hatte, mich zu fürchten, und so kräftig, dass jeglicher Widerstand zwecklos war. Ich hatte ein seltsames Gefühl: Es war, als verlöre ich unter Wasser das Bewusstsein, für eine Sekunde, anderthalb Sekunden, und erst als ich wieder hochgezogen wurde, kehrte ich als höfliches, ruhiges Kind zum Ritual zurück. Diese neuerliche Taufe blieb mir in Erinnerung, weil ich schon groß war und kein einjähriges Kind wie bei meiner ersten Taufe 1977.
An ebenjenem Ufer des mit taufwilligen Leuten gefüllten Mtkwari stieß meine von meiner Pilgerreise und meinem Heldentum begeisterte Mutter zu uns, ebenso meine Tante und meine über deren Verantwortungslosigkeit verärgerte Großmutter (insgesamt war ich vierzig Kilometer mit dem Kreuz in der Hand gelaufen).
Da ich aber das Kreuz nicht aufgeben wollte, jedoch auch nicht mehr laufen konnte (»Das Kind hat Plattfüße, wollt ihr, dass es unterwegs zusammenbricht?«, hatte meine Großmutter verärgert gerufen), einigten wir uns letzten Endes auf einen Kompromiss: Vater Dawit erteilte mir großzügig die Erlaubnis, das Kreuz ein paar Tage später beim Einzug der Gläubigen in Mzcheta zu tragen, ich solle bis dahin nach Hause zurückkehren und darüber nachsinnen, welchen Weg ich zurückgelegt hatte.
Niemand strahlte in diesem Augenblick mehr Autorität für mich aus als dieser Mann.
Meine Mutter hatte sich zwar wirklich Sorgen gemacht, war aber trotzdem zufrieden mit ihrem Erfolg: Ich hatte für einige Tage nicht ferngesehen, war noch einmal getauft worden, hatte keine Angst gehabt, mit Kleidern ins Wasser zu gehen, hatte mich ein bisschen verändert (dachte sie zumindest) und ein teilweise sportliches, teilweise naturnahes (also männliches) Leben geführt.
»Wieder vorn zu gehen wäre wohl ein bisschen vermessen«, sagte sie, »lass uns einfach nach Mzcheta aufbrechen und ihrem Einzug zuschauen.«
Komisch, aber irgendwie wollte ich gar nicht mehr weg; in den anderthalb Tagen hatte ich mich an den Rhythmus und die Abläufe der langen Prozession gewöhnt, an die Taufen unterwegs, die Diskussionen, das Wohlwollen und die Begeisterung, die uns in den Dörfern entgegenschlugen, und, was die Hauptsache war, an das Gefühl der eigenen Wichtigkeit, mit dem ich nach Achaldaba kam. Ich hatte etwas erlebt, das mich zumindest ein wenig von meinem vorgestrigen Ich unterschied. Meine Tante und ich tauschten wieder – ich kehrte nach Hause zurück, sie zum Prozessionszug. Genauer gesagt, kehrte ich weniger nach Hause zurück als vielmehr zu jener Welt, die ich vor anderthalb Tagen verlassen hatte – zu denselben Stimmen, die der unter den Reformen wiederbelebte Fernseher von sich gab, demselben Geruch, der während des Sommers in den Wohnungen hängt. Drei Tage später, bevor ich darüber meine Reise vergessen konnte, folgte ich den (für unsere Familie typisch) enthusiastischen Frauen nach Mzcheta, wo die Prozession auf dem Weg der heiligen Nino im Hof des Nonnenklosters Samtawro enden sollte.
Der Mann, dessen Foto heutzutage religiöse Kalender, kirchliche Infostände und gläserne Spendenbüchsen von Klöstern oder verschiedenen Stiftungen in Supermärkten ziert, wohnte damals in einer Turmzelle neben Samtawro und verströmte Fischgeruch. Zumindest glaubte ich, dass es Fischgeruch war, weil er zwar kein Fleisch aß, aber Fisch liebte, in Wirklichkeit aber, so wurde mir gesagt, sei es ein »spezifischer Geruch« gewesen, wie ihn nur ein Einsiedlermönch, ein heiliger Narr, haben konnte.
Von ihm hieß es, er habe einst seinen sowjetischen Pass öffentlich verbrannt, Lenin – auch dies öffentlich! – als Satan bezeichnet und sei deswegen in die Psychiatrie eingewiesen worden. Der heilige Narr hatte zwei Särge gekauft – einen für sich, einen für seine betagte Mutter, er traute sich, alles zu sagen, und ungeachtet dessen, dass er manchmal unhöflich war und Leute beleidigte (zu einer Frau sagte er in meiner Gegenwart: »Verpiss dich, du Verführerin«), fanden ihn alle sympathisch. »Wie süß«, sagten sie und schlugen sogleich ein Kreuz, damit diese zärtliche Vertraulichkeit nicht als Sünde ausgelegt würde.
Als die Prozession der heiligen Nino dem Ende zuging und Vater Dawit mit der feierlichen Liturgie begann, sprang ausgerechnet jener Mann, der heilige Narr Gabriel, auf das Kirchenpodest, legte sich die riesigen Pranken auf die Brust und rief erst strahlend, dann erzürnt, der Teufel habe auf einem weißen Flügel gespielt und er, der Mönch, habe der Versuchung zu tanzen nicht widerstehen können.
»Er spielte und spielte, und ich konnte einfach nicht aufhören, ich, ein erwachsener Mann und Mönch, ich lachte und tanzte!«
Es schien, als habe keiner unten in der Menschenmenge erwartet, dass die Prozession solch einen Ausgang nehmen würde, zumindest ich nicht, denn bis dahin war mir noch nie ein tanzender alter Mann untergekommen.
»Wo kommt ihr her? Welchen Weg seid ihr gegangen?« Der Mönch, der offenbar gar nicht so alt war, wie er aussah, lächelte aus dem zahnlosen Mund. »Wer seid ihr?«
Vater Dawit trat gehorsam beiseite und ließ wie ein schuldbewusster Schüler den Kopf hängen.
»Was hat mir der Teufel angetan, und was wird er euch wohl antun, ihr armen Sünder?«, schrie der Mönch und schwebte tanzend auf den Altarraum zu. »Er ist nicht schwach, nein, sehr stark ist er, wenn er mich tanzen ließ, mich, einen Mönch, was wollt ihr dann schon gegen ihn ausrichten?«
Vater Dawit versuchte ihn höflich und so gut er konnte zu beschwichtigen, obwohl der Besessene mit den Händen fuchtelte und so etwas wie ein Knurren von sich gab. Dann aber breitete er theatralisch die Arme aus und legte ihm den Kopf an die Brust, unter den Bart. »Heilige Nino«, sprach er, »heilige Nino«, wiederholte er noch zwei- oder dreimal und schlug ein Kreuz. »Noch ist sie nicht erschienen. Die ganze Nacht hat mich der Teufel tanzen lassen …«
Der Mönch neigte betont demütig und verglichen mit seinem vorherigen Benehmen erstaunlich gehorsam vor Vater Dawit den Kopf.
»Gott segne euch«, sagte jemand hinter mir.
Diese Worte waren dermaßen unpassend, dass plötzlich von allen Seiten ein Zischen erklang:
»Pssssst …«
Das war alles total interessant, zumindest interessanter, als ich gedacht hatte, aber ich wollte trotzdem weg von hier: Diese unbehagliche Atmosphäre, dieser lächerliche und beängstigende Narr, diese Menschenmassen … Es gab so viele Eindrücke, und ich konnte die Geschehnisse hier und auf dem Weg der heiligen Nino überhaupt nicht einordnen. War es wirklich erhebend und positiv, oder passierte hier etwas unerträglich Unnatürliches und Verstörendes um uns herum? Einerseits hatte es mir gefallen, das Kreuz des Apostels Andreas zu tragen und in meinen Träumen auf einer antisowjetischen Demo von Swiad Gamsachurdia oder Merab Kostawa gelobt zu werden, andererseits konnte ich den dummen Physiker nicht vergessen, den Heiden, und seine eingeschüchterte, bleiche Frau mit dem weinenden Kind auf dem Arm, die ihren diskussionsfreudigen Mann am Ende hilflos und verängstigt von der sie umringenden Menschenmenge weggezogen hatte.
Zum meinem Glück endete die Liturgie bald. Meine Mutter, Tante und andere Leute waren jedoch plötzlich der Ansicht, Vater Dawit könne es als Zeichen von Missachtung werten, wenn man ohne Beichte und Abendmahl gehen würde.
»Ist es verwerflich, keine Beichte abzulegen?«, fragte meine Mutter.
Auch ich sollte die Beichte ablegen – die erste Beichte meines Lebens, die der krönende Abschluss eines Marsches über Dutzende Kilometer sein würde, aber ich wusste wirklich nicht, was ich hätte sagen sollen, denn im Gegensatz zu meinem Klassenkameraden hielt ich mich für völlig frei von Sünde – das war ich tatsächlich – und ich hatte keine Vorstellung davon, was zur Hölle ich Vater Dawit auftischen sollte.
Sollte ich mir etwa ihm zuliebe Sünden ausdenken?
»Unmöglich, dass du keine Sünden hast«, sagte die Kommilitonin meiner Mutter, wie alle ihre Geschlechtsgenossinnen unterschwellig verliebt in Vater Dawit, »horch in dich hinein!«
Ich wurde wütend, weil ich mich unter Druck gesetzt fühlte, ganz besonders von meiner Mutter, die so tat, als wäre sie auf meiner Seite, aber gleichzeitig dachte, es könne mir nicht schaden zu beichten. Und außerdem, so sagte sie, könne ich Vater Dawit damit eine Freude machen. Also musste ich mit diesem Mann über irgendetwas reden, damit er sich gebauchpinselt fühlen würde. Wie ich mich schämte, seine Zeit zu verschwenden und ihm irgendwelchen Unsinn aufzutischen: Ich hätte meine Mutter gekränkt, ein Mädchen zum Weinen gebracht, sei frech zu meinem Großvater gewesen …
»Faulheit ist eine Sünde, zum Beispiel«, sagte eine Frau, die auf einem Stein saß und glasige Augen hatte. »Völlerei, Gefräßigkeit …«
Sie zählte Wörter auf, deren Bedeutung ich nicht kannte. Ich war furchtbar verwirrt, weil ich krampfhaft versuchte, mich an Sünden zu erinnern (oder mir welche auszudenken), um einer Beichte würdig zu sein. Ich dachte, ich könnte einfach die Sünden eines anderen aufschreiben – zum Beispiel die meiner Großmutter, die als Kind Katzenbabys ertränkt hatte.
Der Vorschlag, die Sünden aufzulisten, machte die Sache nicht einfacher.
Generell waren damals viele bestrebt, den Geistlichen möglichst viel über ihr Privatleben zu erzählen (am meisten diejenigen, die in Wahrheit gar kein Privatleben hatten), die Leute füllten Seite für Seite mit winzigen, schiefen Buchstaben – sie schrieben und schrieben alle unmöglichen und möglichen Sünden auf, begangene oder nur imaginäre, angelastete oder echte.
Diejenigen, die so einen weiten Weg zurückgelegt und sich jetzt zur abschließenden Liturgie zusammengefunden hatten, legten sich nun Büchlein auf die Knie und sinnierten fleißig über ihre Vergehen. Manche schrieben »Meine Sünden«, andere »Sündenliste«.
Meine Mutter wollte mir beim Schreiben meiner Sündenliste helfen, doch dann fiel mir gerade noch eine echte Sünde ein. Ich hatte mit dem neuen Videorekorder des Nachbarn einen Ausschnitt eines Pornofilms (über das zügellose Leben Katharinas II.) gesehen. Und so schrieb ich zwei Worte ordentlich auf das reine Blatt Papier:
Meine Sünden
Ich fügte eine Nummerierung hinzu:
1.
2.
3.
Dann bekam ich doch Skrupel, eine echte Sünde aufzuschreiben, zerknüllte das Blatt und wandte mich mit einer zurechtgelegten Bitte an Vater Dawit: »Vater Dawit, ich bin das erste Mal hier und bitte Euch um Hilfe.«
Das bedeutete, der müde Priester, der wahrscheinlich nicht einmal wusste, dass ich die Beichte nur als Zeichen der Wertschätzung ihm gegenüber ablegen wollte, musste sich nun Fragen einfallen lassen, die er einem sündigen Kind stellen konnte.
Vater Dawit saß mit gelangweilter Miene neben einer hohen Kommode und schien zu faul, um über meine Sünden nachzudenken.
Endlich überwand er sich und fragte: »Verärgerst du deine Eltern?«
»Ja«, erwiderte ich erfreut.
»Faulenzt du?«
»Ja.«
»Sagst du schlimme Wörter?«
»Ja.« (Dabei tat ich das gar nicht.)
»Hast du jemandem Kummer bereitet? Sagen wir, einem Freund?«
»Ja.«
»Wie?«
»Ja.«
»Wie, hab ich gefragt. Erzähl.«
»Ähm, nun ja … Ich weiß nicht mehr … Gleich fällt’s mir wieder ein …«
»Kommen dir manchmal schlechte Gedanken? Zum Beispiel über einen Menschen, der dich verärgert hat? Dass ihm etwas Schlimmes zustoßen sollte …«
»Ja …«
»… dass er sterben sollte, mal angenommen.«
»Ja … Nein … »
»Tja …«, sagte er nachdenklich.
Irgendwie befürchtete ich, er würde mir jetzt die Frage stellen, mit der er meinen Klassenkameraden dazu gebracht hatte, seine Hauptsünde zu offenbaren. Und wenn er das täte, würden mir garantiert jene sündigen Gedanken in den Sinn kommen, die mir, seitdem ich die pikanten Episoden aus dem Leben Katharinas II. auf Video angeschaut hatte, nicht aus dem Kopf gingen.
Er fragte jedoch nichts dergleichen, sagte nur: »Möchtest du selbst nicht noch etwas hinzufügen?«
Was hätte ich hinzufügen sollen? Ich hatte mich in keiner Weise einer solchen Sünde (wenngleich ich immer noch so meine Zweifel hatte, dass mein Klassenkamerad sie wirklich begangen hatte) schuldig gemacht, an Katharina jedoch wollte ich prinzipiell nicht erinnert werden. Ich weiß eigentlich nicht genau, warum ich Vater Dawit allen Ernstes entgegnete: »Ich habe furchtbare Angst vor Außerirdischen, alle sprechen davon, und ich möchte wissen, gibt es die nun wirklich oder nicht?«
Die Frage war so dermaßen idiotisch und nicht altersgemäß, dass Vater Dawit plötzlich aufhorchte, mich etwas verdutzt musterte (wahrscheinlich versuchte er mein Alter zu schätzen) und bedächtig, mit gesenkter Stimme stockend antwortete: »Weißt du, das musst du auf alle Fälle meiden, auf alle Fälle …«
Was? Die Außerirdischen oder die Gedanken an Außerirdische? Ich war verwirrt.
Ich kniete nieder, Vater Dawit legte die Hand auf meinen Kopf und las ein Gebet.
Ich fühlte, wie er in der Luft über meinem Kopf ein Kreuz schlug.
Schule. Der Zerfall der Sowjetunion
Es ist 1989, ich renne durch den staubigen Schulflur, eine Lehrkraft jagt mich und schreit mir nach, ich solle das Pionierhalstuch umbinden.
Die Lehrkraft atmet schwer – Kinder zu jagen und gleichzeitig anzuschreien macht ihr zu schaffen.
Die Sowjetunion liegt in den letzten Zügen, unsere Schule gilt im Vergleich mit neuartigen und sowjetischen Schulen als relativ liberal, die Pionierhalstücher verbrennen wir schon seit zwei Jahren öffentlich im Schulhof, unsere junge Lehrkraft verfällt in eine solche Hysterie, dass ein Infarkt nahe scheint.
Er brüllt über alle Flure, Klassenräume und alle fünf Etagen: »Bindet die Halstücher um, oder es rollen Köpfe!« Wir aber – die Anführer der örtlichen Nationalbewegung und der »Nationalen Freiheitspartei« – rennen verängstigt herum und sind verwundert, dass uns unsere Lehrkraft, wo niemand die sowjetischen Gesetze befolgt, hartnäckig bittet, das rote Halstuch zu tragen!
Dieser Mann ist ein Despot, ich habe mit meinen eigenen Augen gesehen, wie er einen Klassenkameraden um den Trinkbrunnen jagte. Von seinem Gebrüll gefriert uns das Blut, er ist der letzte Mensch, der bis zum Sanktnimmerleinstag schreien wird: »Ohne Halstuch ist nicht erlaubt!«
Wie peinlich wäre es, wenn er einen von uns Parteiführern erwischen und wie jenes arme Kind vor dem Schulgebäude herumjagen würde! Ich bin der Vizepräsident, vor mir rennt mein Präsident – Klassenkamerad und Dichter –, mein Namensvetter. Wenn dieser Mann uns einholt und einem von uns einen Fußtritt verpasst, müssen wir die Partei auflösen.
Was juckt uns das verwirrte, brüllende Sowjet-Überbleibsel, was ist nicht erlaubt? Was ist nicht erlaubt, Herr Dimitri, Sie pseudomodernisierte, pseudomoderne Lehrkraft? Haben Sie Angst, Ihren Posten zu verlieren? Wozu Halstücher, wenn schon alles erlaubt ist?! Die Sowjetunion zerfällt, die Zeitungen drucken unzensierte Skandalnachrichten. Verbotene historische Fakten nehmen wir so auf, als ginge es um unsere Gegenwart: Lenin hat Syphilis gehabt, Stalin hat Hitler geheime Informationen verraten, Gorbatschows Frau Raissa heißt in Wirklichkeit Rebekka, Breschnew lässt sich von der Wunderheilerin Dschuna kurieren, seine bulgarische Wahrsagerin Wanga hat ihm vor zehn Jahren den Zerfall des Imperiums vorausgesagt, die Bolschewiken haben mehr als zwanzig Millionen Menschen erschossen, während der Verlesung des Vertrages zum Anschluss Georgiens an Russland sind die georgischen Adligen in der Sioni-Kathedrale eingeschlossen worden, der ehemalige Generalsekretär Andropow ist in Wirklichkeit der amerikanische Musiker Glenn Miller gewesen …
Auf drei Fernsehsendern (von denen nur ein einziger einheimisch ist – der Erste Kanal Sowjetgeorgiens) laufen neue Sendungen, wir sehen zum ersten Mal Filme aus dem Horror- und dem seichten Erotikgenre im Fernsehen: Im ersten Fall zersägt eine Frau einen maskierten Mann, im zweiten Fall kniet eine Frau vor einem Mann, öffnet seine Hose und … Und ich bin nicht nur vom unerwarteten Inhalt der Sendungen, sondern auch vom Wandel der Zeiten schockiert und höre nebenbei meinen gebannten Vater sagen: »Au Mann, die sind ja völlig verrückt geworden.«
Meine Großmutter steht mit der Antenne in der Hand beim alten Fernseher und versucht, das flimmernde Bild in den Griff zu kriegen, sie kann die Antenne kaum still halten und schaut auf einem Bein stehend zum Fernseher, aber das Bild ist trotzdem gestört, und sie drischt erbarmungslos und schimpfend auf den Fernseher ein. Es ist ein Paradoxon: Der Schlag bringt den Fernseher zur Besinnung, das Bild wird deutlich.
Der Zerfall der Sowjetunion wird durchs Fernsehen beschleunigt: Alle reden. Alle reden über alles. Alles ist erlaubt, liebe Lehrkraft, du Speichellecker und überflüssiges Überbleibsel, wozu Pionierhalstücher? Die Leute setzen Naturgesetze außer Kraft. Wir, Parteiangehörige und Parteilose, sitzen vor dem Fernsehbildschirm und schauen uns an, wie der Wunderheiler Longo eine Leiche zum Leben zu erwecken versucht: Es ist die Nachtausgabe der Nachrichten, alles spielt sich in einem Leichenschauhaus in Moskau ab, der Tote liegt auf einer Bahre, am Kopfende steht der Wunderheiler Longo und streckt die Hände nach ihm aus, an der Wand stehen die eingeschüchterten Pathologen. Longo wedelt mit den Händen, schnauft laut (seinem Schnaufen lauschen mit angehaltenem Atem zweihundertfünfzig Millionen Sowjetbürger), geht immer näher an den Verstorbenen heran … Und plötzlich – es ist unglaublich! – (»Er ist auferstanden«, sagt mein Vater, eher wütend als erstaunt, »die machen die Leute verrückt«) –, hebt auch die Leiche die Hände, richtet sich auf … Den Pathologen rutscht das Herz in die Hose. Gibt es etwa die Auferstehung von den Toten? In der Sowjetunion, während der letzten Regierungsjahre Michail Gorbatschows werden die Toten wieder zum Leben erweckt. Longo erhält Briefe: »Lassen Sie Nikolaus II. wiederauferstehen«, »Erwecken Sie Stalin wieder zum Leben, er wird die Ordnung wiederherstellen …«
An die Psyche der Kinder denkt keiner; als die Sowjetunion ihrem Ende zugeht, schreibt uns niemand vor, wir sollen nicht mehr fernsehen, pünktlich schlafen gehen, zeitig aufstehen, denn jetzt ist es unmöglich, nicht fernzusehen. Vor nicht allzu langer Zeit gab es Filme aus dem Westen nur einmal pro Woche zu sehen, samstags, in der Sendung »Illusion«, und die schönsten und neuesten nur am Vorweihnachtsabend oder zu Ostern, damit die Leute nicht in die Kirche strömten, wie es schon populär geworden war. Man war in der Zwickmühle: Geh ich zum Gottesdienst, oder schau ich »Illusion«? Geh ich in die Kirche, oder entscheide ich mich für den (zensierten) »Paten«? Damals entschieden sich viele gegen die »Illusion«, fühlten sich nicht mehr verpflichtet, zum achtzehnten Mal »My Fair Lady« anzuschauen, und gingen, zum Leidwesen des Kremls, zu Ehren des Gottes der orthodoxen Georgier in eine funktionstüchtige Kathedrale und schlossen sich auf diese Art der Nationalbewegung an. Die wichtigste und verlockendste Sendung war »Video-Video«, in der die Leute erstmals den »Killer-Cyborg« und die Abenteuer des Muskelprotzes Rambo zu sehen bekamen. Das war das letzte Lockmittel der sterbenden kommunistischen Regierung, das ZK versuchte die Leute mithilfe des Fernsehgottes von den Kirchen wegzulocken, aber zu spät: Uns hielt schon nichts mehr zu Hause, weder ein »Rambo« noch ein teuflisch erscheinender »Jesus von Nazareth« konnte die Demonstrationen verhindern.
Welches Elternteil hätte es gewagt, uns zum Schlafengehen zu ermahnen? Was wäre gewesen, wenn man uns nicht die Freiheit gegeben hätte, so viele neue Dinge zu sehen?
In der Schule verfolgt uns die Lehrkraft, auferstanden wie jene Leiche, und versucht vergeblich, uns zum Umbinden des Halstuchs zu zwingen, nur weiß er selbst nicht, welche Gesetze er durchsetzen will. Wer zu Hause ist, sitzt immer noch vorm Fernseher und lauscht den Befehlen eines auf dem Bildschirm leuchtenden, gewaltigen rundköpfigen Mannes und einzigartigen Wunderheilers: »Ich zähle bis zehn, und euch wird Müdigkeit überkommen.«
Auf dieses Gesicht warten freudig erregt die Kranken (in der Sowjetunion ist jeder krank); die Sendung dieses Mannes läuft zur sowjetischen Primetime – nach der Hauptnachrichtensendung »Wremja«. Die Sendezeit ist einzig seinem Wassermelonenkopf und seinen wie vor Ekel verzogenen Lippen gewidmet. In den tristen Wohnungen beginnt eine tolle Zeremonie: Fünfzig Frauen und Männer fortgeschrittenen Alters, die einen magischen Wunderheiler sehen möchten, nehmen freudig ihre Plätze ein. Diesen Minuten haben sie den ganzen Tag über entgegengefiebert, und nun setzen sie ihre schmerzenden Organe dem neuen Tele-Heiler aus: Magen-Darm, Herz-Kreislauf, Gelenke …
Im Gegensatz zu Longo besteht die Mission des Melonenkopfes nicht in der Auferweckung der Toten zum Leben, sondern in der Heilung lebender Toter. Sieh an, der taucht auch auf – mit an der Stirn zerzaustem kastanienbraunen Haar (»Färbt er das?«, fragt jemand) und mit von fettiger Salbe gelblich glänzenden Wangen. Der Wunderheiler gibt uns auf Russisch zu verstehen, dass er bis zehn zähle und alle in einen heilenden Schlaf fallen würden, und dieser Schlaf sei rein und habe heilende Eigenschaften.
Er zählt langsam, in einem gebieterischen, ruhigen Bariton: »Die Augen werden kleiner … vier, fünf …« Einige sind schon eingenickt. Ruhiges Schnaufen. »Neun, zehn …« Totale Hypnose: in den Nacken gesunkene Köpfe, offene Münder, ein paar Tropfen Speichel, albtraumfreies Schnarchen. Den ganzen Tag über warten sie freudig schwatzend und denken darüber nach, wo sie den charismatischen Bis-Zehn-Zähler hören sollen (ein Ritual ist ebenfalls, zu überlegen, bei welchem Nachbarn während der Wunderheiler-Sendung geschlafen wird), er ist noch nicht mal bis zehn gekommen, und schon schlummern alle. Das millionenfache Zuschauerglück währt nur wenige Sekunden.
Wie prämortalen Auswurf spuckt die Sowjetunion Zauberer aus, Leute, die Außerirdische gesehen haben, und ebenso Leute, die mit den Seelen der Toten sprechen können. Jemand tritt im Fernsehen auf und erzählt entweder, er habe einen Außerirdischen beim Schildkrötensee gesehen oder eine herumspazierende Seele auf dem Plechanow-Prospekt. Auf einer Demonstration heißt es: »Freunde, der KGB hat seine Wunderheiler und vom Teufel Besessenen ausgesandt, um uns einzuschüchtern. Aber wir haben keine Angst, ihre Hypnose wirkt auf uns nicht mehr!«
Wie sollen die Wunderheiler denn wirken? Sollen sie die Bürger von den Demonstrationen nach Hause zerren? Sollen die Zaubermitarbeiter des Geheimdienstes den Zerfallsprozess der Sowjetunion aufhalten?
Das sind ernste Angelegenheiten, darüber witzelt keiner. Nicht umsonst waren mir bei Vater Dawit die Außerirdischen eingefallen: Vor Außerirdischen habe ich Angst. In der Schule bin ich zwar Vizepräsident der »Nationalen Freiheitspartei«, aber, so oder so, nächstes Jahr werde ich zwölf, und deshalb beunruhigt mich vieles, unter anderem auch dieser Mann, der pathologisch brüllende Herr Dimitri, der uns jetzt schlagen möchte und einer wandelnden Leiche gleicht. Jener Leiche, die vor einigen Tagen bei »Wremja« auferstanden war.
Die Lehrerschaft, Intelligenzlerschaft, Professoren- und Lehrerschaft, Wissenschaftler- und Künstlerschaft und alle anderen Körperschaften in der Georgischen Sozialistischen Sowjetrepublik ermahnen die Bürger, sie sollen zu Hause bleiben und nicht durch die Straßen streifen. Das Zentralkomitee warnt uns, die sowjetische Miliz warnt uns, die Sicherheitsorgane warnen uns: Es wird eine Tragödie passieren!
Wir gehen in eine deutsche Schule, unsere Schule ist nicht wie andere Schulen – hier wird »Deutsch – intensiv« gelehrt (obwohl der Lerneffekt eigenartig ausfällt: Wir können keinen einzigen zusammenhängenden deutschen Satz sprechen). Wir haben junge (unsowjetische) Lehrer, keine Lenin-Porträts an den Wänden, nur welche von Goethe, Schiller und Wolfgang Borchert (dem Lieblingsdichter unseres Direktors). Wir haben kein Parteikomitee, keine »Rote Ecke« der Komsomolzen (eine Art Sowjet-Kapelle, die es fast in jeder Schule außer in unserer gibt), an den Wänden der Klassenzimmer hängen quietschbunte Plakate und Kalender aus der DDR, keine sowjetischen Losungen wie »Ehre der Arbeit« und »Ehre der Kommunistischen Partei«. Stattdessen an allen Wänden die bunte Aufschrift: Deutsch – intensiv. Das Einzige, was unsere Schule mit den sowjetischen gemeinsam hat, ist ein grimmiger Wachmann und die mit einem Schlüssel abgeschlossenen Toiletten. Es war eine ziemlich große Summe dafür ausgegeben worden, dass stabile (DDR-)Klobecken angeschafft werden konnten, deshalb darf niemand ins Bad, damit die Klo- und Waschbecken ihr unbeflecktes Aussehen behalten. Das Betreten der Toilette durch Schüler kommt deren Verschmutzung gleich: Sie werden sich auf das Klobecken stellen, wer heranreicht, wird ins Waschbecken pinkeln, die Wände werden mit anzüglichen Schmierereien verziert werden (zum Beispiel mit der georgischen Drei-Buchstaben-Bezeichnung für Penis), deshalb liegen die Toilettenschlüssel vermutlich bei der Lehrkraft oder dem Verwaltungsleiter in der Schublade, und außer ihnen wird keiner je erfahren, wer wo pinkelt. Unangenehm wird es nur dann, wenn Nullt- und Erstklässler pinkeln müssen. Die Kinder zappeln, zerren an der Hand der Lehrerin und schreien: »Frau Lehrerin, Frau Lehrerin, ich muss mal klein« (keiner sagt, wenn er groß muss, groß zu müssen ist peinlich). Aber die Lehrerin stellt sich taub, tut so, als höre sie nichts, denn sie hat keine Ahnung, wo ein Erstklässler klein machen soll (den Nulltklässler lässt eine tüchtige Erzieherin letztendlich zum Fenster hinauspinkeln), deshalb versuchen die Schüler es sich entweder zu verkneifen oder sind gezwungen, sich in den Pausen ein sicheres, verschwiegenes Plätzchen zu suchen.
Die Umgebung der Toilette ist ein konfliktreicher Ort. Genau dort, zwischen Lehrerzimmer und Toilette, streitet jetzt die Lehrkraft mit unserer dreiundzwanzigjährigen Erzieherin, die wir damals für sehr alt hielten. Diesmal ist aber nicht der Gang zur Toilette das Streitthema, sondern der zur Demo. Es kursiert das Gerücht, die Lehrkraft habe unsere Lehrerin beleidigt, angebrüllt und zum Weinen gebracht. Wir, die Klassen 7a, b und c, gehen schon seit mehr als zwei Wochen mit unserer Erzieherin zu den Demos, unser Mitschüler, der junge Dichter und Präsident der »Nationalen Freiheitspartei«, versucht jedes Mal, sich zwischen Swiad Gamsachurdia und Merab Kostawa zu postieren, er reicht den Nationalhelden bis zur Hüfte. Danach wiederholt er auf der Schultreppe die Parolen, die er vor dem Regierungsgebäude aufgeschnappt hat: »Boykott den Sowjetwahlen!«, »Lasst uns öffentlich die Pionierhalstücher verbrennen!«
»Wenn ihr das tut, dann breche ich euch die Hände!«, ruft die Lehrkraft, von deren Sorte eine zur gleichen Zeit wahrscheinlich, sagen wir, litauischen, aserbaidschanischen, ukrainischen und russischen Sechst-, Siebtklässlern hinterherrennt, weil das riesige Land überall gleichartig und gleichzeitig zerfällt. Die Lehrkräfte schreien auf verschiedenen Sprachen die gleichen Worte: »Bindet die Halstücher um, sonst brechen wir euch die Hände!«, und millionenfach rennen Kinder verschiedener Nationalitäten, Sprachen, Länder und Vergangenheiten durch die nach Sägemehl riechenden sowjetischen Schulflure – sei es in Tbilissi, Vilnius, Baku, Moskau, denn der Aufruhr ist überall in der Sowjetunion gleich. Millionen Kinder schauen ein und denselben Trickfilm – die unermüdliche Jagd des Wolfes nach dem Hasen. Die Trickfilmmusik kennen Millionen Kinder und werden sie immer wiedererkennen – auch in der Zukunft, wenn die Sowjetunion nicht mehr existiert und die Millionen keine gemeinsame Gegenwart mehr haben.
Jetzt rennen wir vor unserer Gleichartigkeit, den gemeinsamen Gewohnheiten und Regeln davon. Wir rennen vor der Anweisung davon, die in Millionen Schulkindern Hass gegen ihre eigene Notdurft aufkommen lässt (bzw. gegen die Streichholzschachtel, die warm von den zu analysierenden Substanzen darin zur Stuhlprobe dient); wir rennen vor der Anweisung davon, uns allesamt in der ganzen Sowjetunion zweimal im Jahr auf Kopfläuse untersuchen zu lassen, vor der Anweisung, plötzlich in ein komisches Krankenhaus gebracht und von einem Arzt mit Gummihandschuhen an den angstvoll zusammengezogenen Eiern betatscht zu werden – offenbar mit dem Ziel, bei niemandem etwas rachitisch nach oben oder unten Gekrümmtes durchgehen zu lassen (einer meiner Mitschüler musste bis zum Nachmittag bleiben, woraufhin irgendjemand aus der Elternschaft verbreitete, das Kind habe offenbar nur ein Ei).
Die Lehrkraft schreit unsere Erzieherin an: »Schulausfall ist nicht erlaubt, es ist nicht erlaubt, diese Nichtsnutze zur Demonstration mitzunehmen, sehen Sie denn nicht, was draußen passiert?! Es ist nicht erlaubt, die Eltern zu belügen – die Eltern schicken die Kinder zur Schule und nicht auf Demos!«
Lüge! Sogar die Eltern gehen zu Demonstrationen! Die Eltern nehmen uns mit, jetzt ist es nämlich wichtiger, auf Demos zu gehen als auf den Weg der heiligen Nino – es gibt keinen besseren Treffpunkt. Hier geht es uns besser, und wir können mehr bewegen als auf dem Weg der heiligen Nino.
Die Lehrkraft wird hysterisch: »In der Stadt sind Panzer, die Armee ist einmarschiert, das ist der falsche Zeitpunkt für Provokationen, bindet die Halstücher um, stachelt nicht alle auf! Wollt ihr, dass die Schule mit Panzern eingenommen wird?«
Offenbar macht er sich Sorgen um uns. Demnach rennt er uns nicht wütend, sondern beunruhigt nach.
Er hat recht: Auf den Straßen in der Nähe des Regierungsgebäudes stehen Panzer und behelmte Sowjetsoldaten. Die Soldaten sprechen kein Georgisch (georgisch ist nur die Miliz), es kommt uns vor, als läge den Soldaten eine eigenartige, grünliche Farbe auf dem Gesicht. Manche behaupten: »Man flößt denen irgendwas ein, die sind unter Hypnose.« Wieder Hypnose. In der Stadt steht eine fremde Armee.
Am neunten April telefoniere ich meinen Eltern hinterher und finde meine Mutter letztendlich bei einem Freund zu Hause: »Wo bist du? Verbringst du die Nacht dort? Kommst du nicht heim?« Sie waren auf einer Demo gewesen, hatten aber keinen Platz zum Stehen gefunden und waren zu einem Freund gegangen. Platzmangel hatte ihnen das Leben gerettet: Am neunten April, in der Morgendämmerung, startet die Sowjetarmee einen Angriff auf die Demonstration, sie töten die Menschen mit Spaten und Giftgas. Das jüngste Todesopfer ist ein sechzehnjähriges Mädchen, das älteste – eine siebzigjährige Frau. Insgesamt einundzwanzig Tote.
Der neunte April ist eine unserer »Urängste«: Im Fernsehen werden verstümmelte Leichen gezeigt, um die Psyche der Kinder macht sich niemand Gedanken, in Tbilissi wird die Sperrstunde verkündet, ab und zu fährt irgendjemand mit dem Auto vorbei und schreit verzweifelt: »Die Panzer kommen!«, die Sowjetsoldaten töten einen jungen Mann wegen Verstoßes gegen die Sperrstunde – er wird von einer Kugel in den Hinterkopf getroffen, russische Panzer werden von den Balkonen der Hochhäuser mit Kartoffeln, Äpfeln und Tomaten beworfen. Die Soldaten schauen von unten auf die Hochhäuser, wollen sehen, wer die Kartoffeln wirft, vielleicht können sie den Fenstern mit Kugeln Angst einjagen, die Kartoffelwerfer verstecken sich hinter den Balkonen. Diesmal töten die Soldaten niemanden – sie gehen weiter, schwarz gekleidete Frauen vor der Tür des alten Patriarchats kreischen: »Sie bringen uns wieder um, wieder werden hundert Georgier in den Himmel kommen!« Ich habe Angst und schlafe bei meinen Großeltern im Bett, Großvater versucht die ganze Nacht, die »Stimme Amerikas« mit seinem Radio zu empfangen. Die »Stimme Amerikas« verkündet uns unter Rauschen und Lärm die Geschehnisse in unserer Stadt: »Einundzwanzig Menschen – Frauen und Kinder – fielen mit Spaten und Giftgas bewaffneten Sowjetsoldaten zum Opfer. Die offizielle Presse schweigt. Die Zeitung ›Kommunist‹ schreibt, in der Sozialistischen Republik Georgien gebe es einen Arbeiterstreik.« Gorbatschow entsendet seinen Außenminister Eduard Schewardnadse in die trauernde Republik, und auch der trauert, als er auftritt: »Ich habe geweint, alle weinten.« Alle fragen sich, wer den Befehl zum Angriff auf die Demonstration erteilt hat. Wenn alle weinen, wer hat dann gemordet? Der Staatspräsident der UdSSR, Michail Gorbatschow, erhält den Friedensnobelpreis.
»Russland«, sagen alle, »Russland mordet«, denn Russland ist in Georgien das Synonym für eine Naturkatastrophe. Russland bedeutet Gefahr. Dieses Wort klingt mir seit meiner Kindheit in den Ohren, wenn jemand, meinetwegen meine Großmutter, nach dem Grund für eine heimtückische oder schwere, unerwartete oder voraussehbare, kleine oder große Tragödie sucht: »Das war von Russland geplant, da hat Russland die Hände im Spiel, das trägt die Handschrift Russlands.« Russland ist direkt oder indirekt verantwortlich für das Unglück Georgiens, Russland ist die gekränkte böse Stiefmutter, in Russland gibt es seismologische Stationen, die künstliche Erdbeben erzeugen, ein russischer Soldat hat keine Moral – er mordet, plündert und vergewaltigt. Russland ist ein Mörder.
Die Lehrkraft rennt mir und meinen Klassenkameraden mit der Angst vor Russland hinterher: »Bindet die Halstücher um, wollt ihr, dass die Panzer vor unserer Schule stehen?«
Diesmal kommt niemand. Im Gegenteil, sie gehen.
Nach dem neunten April wird alles anders. Das Lenin-Denkmal wird vom zentralen Platz entfernt: Die Beine zerschlagen, stürzt Lenin glatzkopfüber zu Boden. Alle anderen Lenins werden zerstört und zerschlagen, auch der vor dem Gebäude des Zentralkomitees – eine hockende Skulptur mit Mantel um die Schultern und großer gelber Birne, über die gewitzelt wird: Lenin auf dem Klo.
Jetzt sind alle auf den Demonstrationen. Wenn uns die Lehrkraft wieder hinterherrennt, dann mit diesen Worten: »Warum geht ihr nicht zur Demo?«
Die orthodoxe Kirche bekommt Dutzende neue Heilige: Nicht ausgeschlossen, dass jemandes Urgroßvater plötzlich zum Heiligen wird.
Waren uns vor dem neunten April in der Osternacht noch Filme gezeigt worden, mit denen die Leute zu Hause gehalten werden sollten, so wird jetzt fast wöchentlich das Neue Testament in Farbe auf den Bildschirm gebracht. Ob man zu Hause bleibt oder rausgeht – aus allen Ecken ertönt Kirchengesang (aus Fernsehern oder Propaganda-Radios), die Prospekte werden nach Märtyrern und Königen benannt – der nach dem Marxisten Plechanow benannte Prospekt bekommt den Namen Dawits des Erbauers; Lenin-Straßen werden in Georgien jetzt in Rustaweli-Straßen umbenannt. Ehemalige Kommunisten verbrennen ihre Parteibücher öffentlich oder werfen sie weg (oder behaupten, dass sie sie verbrennen oder wegwerfen). Vorsichtigere Leute trauen sich vorerst nicht, die Lenin-Porträts in den Büros gegen Ikonen des heiligen Ilia oder des heiligen Georg auszutauschen, und wählen deshalb das Kompromissmodell: Lenin wird einstweilen neben den Porträts der Nationalhelden stehen gelassen. Manche sind mutiger und tauschen schon 1990 (als die Sowjetunion formell noch existiert) Lenin geradewegs gegen Bilder von Swiad Gamsachurdia, den Vorsitzenden des obersten Sowjets, aus, die ihn mit erhobener Faust zeigen.
Ein aufgeregter grauhaariger Dichter steht auf der Tribüne, öffnet seine Hemdknöpfe und reckt dem Publikum ein riesiges Holzkreuz entgegen: »Dieses Kreuz hat mir der Patriarch geschenkt«, sagt er, »ich werde es niemals abnehmen, aber ich habe mein Parteibuch in der Tasche und auch dieses werde ich niemals ablegen, beides habe ich bei mir, denn beides gehört mir und macht mich stolz …«
Ihm ist noch nicht klar, was er überwinden soll – Kreuz oder Parteibuch.
Bei einer Rede gibt es Probleme: Der Präsident der Akademie der Wissenschaften möchte den Mitarbeitern gern zu Ostern gratulieren, doch er ist in den letzten Minuten verwirrt, und ihm entfährt eine stilistisch und historisch fragwürdige Phrase: »Ich gratuliere euch zur Auferstehung des Herrn Jesu, Genossen.«
Der orthodoxe Patriarch denkt sich neue Namen für die getauften Kommunisten aus. »Mit neuem Namen in ein neues Leben.«
Bis zum Zerfall der Sowjetunion bleiben ein paar Monate.
Schon ist allen alles erlaubt.
Das erste Jahr der Unabhängigkeit. Präsidenten
1990 begann ich auf einmal mit der Stimme des ehemaligen Sekretärs des Zentralkomitees Georgiens und sowjetischen Außenministers Eduard Schewardnadse zu sprechen.
Eines schönen Tages gab ich einige für ihn typische Phrasen mit verblüffend ähnlicher Tonlage von mir und krümmte den Daumen genau so, wie er es immer tat.
Danach, als ich annahm, ich spräche wieder mit meiner eigenen Stimme, erhielt ich plötzlich ein Kompliment von meinem Zuhörer: »Verblüffende Ähnlichkeit! Los, sag noch was!« Wegen meiner (und seiner) Stimme wurden meine Eltern mit mir zusammen auf Geburtstage eingeladen und vereinbarten im Voraus, dass ich mit meiner »berühmten Stimme« sprechen würde. Ein Verwandter, der zu Zeiten Eduard Schewardnadses als Sekretär des Zentralkomitees fünfzehn Jahre im Gefängnis gesessen hatte, setzte sich gleich bei seiner Entlassung mit meiner Großmutter in Verbindung und bat sie, zusammen mit der ihm verhassten berühmten Stimme zu einer Fete anlässlich seiner Freilassung aus dem Gefängnis gehen zu dürfen. Der Exhäftling (der sich wegen im Straflager üblicher Foltermethoden ein für alle Mal abgewöhnt hatte, im dunklen Zimmer zu schlafen – es musste immer eine Glühlampe brennen) flüsterte mir den ganzen Abend ein und dasselbe zu, ich sollte mit jener Stimme jene Worte sagen, die für einen kommunistischen Regierungschef völlig unpassend waren: »Hoch lebe die Unabhängigkeit Georgiens, nieder mit der Sowjetunion, Gorbatschow hat ein Muttermal auf dem Kopf, du musst auf mich spucken, das habe ich verdient.«
Ich habe völlig verdrängt, warum ich mit dieser dermaßen angesagten Stimme und Mimik auf der Bühne eines Saals mit zweitausend Leuten landete. Vielleicht hätte Eduard Schewardnadse einen Volksschauspieler aus mir gemacht, wenn meine Eltern nicht protestiert hätten, vor allem mein Vater, der mir mit Herrn Macharadse kam, ein Idol jener Imitatoren der Epoche, die sich eher durch Zurückhaltung hervortaten. Macharadse wage es im Gegensatz zu mir noch nicht, Eduard Schewardnadse zu imitieren, »wenn überhaupt, dann äfft er Gorbatschow, dessen Frau, die hiesigen führenden Persönlichkeiten und die Vertreter der Intelligenzija nach«, gab mein Vater zu bedenken. Meine Großmutter war wie immer auf der Seite meines Vaters: »Das ist gefährlich, Mensch, dieser Schewardnadse ist ein großes Übel – er ist nachtragend.« Sie glaubte nicht, dass ein Politiker, insbesondere ein Kommunist (sei er auch ehemaliger Kommunist und mitverantwortlich für den Berliner Mauerfall), jemals etwas vergessen konnte. Außerdem war sie irgendwie davon überzeugt, Eduard Schewardnadse im fernen Moskau sei an meiner Person interessiert: »Findet für mich heraus, wer dieser dickliche Junge ist, der hat ja vor nichts Respekt! Pluralismus heißt noch lange nicht, dass Ungezogenheit erlaubt ist.« Die andere Großmutter nahm meine Bühnenaktivitäten nicht so tragisch, im Gegenteil, sie war zufrieden, denn sie konnte von meinem ersten Honorar neue Küchenstühle erwerben. Auf der berühmten Fete steckten mir zunächst der Exhäftling, dann aber auch andere Leute sowjetische Fünfundzwanzig-Rubel-Scheine zu, deren Annahme ich kategorisch ablehnte, und das nicht nur aus Höflichkeit, damals wusste ich einfach gar nicht so richtig, was Geld bedeutet, schon gar nicht Sowjetgeld – Hauptsache, ich hatte ein Publikum und konnte auftreten.
Meine Mutter sagte, mein Vater sei imstande, alle zu Schülern zu machen, die mit ihm zu tun hatten, egal ob Freund oder Schwiegereltern; vom Großvater eines Klassenkameraden hieß es, er könne innerhalb kürzester Zeit Menschen für sich einspannen, die er gerade erst kennengelernt hatte, und zwar so, dass derjenige überhaupt nicht merkte, wie ihm geschah: Erst freundete er sich mit ihnen an und lieh ihnen sein Auto, dann lungerte er im Hausflur herum, und am Ende führte er schleichend Pflichten ein: »Hol den Enkel von der Schule ab, schau bei meiner Frau vorbei, wasch das Auto.« In meinem Falle lief das ähnlich: Diejenigen, die einfach nur zu Besuch kamen oder mich zufällig trafen, dienten oft ohne ihr Einverständnis und prinzipiell gegen ihren Willen als Publikum. »Er braucht Feedback«, sagte eine clevere Frau lächelnd zu meiner Mutter, die offenbar eher Psychologin als Zuhörerin war, was mir zwar nicht gefiel, mich aber auch nicht davon abhielt, Eindruck schinden zu wollen. Ich sprach über alles Mögliche und mit der Stimme von allen Möglichen, gab Phrasen von mir, die dieser Tage total angesagt und lustig zu sein schienen, mit meiner Kühnheit jagte ich meiner ohnehin schon verängstigten Großmutter noch mehr Angst ein und beschoss all jene mit Eduard Schewardnadses Stimme, die nicht an die Verwandlung eines Kommunisten in einen Demokraten glaubten.
Dass die Ängste meiner Großmutter übertrieben waren, wurde durch die Auftritte von brandneuen Parodisten bestätigt: Früher ließen sich alle taufen, jetzt parodierten alle. Plötzlich tauchten unzählige Leute auf, die eifrig und gewitzt sowohl lebende als auch tote Politiker nachahmten: den mit georgischem Akzent russisch sprechenden Josef Stalin, den von plötzlichem Durchfall geplagten, schleppend sprechenden Leonid Breschnew, den trügerisch lächelnden Eduard Schewardnadse und den auf Demonstrationen mit nach rechts verzogenem Mundwinkel in erlesenem Georgisch schreienden Swiad Gamsachurdia.
Der erste Präsident Swiad Gamsachurdia war eine viel angesagtere Stimme in Georgien als die von Eduard Schewardnadse. Dessen Stimme wurde verblüffend glaubwürdig von meinem Klassenkameraden (dem Präsidenten der »Nationalen Freiheitspartei«) verkörpert – denn er hatte von Natur aus beinahe die gleiche Stimme und musste sie somit gar nicht verstellen. Damals scheuten wir keine Mühe, den krankhaft politikverdrossenen Leuten wenigstens zwei Widersacher zu Gehör zu bringen: den Dissidentenpräsidenten Gamsachurdia und den nach Stalin populärsten georgischen Politiker, Schewardnadse, der irgendwann vor deren Zerfall Außenminister der Sowjetunion gewesen war. Wir nahmen einen fiktiven Dialog der beiden mit dem Kassettenrekorder auf und machten den Geburtstagsgästen meiner Großmutter begeistert weis, der Hauptdissident und der bekannteste Georgier hätten vor einigen Tagen auf dem Radiosender »Stimme Amerikas« eine große Auseinandersetzung gehabt. Die Gäste durchschauten den Trick schon nach wenigen Sekunden, bekämpften sich dann aber trotzdem bis aufs Messer, um ihren eigenen Favoriten zu verteidigen.
Später – es verblieben noch einige Monate bis zum Sturz der ersten Regierung im unabhängigen Georgien – wurde die Legende geboren, Präsident Gamsachurdia habe einen Eduard-Schewardnadse-Imitator in sein Büro bestellt und wehmütig gelächelt, als dieser mit der Stimme seines Gegners dummes Zeug von sich gab. Es hieß, der Imitator sei einige Male in Begeisterung verfallen und auch der Präsident sei dermaßen hingerissen gewesen, dass er vergessen habe, wer vor ihm stand, und diesen Eduard Schewardnadse schreiend aus dem Büro gezerrt habe: »Weiche, Satan!«
Mein Klassenkamerad sagte bedauernd, Schewardnadse nachahmend, ein Literaturkritiker und Dissident sei keinesfalls für das Präsidentenamt geeignet: »Alle, die ich in meinen Artikeln beschimpfte, haben ein Maschinengewehr in die Hand genommen.«
Präsident Gamsachurdias Dissertationsverteidigung war im georgischen Staatsfernsehen live übertragen worden: Die Wissenschaftler ergingen sich ganze fünf Stunden lang in Lobliedern auf das Werk des ehemaligen Dissidenten und Literaturkenners mit Spezialgebiet Schota Rustawelis »Recke im Tigerfell«. Die Übertragung wurde zeitweise unterbrochen, und als sie neu startete, war immer noch die Dissertation des Präsidenten Hauptmeldung des Tages.
Später, als auf einem Sender ein Imitatorenneuling mehr oder weniger erfolgreich den zukünftigen Präsidenten parodierte, beziehungsweise als er wie dieser die Faust schwang und den rechten Mundwinkel leicht hochzog, flimmerte der Bildschirm plötzlich in Regenbogenfarben: Offensichtlich war im unabhängigen Georgien das Parodieren des Präsidenten nicht erlaubt.
»Die alten Zensoren sitzen immer noch fest im Sattel, und wenn ich nicht darauf hinweise, setzen sie diese furchtbaren Gesetze um, ich verbiete nichts, jeder kann über mich lachen, wie er möchte«, rechtfertigte sich mein Klassenkamerad mit Dissidentenpräsidentenstimme. »Ich bitte dich, sehe ich jetzt etwa aus wie ein Zensor?«
»Tust du, mein Guter, ja«, antwortete ich mit Schewardnadses Stimme und Lächeln.
Dabei tat er das überhaupt nicht.
Am siebten April 1991 bestaunte ich ziemlich lange jenen Mann, der in zwei Tagen die Unabhängigkeit des Landes verkünden sollte.
Vater Dawit, der mir den Kontakt zu Außerirdischen verboten hatte, hielt zu jener Zeit Gottesdienste in Swetizchoweli ab, und ungeachtet dessen, dass meine Mutter und meine Tante gegenüber der neu erstarkten Kirche bereits skeptisch waren, schrieben sie trotzdem eine nicht besonders interessante Sündenliste auf einen Zettel und eilten zu ihrem nur unregelmäßig aufgesuchten Beichtvater. Anders als beim letzten Mal lehnte ich es diesmal entschieden ab, meine Sünden aufzuzählen, erklärte mich jedoch halbherzig bereit, zum Gottesdienst mitzukommen. Zunächst erschien uns die Kirche völlig leer – nur ein paar gelangweilte Mädchen sangen ohne Zuhörer, es stellte sich aber heraus, dass in der Ecke an einer unscheinbaren Säule Präsident Gamsachurdia stand, eine ziemlich lange Kerze in der Hand, sich leicht wiegend.
»Vielleicht war er nervös«, sagte mein Vater, als ich ihm von der Begegnung erzählte, »schließlich erklärt er bald die Unabhängigkeit, stell dir vor, wie gestresst er sein muss.«
Gestresst und vollkommen allein: Sein Dissidentenpartner Merab Kostawa war kurz zuvor bei einem Autounfall ums Leben gekommen, von dem es hieß, er sei vom KGB inszeniert worden. Es war der Stil des sowjetischen KGB, einen Mord wie einen natürlichen Tod aussehen zu lassen. So war es in den Dreißigern des zwanzigsten Jahrhunderts und so wird es auch weiterhin sein – auch im Russland des einundzwanzigsten Jahrhunderts, wo unter der Regierung eines ehemaligen KGB-Offiziers politische Gegner »natürlich« umgebracht werden.
Nach der Tragödie des neunten April 1989 wurde es zur Regel, dass die Georgier, außer sich und verrückt vor Angst, ins Leichenschauhaus gingen oder davor Demonstrationen abhielten. Die Leute gingen dorthin, wo die bekannten Opfer lagen. Sie wollten die Toten sehen: »Zeigt uns die Verstorbenen!«
Diesmal waren Studenten zu dem Leichenschauhaus gegangen, in dem der Nationalheld lag. »Zeigt uns Merab Kostawa!«, schrien sie. Merab Kostawa lag auf einer Bahre. Jemand erzählte: »Ich hab nur seine Füße gesehen … Die Zehen schauten aus den zerrissenen Socken, weiter bin ich gar nicht reingegangen.« Er sagte das so, als ob am Tod dieses Mannes nur das »natürlich« war: eine zerrissene Socke.
Die Unabhängigkeit wurde am Jahrestag meiner ersten großen »Urangst« erklärt – am neunten April. Einige Monate später, als in Poti am Schwarzen Meer die erste nationale Marinemeisterschaft feierlich eröffnet wurde, begann in Moskau ein Putsch und der auf der Krim festgesetzte Michail Gorbatschow wurde politisch kaltgestellt. Nicht umsonst hatte ich mit Eduard Schewardnadses Stimme vorhergesagt: »Die Diktatur kommt!« Plötzlich schien die Sowjetunion zurückzukehren.
»Jetzt wird die Unabhängigkeit aufgehoben und unser armer Präsident festgenommen.« Unsere Nachbarin Tamara (eine von denen, die beim Zählen des Wunderheilers am schönsten einschliefen) war am Boden zerstört.
Die Rückkehr der Sowjetunion währte nur drei Tage lang. Der Moskauer Putsch endete so schnell, wie er begonnen hatte, aber jetzt war Tbilissi an der Reihe: Neun Monate nach der Unabhängigkeitserklärung wurde in Georgien Krieg geschürt.
Die Mitstreiter des Präsidenten und Rebellen legten innerhalb von vier Tagen den zentralen Prospekt in Schutt und Asche. Kaum zu glauben, dass auch jener Imitator ein Maschinengewehr trug, dessen Präsidentenparodie im Fernsehen unterbrochen worden war: »Wir sollten ihn am lebendigen Leibe in seinem Bunker schmoren!«, sagte er diesmal mit seiner eigenen Stimme. Der dreiundzwanzigjährige Rebellengeneral verkündete der Bevölkerung stolz, wenn der Präsident nicht zurücktrete, werde er das Regierungsgebäude mit Bomben bewerfen und das ganze Sololaki-Viertel in die Luft sprengen.
Da die Rebellen das Rundfunk- und Fernsehgebäude eingenommen hatten, wurden die Sendungen in einem Bus aufgezeichnet, der im Hof des umzingelten Regierungsgebäudes stand. Aus diesem »Fernsehbus« beschimpften sie entweder haltlos die bis an die Zähne bewaffnete Opposition oder, nett ausgedrückt, deuteten den Zuschauern subtil an, welche Katastrophen der Umsturz der gesetzmäßigen Regierung zur Folge haben würde. Auf dem Rustaweli-Prospekt waren schon Schüsse gefallen, als der regierungstreue »Fernsehbus« uns eine amerikanische Verfilmung von Shakespeares »Julius Cäsar« präsentierte. Die Leute hätten normalerweise gleich erkennen müssen, wer Cäsar war und wer Brutus (der ehemalige Premierminister, jetzt Rebellenführer, von dem es hieß, er spritze sich Drogen ins Zahnfleisch), aber jetzt nahm keiner mehr die Allegorien wahr – im Stadtzentrum wurde scharf geschossen. Doch während die unterschwellige Botschaft von »Julius Cäsar« noch einigermaßen naheliegend schien, war die Ausstrahlung der Kinoversion von Giuseppe Verdis »Rigoletto« zwei Tage vor der Flucht des Präsidenten vollkommen rätselhaft. Was wollte man den Zuschauern damit sagen?
Der Präsident des unabhängigen Georgiens floh genau an dem Tag, als die Sowjetunion offiziell aufhörte zu existieren.
Drei Monate nach Ende des Tbilisser Krieges kehrte »meine Stimme« nach Georgien zurück und wandte sich noch am Flughafen an seine Unterstützer: »Als es notwendig wurde, nahm die Intelligenzija die Waffe in die Hand und verteidigte unter Einsatz ihres Lebens die Demokratie.«
Als 1993 der achtmonatige Abchasienkrieg ausbrach und bei der Generation meiner Eltern Frustration auslöste, saß die Bevölkerung mehrheitlich wieder treu vor dem Fernseher und versuchte, durch den Konsum neu aufgekommener mexikanischer Seifenopern abgestumpfte Gefühle wiederzuerwecken. Die Serie »Auch die Reichen weinen« lief einen Monat länger als der Krieg, doch es war genau an dem Tag der Strom abgeschaltet, als sich das zerstrittene Ehepaar in der zweihundertfünfzigsten Folge versöhnen sollte. Der Strom fiel aus und wurde jahrelang nicht wieder angeschaltet, die vier Jahreszeiten traten außer Kraft. Überall lag der Geruch verbrannten Holzes in der Luft, und es wurde für lange Zeit dunkel. Das Baden entfiel für Jahre. »Meine Stimme« kam wie durch ein Wunder mit dem Leben davon: In den letzten Tagen des Abchasienkrieges wurde versucht, Eduard Schewardnadses Hubschrauber mit einem russischen Maschinengewehr abzuschießen. In Tbilissi wurde immer noch geschossen, denn jetzt hatte jeder eine Waffe.
Jetzt war allen alles erlaubt.
Eine Welt ohne Liebe. Durchsetzungswille im Chaos
Sechzehnjährige Jungen brachten sich ebenso gegenseitig um wie ihre Väter. Mord als Nachahmung.
Wir ahmten sie nur stimmlich nach – unsere Väter, Mütter, Politiker, Mörder, bekannte und unbekannte Menschen.
Ich und der Präsident meiner Partei versuchten uns gegenseitig darin zu übertrumpfen, die Stimmen jener Mädchen zu imitieren, in die wir hoffnungslos verliebt waren.
Das war eine traurige Imitation, weil wir versuchten, die unerwiderte Liebe mit den Stimmen der nicht in uns verliebten Geliebten zu kompensieren.
Wir haben uns zwar mit den Stimmen der nicht in uns verliebten Geliebten amüsiert, aber wir konnten die Mädchen partout nicht in uns verliebt machen. Warum sollte man sich denn in einen Jungen verlieben, der die Geliebte und gleich noch deren Eltern und Großeltern mit grotesker Zwanghaftigkeit parodiert? Die nicht in uns Verliebten liebten andere: seriöse junge Männer, die seriös Männer parodierten, die älter und noch seriöser waren als sie selbst. Ihre Großmütter mochten uns, und es war gut, dass die uns mochten, weil die Großmütter über uns sprachen und ihre Enkelinnen das Lob hörten. Gelobt zu werden war wichtig. Wir brauchten Lob, konnten ohne Lob nicht leben. Wir brauchten Liebe, die Gewissheit, dass jemand, den wir liebten, von uns beeindruckt war. Zu dieser Zeit mochten die Mädchen unserer Meinung nach jedoch genau solche, die persönlich absolut keinerlei Eindruck hinterließen, aber in der totalen Auto- und Benzinlosigkeit ein Auto und Benzin hatten, und das war Eindruck genug. Wir sagten: Die wissen uns nicht zu schätzen, weil sie nur Automänner wahrnehmen können, moderne Zentauren, ernste sechzehnjährige Jungen, die den Kopf eines Menschen und den Körper eines Autos haben. Wir hingegen (die besseren Partien) liefen kilometerweit zu Fuß und gerieten entweder in die Schusslinie oder mussten vor streunenden Hunderudeln weglaufen. Des Öfteren begegneten wir in den Straßen einer zwanzig Mann – oder eher zwanzig Kind – starken verarmten, aggressiven Bande, von denen uns einer das Messer an die Kehle hielt und uns, sofern vorhanden, Kupons (provisorisches Geld) in Millionenhöhe abnahm. Hatte man nichts dabei, lief man Gefahr, verletzt oder gar umgebracht zu werden. Ich versteckte die Schallplattenhülle unter der Jacke, damit der darauf abgebildete Mann mit den Korkenzieherlocken kein Grund für Prügel werden könnte (Wolfgang Amadeus Mozart, Flute Concerto). Völliger Quatsch, sie überhaupt mitzunehmen, obwohl ich wusste, dass es nirgendwo Strom gab, und selbst wenn, wäre die Spannung tödlich niedrig gewesen, was bedeutete, die Schallplatte hätte sich unerträglich langsam gedreht, die schnellen Tempi an Qualität eingebüßt und der Klang wäre basslastig geworden. Meinem Nachbarn wurde die uralte »Abbey Road«-Vierer-Platte zerschlagen, ein anderer wurde wegen einer Kassette verprügelt, und ein sehr ehrwürdiger Mann wurde nur deshalb verdroschen, weil er mit dem Fahrrad vorbeifahren wollte, denn ein Fahrrad galt in dieser melancholischen Stadt als Provokation und Widerspruch.
Das einzige Fortbewegungsmittel, welches in der chaotischen Nachkriegsstadt mehr oder weniger verlässlich funktionierte, war die Metro, allerdings sollte man sich, bevor man da hineinging, unbedingt mit Kerzen bevorraten, so wie das meine Großmutter zu tun pflegte, denn der Strom konnte jederzeit ausfallen.
Ich bemerkte, dass meine Großmutter oft freudig zur Metro eilte, weil die zu Dutzenden stundenlang auf den Gleisen stehenden Züge ihr neue Kontakte ermöglichten.
Es war besser, sich nicht vom Fleck zu rühren, denn Bewegung war gefährlich. Auf den Straßen liefen Tausende Abnormale herum, »Irre«, wie sie genannt wurden. Jeder wusste, dass es sie irgendwo gab und man sie hier und da antreffen konnte, aber niemand konnte genau sagen, wer diese Leute waren: Verwirrte, die aus der Psychiatrie entflohen waren, oder durchgedrehte Menschen, die nach dem Tbilisser Krieg verrückt geworden waren? Unsere Nachbarin war in einem Hof wie dem unseren von einem Mann überfallen worden, und wie das Opfer berichtete, wäre sie bestimmt erwürgt worden, wenn der über ihr wohnende alte Mann nicht beschlossen hätte, seinen Müll herunterzukippen. Der potenzielle Mörder wurde vom Lärm des Nachbarn verschreckt.
Meine Mutter ging einmal mit meiner kleinen Schwester in der Nähe des Schildkrötensees spazieren und spürte plötzlich, dass sich hinter ihnen irgendetwas bewegte. Sie blickte sich um und sah einen Mann auf sich zukommen, hinkend, halbseitig im Gesicht gelähmt und, was das Entscheidende ist, ein Messer in der Hand.
Was sollte meine Mutter tun? Niemand war in der Nähe, der ihr hätte helfen können. Der Ausweg bestand darin, sich selbst unangepasst zu verhalten, und so ging sie lächelnd, höflich, ja, regelrecht liebevoll auf den bewaffneten Mann zu: »Oh, ich habe Sie beinahe nicht erkannt! Wie geht es Ihnen?«
Der Mann ließ seine heraushängende Zunge im Mund verschwinden, verbarg das Messer und murmelte: »Danke, geht so, meine Liebe …«
Die Moral hatte den Mann aus dem Konzept gebracht. Die Höflichkeit erinnerte ihn daran, dass ihn jemand immer noch als Mensch wahrnahm.
Meine Mutter kam zwar wohlbehalten nach Hause, verbrachte wegen des Schrecks jedoch zwei Wochen im Bett.
Ich imitierte diesen Mann bei meiner Angebeteten, doch ich jagte diesmal ihrer Großmutter einen Schrecken ein: »Ah«, rief die alte Frau besorgt, »das heißt also, man kann nicht mehr zu Fuß auf die Straße gehen?«
Zu Fuß – nein. Nur noch mit dem Automann?
Ich hatte einen Fehler gemacht. Mich und den Präsidenten meiner Partei befiel Hoffnungslosigkeit. Seine Gedichte über die imitierten Angebeteten machten zwar mehr Eindruck auf die Zuhörerin, aber das änderte nicht viel: Alles nur leere Worte, mehr nicht.
Die Kriegsverlierer. Geld in der Tasche des Zugführers
Ich, ein ordentlich aussehender Student, werde vom Pädagogen unseres Militärkurses, Oberst Witali Ziklauri, zum Zugführer ernannt. Das heißt, ich muss am Semesterende von meinen Kommilitonen Geld eintreiben und dem Oberst als Geschenk übergeben. Anderenfalls würden wir keine Note eingeschrieben bekommen und zwangsläufig in die historisch gesehen schon unabhängige georgische, beziehungsweise Schewardnadse’sche, inhaltlich und strukturell jedoch noch sowjetische Armee eingezogen. Das will natürlich keiner riskieren, denn die Armee ist genauso wie die Regierung arm und kriminell.
Die Staatliche Universität bewahrt ihre Studenten vor der Einberufung, wenn sie im Verlauf eines Jahres theoretisch eine militärische Vorbereitung durchlaufen, aber das funktioniert nicht, denn so, wie in Wirklichkeit von Oberst Witali Ziklauri unterrichtet wird, kann man es gar nicht als richtiges Fach betrachten: Der alte sowjetische Offizier weiß nur, wie man laut und mit russischem Akzent Befehle schreit und das ganze Jahr ein und dasselbe wiederholt, nämlich dass es Liege-, Steh- und Sitzgräben gibt, mehr nicht.
Es ist der letzte Tag des Semesters. Ich bin furchtbar aufgeregt, denn mich erwartet eine unerträgliche Prozedur – ich soll mit Oberst Ziklauri in den Sanitätsraum gehen, wo ich eine psychologisch und moralisch vernichtende choreografische Übung absolvieren muss: Ich muss ihm möglichst unbemerkt die Opfergabe des militärischen Zuges in die Hand drücken: (»Hach, mein Junge, das wäre doch nicht nötig gewesen!«)
Ich muss das erste und das letzte Mal einen Menschen bestechen.
Er ist durch und durch ein Sowjetmensch – hinsichtlich Stimme, Verhalten, gespielter Wut und dem Geruch von Eau de Cologne, der den ganzen Hörsaal verpestet. Das Eau de Cologne ist bestimmt schon lange übers Verfallsdatum, vielleicht sogar schon giftig, aber Genosse (nach 1991 – Herr) Witali Ziklauri benetzt trotzdem beharrlich seine grau-grünlichen Wangen damit.
Eduard Schewardnadse ist jetzt seit einem Jahr Präsident Georgiens (bis dahin hatte er den Posten des Staatsoberhaupts inne). Im Land herrscht die totale Hungersnot. Unsere Hoffnungen ruhen auf Schewardnadses alten Freunden – dem deutschen Außenminister Hans-Dietrich Genscher und seinem US-amerikanischen Amtskollegen James Baker, die wie üblich für einen oder anderthalb Tage Georgien besuchen. Die Anhänger des vertriebenen ersten Präsidenten halten genau bei Bakers Ankunft eine Demonstration ab, um sich bei ihm über die Ungerechtigkeiten der neuen, ungesetzlichen Regierung zu beklagen. James Baker geht zusammen mit Schewardnadse in den großen Konzertsaal, wo der feierliche Kongress der Präsidentenpartei eröffnet werden soll, die Demonstranten kommen vom Bahnhof (von dort bis zum großen Konzertsaal sind es zwei Kilometer) und liefern sich auf dem Weg – auf dem Heldenplatz, in der Nähe des Zirkus, zwischen den zwei Hügeln der Stadt – Schusswechsel mit den quasi-staatlichen Kräften (halb Banditen, halb Kämpfer). Die Leute laufen auseinander, niemand weiß, wie viele getötet werden – manche sagen zwei Menschen, andere fünfzig, wieder andere nicht ein einziger (in Georgien waren offizielle Zahlenangaben immer schon mit Vorsicht zu genießen). James Baker eröffnet mit dem Präsidenten den Kongress. Er weiß nicht, dass in zwei Kilometern Entfernung vielleicht zwei bis fünfzig Menschen getötet worden sind.
Dieses Jahr wird im Hof des Obersten Rats ein Mordanschlag auf Schewardnadse verübt, doch wie durch ein Wunder kommt er mit dem Leben davon (innerhalb kurzer Zeit schon zum zweiten Mal; ihn werden noch weitere Terrorakte erwarten).
Das Land versinkt im Chaos, jedoch nicht in einem wie vor einem Jahr: Das diesjährige Chaos ist, verglichen mit dem Chaos der anderen Jahre, weniger chaotisch. Jeder hat eine Neurose, die in verschiedenen Formen verläuft. Bekannt ist der Versprecher des georgischen Verteidigungsministers Nadibaidse auf der Parade zur Unabhängigkeitsfeier am sechsundzwanzigsten Mai: »Ich gratuliere euch zu unserem vorzeitigen Feiertag!«
Keine Ahnung, welches Wort er statt »vorzeitig« eigentlich sagen wollte.
Minister Nadibaidse ist eine Mischung aus unserem Oberst Ziklauri und dem oft besiegten General Utscha Utschadse, der uns am letzten Tag des Semesters besucht.
Unser Utscha Utschadse redet ebenso eigenartig, er stottert, spricht die Wörter nicht zu Ende – nur einige Anfangsbuchstaben. Außerdem ist er beschwipst. Schon als er zu uns hereinkam, hatte er im Lehrerzimmer Schnaps getrunken, und keiner weiß, wie sich das auf sein Verhalten auswirkt …
Utscha Utschadse kommt in unseren Raum. Er scheint ein Typ zu sein, der normalerweise gut drauf ist.
Witali Ziklauri donnert wichtigtuerisch los: »Stillgestanden, zuhören!«
Doch schon beim zweiten Wort bricht seine Stimme ab, vielleicht würde er gleich noch loshusten. Ihm geht es schlecht, er ist es nicht mehr gewohnt, so herumzubrüllen.
Der besiegte General Utscha Utschadse steht am Tisch und nimmt die Mütze ab – er hat rote Wangen und nasses blondes Haar. Ein junger, dickbäuchiger Mann.
»Hallo, Jungs!«, schreit er (man hört nur die ersten Buchstaben Hal… Ju…)
Wir schauen stumm.
Ich habe das Geld der Truppe in der Tasche.
»Nun, schauen wir mal, wie gut ihr vorbereitet seid«, sagt er.
»Uh«, lacht oder stöhnt Oberst Ziklauri.
General Utscha Utschadse legt seine Mütze auf den Tisch. Er stützt seine mit blondem Flaum und bräunlichen Sommersprossen bedeckten Hände auf den Tisch und schaut uns aus müden grauen Augen an: »Nun, wie viel Mann sind eine Hundertschaft?«, ruft er.
Ach du Schande, weiß dieser Mann etwa nicht, dass wir nichts wissen?
Hätte ich das Bestechungsgeld dem Oberst etwa geben sollen, bevor Utscha Utschadse hereingekommen ist? Prinzipiell gehen mich die Hundertschaften nichts an, ich bin in einer Zwanzigschaft. Oder was ist das für eine Frage? Wie viele sollen denn eine Hundertschaft sein? Hundert wahrscheinlich. Nein? Aber warum fragt er uns, wenn es einfach hundert sind? Vielleicht sind sechzig Mann in einer Hundertschaft? Oder fünfundsechzig? Oder sogar zweihundert?
»Wie viel ist denn nun eine Hunderter Hundertschaft?«, wiederholt er die Frage. Seine Augen lächeln.
Macht General Utscha Utschadse einen Scherz?
Oberst Ziklauri schaut uns wütend an: »Gebt jetzt irgendeine Antwort! Keine alberne – eine ordentliche.«
Wann soll ich das Geld übergeben, Herr Witali?, frage ich mich.
»Hundert«, antwortet jemand leise.
»Oh, bravo«, sagt Utscha Utschadse und freut sich.
Ziklauri lächelt.
Wir freuen uns auch.
Doch plötzlich stellt er uns die nächste Frage: »Wenn Schießübung ist, sagen wir … Also, Waffen …«
Und er murmelt etwas. Wir verstehen nichts. Weder die ersten noch die letzten Buchstaben …
Er ist betrunken …
»Versteht ihr mich? Also, wer …«
Utscha Utschadse wird vor unseren Augen vom Suff übermannt.
Was sollen wir ihm antworten? Was hat er uns gefragt?
Er schaut uns an.
Wir sagen nichts.
Wir haben nichts gelernt, ein Jahr vertrödelt, den Krieg nur im Fernsehen gesehen – und auch das nur in Ausschnitten, denn während des Abchasienkrieges läuft ja die mexikanische Seifenoper im Fernsehen. Der Afghanistankrieg ist Geschichte, der Zweite Weltkrieg war vor unserer Geburt zu Ende.
»Gut, alles klar.« Utscha Utschadse schaut zu Ziklauri.
Was ist klar?
Wieder fragt er etwas, was wir überhaupt nicht verstehen (beim letzten Mal hatten wir wenigstens »Waffenausbildung« verstanden). Der Mann schwankt. Ist schläfrig. Fällt vielleicht um.
»Antworten!«, fordert er.
Er wird aggressiv.
Witali Ziklauri schaut uns an, rot im Gesicht: Sein Eau de Cologne stinkt noch mehr, vielleicht wird der Geruch durch die Nervosität verstärkt.
Wir können keine Antwort geben, aber Utschadse lobt uns trotzdem: »Gut, bravo« – er schaut zum Oberst – »das sind gute Jungs …«
Wir haben nichts gesagt, aber die Antwort gefällt ihm trotzdem.
Scheinbar weiß er, dass der Zugführer Geld für den Oberst in der Tasche hat, jedoch weiß er nicht, wer der Zugführer ist.
»Krieg und Kampf sind Männersa…«, sagt er (er spricht das Wort nicht ganz aus: entweder ist er zu faul oder unfähig), »Georgier …«
Und Schluss.
Der oft besiegte General Utschadse setzt die Mütze auf und salutiert uns. Niemand hat uns gelehrt, wie man einem General salutiert, wir haben das nur in Filmen gesehen. Eingepackt in einen Schal und eine dicke Jacke stehen wir da und schauen den oft besiegten General an. Kann doch sein, dass dieser betrunkene General uns einen Befehl gibt: »Stellt sie alle an die Wand, auf der Stelle!« Keiner könnte ihn aufhalten. Er hat so viele psychische Traumata. Über ihn heißt es, er sei durch den Enguri geschwommen, die Kalaschnikow hochgereckt, damit sie nicht nass würde. Von ihm sei nichts zu sehen gewesen außer dieser Kalaschnikow. Munition hatte er auch keine mehr. Als er von den Kriegsverbrechen der Abchasen und Russen erfuhr, habe er auf den Tisch geschlagen und im Befehlston gebrüllt: »Mobilisiert die Luftwaffe!«
Auch damals war er wahrscheinlich betrunken gewesen: Hatte Georgien etwa jemals eine Luftwaffe?
Aber jetzt ist er zufrieden. Diesmal salutiert er uns mit der linken Hand und geht hinaus auf den Flur. Oberst Ziklauri folgt ihm, gibt ihm Begleitschutz. Er zieht das Bein leicht nach, jedoch nicht aus Lahmheit, sondern Gehorsam. Als wolle er Mitleid erregen.
Der Unterricht ist beendet.
Der Oberst kommt wenig später zurück. Er ist zufrieden. Hat immer noch gerötete Wangen. Vielleicht hat er auch mit dem besiegten General getrunken. Oder nur am Schnaps gerochen. Er sagte einmal: »Ich trinke keinen Schnaps. Wenn mir danach ist, benetze ich mir die Finger damit und rieche daran.«
»Zugführer, zu mir!«, ruft er mich.
Die Studenten merken: Ich soll dem Oberst die Opfergabe für die Noten geben.
»Herr Witali«, sagt ein Student, »ich hab es nicht dabei, Entschuldigung. Ich hab vergessen, dass heute Abgabetermin ist.«
»Was hast du nicht dabei, mein Junge?« Dem Oberst entgleisen die Gesichtszüge.
»Das Geld«, antwortet der Student.
Das hätte er nicht sagen sollen. Geld hätte er nicht erwähnen dürfen. Hier hätte niemand von irgendetwas wissen dürfen – weder vom Salutieren noch vom Vorbereiten der Gefechtsstellungen noch davon, dass wir Oberst Ziklauri Bestechungsgeld gegeben haben. Wissen hat hier genau nichts zu bedeuten.
»Wie kannst du es wagen!«, schreit Ziklauri, und plötzlich: »Nichtsnutz!«
Au Mann, denke ich, jetzt beschimpft er ihn bestimmt noch weiter.
Und wenn er ihn beschimpft, was soll ich da machen, ich als Zugführer?
Ziklauri hört nicht auf: »Du Lump!«
Ziklauri ist ein unflätiger Mensch.
Und was sehe ich da: Der Student, der noch vor wenigen Sekunden beunruhigt war, weil er das Geld nicht dabeihatte, holt ein Messer aus der Tasche und sagt ein paar Worte auf General-Utschadse-Art, leise und unverständlich.
Jetzt gibt es Krieg. Ich bin dabei, als der Krieg in unserem Hörsaal ausbricht. Das ist ein Spiel mit dem Feuer. General Utscha Utschadse ist wahrscheinlich noch hier und kann dem Studenten, also meinem Truppenmitglied, und mir als Zugführer übel mitspielen. Utschadse ist zwar ein besiegter General, aber wir haben keinerlei Garantie, dass ihn unsere Truppe besiegen würde.
Der Student flucht leise, flüsternd, was noch viel unflätiger klingt als lautes Fluchen.
Oberst Ziklauris Gesicht nimmt eine grau-grünliche Farbe an …
Wird er einen Krieg vom Zaun brechen?
Oberst Ziklauri öffnet den Hosenknopf …
Was hat dieser Mann vor? Will er ihn auspeitschen?
Nein, er öffnet schnell den Reißverschluss …
Er steht seitlich, zieht die Hose leicht herunter und murmelt mit zitterndem Kinn vor sich hin: »Ich hab einen steifen Rücken, wegen euch kann ich kaum laufen …«
Oberst Ziklauri hat einen weiß-gelben Schal um den Rücken gewickelt … Ein alter, rückenschmerzgeplagter Mann …
Er tut uns leid.
Es bricht kein Krieg aus. Mein Truppenmitglied hat erfolgreich die Muskeln spielen lassen.
Das Geld wird mir später trotzdem abgeknöpft.
»Ach Mann«, sagt er und nimmt mir das Bestechungsgeld ab, »wir darben, was sollen wir machen? Die Zeiten sind nun mal so.«
Literarischer Abend. Die Rache am Geschichtsbuch
1992 begleitete ich meinen Vater zu einem literarischen Abend im ersten Gebäude der Staatlichen Universität.
Im Universitätsgebäude herrschte Eiseskälte, die Zuhörer waren eingehüllt in Mäntel und Pelze, die Männer – wenn nicht sogar alle Leute – trugen der damaligen Mode folgend unter der Hose noch eine Hose oder Unterhose, ganz zu schweigen von den Wollsachen, mit denen, wie böse Zungen behaupten, die geschickten Ehefrauen die intimen Körperteile ihrer Ehemänner umstrickten.
Es war egal, ob man im Gebäude war oder draußen, 1992, 1993, 1994 und 1995 herrschte überall die gleiche Eiseskälte. Erst recht in alten, hohen Gebäuden. In diesem Saal war schon seit Jahren nichts mehr passiert, was erwähnenswert gewesen wäre, wenn man vom spektakulären Auftritt des Philosophen Schawadse absieht, den dieser mit seinem Nachttopf auf der erweiterten Rektoratssitzung hingelegt hatte (jener Philosoph Schawadse, der den georgischen Philosophen ein dickes wissenschaftliches Werk hinterlassen hat: »Die Emanation des Lumpenpacks – wer ist wer in der georgischen Philosophie«). Der Philosoph hatte den Nachttopf geradewegs aufs Podium gestellt und sich laut an die dick in ihre Mäntel eingehüllten Professoren gewandt: »Das hier ist Scheiße, meine Herren, meine Scheiße, denn mehr haben Sie auch nicht von mir verdient! Hier, das ist Ihre Vergangenheit und das ist Ihr alter Ruhm!«
Als der Abend begann, fiel jedem diese Begebenheit ein, aber niemand hätte gedacht, dass auch ein Schriftsteller so etwas tun könnte. Die ehrwürdigen, durchgefrorenen Professoren, also die, denen noch der Geruch der Exkremente des Philosophen und Extremisten Schawadse in der Nase lag, besetzten Plätze in den vorderen Reihen und blickten mit skeptischer Miene (beziehungsweise mit einer, die damals alle hatten) auf den Autor umfangreicher Prosatexte, der auf der gleichen Bühne stand, auf die vor einigen Tagen der skandalöse Nachttopf gestellt worden war.
Zwar redete der Großteil der georgischen Bevölkerung obszön daher, aber öffentliche Obszönitäten waren noch nicht die Norm.
Zu jener Zeit war ich immer noch ein – objektiv betrachtet – sündloser Jugendlicher und hätte weder bestätigen noch abstreiten können, dass Sex in der Sowjetunion praktiziert wurde, aber wenn jemand das Wort Sex in den Mund nahm, konnte er in große Schwierigkeiten geraten und bekam die absurde Wut der Zuhörer zu spüren. Das würde jeder bestätigen, der seit den 30er-Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts bis in die Jahre 1992, 1993, 1994 und 1995 die Schule abgeschlossen hatte.
Und siehe da, plötzlich trat in einem Saal der Staatlichen Universität ein Redner auf und fing an, Texte zu lesen, in denen gleich im ersten Satz deutlich und höhnisch dieses Wort zu hören war: Ficken.
Dieses Wort vernahmen zuallererst die durchgefrorenen greisen Professoren in der ersten Reihe (manche hielten sich die Ohren mit dem Mantelkragen zu, manche zogen sich die dicke Mütze über den Kopf, und andere glaubten einfach, sie hätten sich verhört), aber der Text ging weiter und das Wort lag über dem gesamten Saal: Ficken. Ficken. Ficken.
Erst fing eine alte Frau in der Ecke an zu kreischen, dann stieß jemand in den hinteren Reihen eine Art Verwünschung aus, ein junger Glatzkopf. Wie eine Welle durchlief ein Krampf die erste Reihe, und diejenigen Zuhörer, die Ruhe bewahrt hatten, schauten sich um: Wieder Extremismus? Wieder Beleidigung? Was hat man mit uns vor?
Seufzer und aufgeregte Rufe waren zu hören. Wie Gewehrschüsse peitschten verbotene Informationen durch den Saal: Er hat diese gefickt, die hat jenen gefickt, und das wäre ja noch zu ertragen gewesen, hätte der Autor seine Obszönitäten nicht mit der erhabenen alten georgischen Sprache gemischt und uns verkündet, wer wen wo in Georgien fickte, als würde er ein in die Schulpflichtlektüre eingegangenes hagiografisches literarisches Denkmal lesen, zum Beispiel »Das Martyrium der Heiligen Schuschanik« aus dem fünften Jahrhundert.
Ein Aufschrei ging durch den Saal, mir schien, als wischte sich ein Mann Tränen aus den Augen (weinte er etwa?), einige klatschten Beifall … Der Autor rief uns von der Bühne aus zu: Ficken, Ficken, Ficken!
Sollte das schon erlaubt sein?
Meine Großmutter und ich waren einmal ins Kino gegangen, in einen Film, den die meisten schon mehrmals gesehen hatten, denn damals war es normal, sich Filme mehrmals anzusehen. Es lief »Es war einmal in Amerika«, den offenbar meine Großmutter im Gegensatz zu mir eigenartigerweise zum ersten Mal sah, und bei der Szene, in der Robert De Niro das tut, was der extremistische georgische Autor mit einem obszönen Wort beschrieb, hielt sie mir so lange die Augen zu, bis die verstörende Episode vorbei war. Die Szene zusammen mit meiner Großmutter zu erleben war auch für mich kein Vergnügen, und ich hätte deswegen einen Streit vom Zaun brechen und ihre Hände wegschieben können, aber das tat ich nicht, weil ich erstens Angst vor einem leichten Familienskandal hatte und zweitens begriff, dass ich beim Spiel meiner Großmutter mitmachen musste, um einander die Peinlichkeiten von Anfang an zu ersparen. Gott sei Dank hat sie mich nicht gebeten, die Finger in die Ohren zu stecken.
Als ich diese Begebenheit in ihrer Gegenwart meinem Vater erzählte, verteidigte sie, damit wir sie nicht der Verklemmtheit bezichtigten, ziemlich laut ihren Standpunkt und gab demjenigen, der es wissen wollte, zu verstehen, dass man schlau genug hätte sein sollen, seinen Enkeln beizeiten die Augen und Ohren zuzuhalten, »egal, ob sie so alt sind wie dieses Kind oder viel älter«, dann hätten sie sich nämlich nicht im Stil der Filmmörder gegenseitig auf der Straße umgebracht.
Diesmal musste mir keiner die Ohren zuhalten – die Leute rannten nur in Scharen aus dem Saal. Als ob da ein Mörder auf der Bühne stände!
»Worüber machst du dich lustig, du Missgeburt?«, schrie jemand vom Ende des Saales her. »Über unsere Geschichte? Unsere Sprache?«
Die, die dageblieben und nicht fluchend davongerannt waren, fühlten sich alle merkwürdig glücklich, dass diese furchtbaren Wörter im frostigen, schäbigen Saal der Universität so laut und kategorisch zu hören gewesen waren. Als hätten die jahrelang verbotenen Wörter und die Wut ihre Daseinsberechtigung wiedergefunden. Dabei hätte ich mich eigentlich unwohl fühlen müssen, wie kurz vor meiner Ankunft hier, als ich mich beim Wasserballtraining in der Umkleide verspätete (wahrscheinlich hatte ich mich mit dem Fuß in der Hose verheddert oder die Badekappe nicht rechtzeitig gefunden) und der Trainer mich so laut rief, dass es das ganze Schwimmbecken hören konnte: »Was ist los, hast du etwa gewichst?« Als Antwort verkündete ich am selben Tag zu Hause, nie wieder zum Wasserball zu gehen (das war sowieso nur die nächste Idee meiner Mutter nach dem Weg der heiligen Nino gewesen, und ich konnte es kaum erwarten, mich vor dem Ganzen wieder zu drücken). Meine Mutter interessierte es außerordentlich, was mein Lehrer denn zu mir gesagt haben könnte, ich konnte mir aber überhaupt nicht vorstellen, den Wortlaut in ihrer Gegenwart zu wiederholen. »Sag es deinem Großvater«, schlug sie am Ende vor (ich dachte, was drängt sich diese Frau mir denn so auf), aber auch ihm gegenüber fiel es mir schwer, die Frage des Trainers zu wiederholen, nur dass mein Großvater mit seiner ihm eigenen kompromisslosen Art den Trainer sogar noch übertraf: »Hat er ›Ich ficke deine Mutter‹ gesagt?«
»Nein …«
»Hat er ›Ich ficke deinen Vater‹ gesagt?«
»Nein, Opa …«
»Hat er ›Fickt ihr euch in den Arsch?‹ gesagt?«
»Oh Mann, natürlich nicht!«
Ich kapierte nicht mal seine Fragen.
»Was für einen Scheiß hat er denn zu dir gesagt?«
Damit dieser Albtraum von Befragung endlich endete, musste ich den Grund meiner Aufregung offenbaren, deshalb überwand ich mich und wiederholte deutlich die Bemerkung des Trainers.
Mein Großvater wurde nicht wütend, er gab nur einen kurzen, unklaren Kommentar ab oder eher einen Laut: »Oh.«
Schon komisch, aber während mich jenes gar nicht mal so skandalöse Wort vom Schwimmbecken noch in die Flucht geschlagen hatte, fesselte mich diesmal die mittlerweile legitime und rückhaltlose Obszönität, das hundertmal ausgesprochene verbotene Wort an den Stuhl und faszinierte mich zudem dermaßen, dass ich bedauerte, nicht anstelle des Redners auf der Bühne zu stehen. Offenbar waren wir nicht gekommen, um einen literarischen Abend, sondern einen Racheakt zu erleben. Es stellte sich heraus, dass wir ein tödliches verbales Raketenabwehrsystem hatten: die grausame und bis zur Krankhaftigkeit aufrichtige Sprache, eine Waffe, die sich der Geschichte der Unterdrückung entgegenstellte.
Niemand rührte den Redner an – es hätte ja jemand auf die Bühne stürmen und den Sprachbeleidiger mit einem Fußtritt runter in den Saal befördern können! Aber nein. Diejenigen, die dageblieben waren, schrien ihn an, ließen ihn aber bis zum Schluss lesen. Er harrte wie ein unantastbarer Heiliger vor einer riesigen Tafel aus (auf der ungeachtet dessen, dass es fast März war, geschrieben stand: »Liebe Studenten, wir wünschen euch ein gesundes neues Jahr«) und fuhr ungestört fort, uns zu beleidigen: »Ficken! Ficken! Ficken!«
Denjenigen, die flohen, war klar, dass sie den zeitgenössischen georgischen Schriftsteller ein für alle Mal hassen würden; diejenigen, die blieben, waren so beflügelt, dass sie kilometerweit zu Fuß bis nach Hause laufen würden (was sie wahrscheinlich sowieso hätten tun müssen, weil es keinen Nahverkehr gab).
»Mein Lieber«, mein Vater tippte dem Redner auf die Schulter, »das hier war ein längst überfälliger, ehrlicher Protest, eine der besten Aktionen der letzten Jahre! Hervorragend! Du siehst ja, wie die Leute durchdrehen! Die wachen erst auf, wenn die eine Ohrfeige verpasst bekommen.«
»Das war meine Rache«, erwiderte er und wischte sich mit dem Handgelenk über die verschwitzte Stirn, »Zahn um Zahn. Wir wollen doch kein Maschinengewehr in die Hand nehmen!«
Der Priester im Flugzeug. Februar 2002
Meine Tasche kommt aus der Röntgensicherheitskontrolle, ich stecke den Pass in die Hosentasche, fädele den Gürtel durch die Schlaufen und versuche, meinen Blick von dem schnaufenden georgischen Priester hinter mir abzuwenden, der von schwarz gekleideten, fülligen Frauen begleitet wird. »Megi, Megi«, der Blick des Priesters irrt umher, »wo ist mein Telefon?« – »Hier«, antwortet Megi, die ihre Schuhe hatte ausziehen müssen und nun mit blauen Tüten an den Füßen und abgespreizten Armen neben einer Grenzbeamtin steht. Megi hat in jeder Hand ein Telefon.
Ich lege schnell die georgische Sprache ab. Als ob ich nichts mehr verstünde und nichts mehr sähe. Ich muss mir was überlegen, damit mich dieser Mann nicht sieht. Er erinnert mich an meine Ängste eine Woche zuvor: an den dunklen Garten des Patriarchats, die schwach gelblich beleuchteten Flure und den Geruch von Weihrauch drinnen im Patriarchat. Ich fühle mich verfolgt. Ich denke: Wohin kehre ich zurück? Warum kehre ich zurück? Nach einer Weile sehe ich ihn zusammen mit einer zwei Köpfe kleineren Frau durch den Duty-free des Istanbuler Flughafens schlendern. Die dicke, agile Megi schreit durch den ganzen Flughafen: »Vater Bessarion, möchtest du Schokolade oder sonst was?« Nicht möchten Sie, sondern möchtest du. Wahrscheinlich sind sie zusammen zur Schule gegangen.
Ich komme aus Mailand, wohin ich sieben Tage nach meiner Nicht-Reue gefahren war. Ich habe kein Geld mehr beziehungsweise gerade so viel, um mir davon ein Wasser kaufen zu können. Unter fremden Leuten fühle ich mich ruhiger als unter meinen Landsleuten, die am Gate Istanbul–Tbilissi zusammengepfercht sind.
Ich besteige das Flugzeug, setze mich in die erste Reihe, Megi und die Frauen quetschen sich hinter mich. Diese Megi hat dicke Arme, sie stopft die Tasche eifrig ins Gepäckfach, Vater Bessarion möchte in der Businessclass sitzen.
Ein kleiner Vorhang trennt meinen Sitzplatz von seinem. Ich sehe, wie die Flugbegleiterin gekühlte Getränke reicht und er auf komische Art Alkohol verlangt: »Bitte, hier, Whisky.«
Danach schließt sich der Vorhang.
Ich stelle mich schlafend: Ich habe sogar meinen Mund leicht geöffnet, damit es glaubhaft wirkt.
Das Flugzeug rollt auf die Startbahn, die Besatzung ist angeschnallt, plötzlich steht eine alte Georgierin auf, öffnet das Gepäckfach und versucht, eine Tasche herauszunehmen. Die alte Frau wird zurück auf ihren Platz gesetzt. »Ich dachte, ich könnte vielleicht was essen«, sagt sie. Ihr Telefon ist ebenfalls nicht ausgeschaltet. Sie versteht weder in ihrer Mutter- noch in Gebärdensprache, dass Telefone nicht benutzt werden dürfen. Ich weiß jetzt schon, wenn sie es ihr am Ende doch begreiflich machen, wird sie sagen, sie wisse nicht, wie man das Telefon ausschaltet, und wird es weinend irgendwem in die Hand drücken: »Ich weiß es doch nicht, mein Sohn hat es mir gegeben.« Aber es gibt Schlimmeres als das, denn wir alle haben eine große gemeinsame Angst – vor einigen Monaten sind in New York zwei Flugzeuge in die Zwillingstürme gekracht, und jedes leicht unangemessene Verhalten kommt uns anormal und verdächtig vor. Die alte Frau wird auf ihren Sitzplatz verfrachtet, ich schließe die Augen, höre ihre Stimme – sie erzählt der jungen Frau neben ihr: »Fünf Jahre lang bin ich nicht in Georgien gewesen, mein Neffe ist gestorben, außer mir haben sie niemanden mehr, ich kümmere mich um meinen betagten Bruder …«
Sie ist selbst betagt.
»Meine Gute, kommen wir heute an?«
Offenbar sitzt sie zum ersten Mal in einem Flugzeug. Wie ist sie dann nach Istanbul gekommen? Wie hat sie es bis hierher geschafft? Oder wie kam sie überhaupt bis ins Flugzeug?
Ich versuche, nicht mehr darüber nachzudenken. Es kommt mir vor, als ob diese Frau noch größeren Unsinn von sich gibt: »Kommen wir von vorn oder von hinten angeflogen?«
Jemand berührt mich an der Schulter und schüttelt mich gehörig durch. Ich öffne die Augen, vor mir steht Vater Bessarion.
»Entschuldigung, hab ich dich geweckt?«, fragt er.
»Nein, nein.« Was soll’s.
»Falls du nicht müde bist, komm doch rüber nach dem Abendmahl, neben mir sitzt keiner. Ich hab’s schon den Mädels gesagt …«
In Flugzeugen gibt es ein Abendmahl?!
Vater Bessarion hat gerötete Augen und irgendwie unnatürliche, wie mit einem schmalen Pinsel aufgemalte, ängstlich hochgezogene Augenbrauen. Er spricht mit hoher Tenorstimme, aber nicht besonders laut. Die alte Frau schaut den unbekannten Priester liebevoll an, wahrscheinlich möchte sie auch ihm unbedingt erzählen, warum sie nach Georgien zurückkommt. Erzählen und sich segnen lassen … Gleich hier – im Gang der Economyclass. Ich ahne, dass meine Mitpassagiere mit Vergnügen eine Predigt von Vater Bessarion hören würden, der wie die Flugbegleiterinnen im Gang stehen könnte: »Flieget hin und werdet glücklich!«
Ich ärgere mich, dass ich parieren muss, dass ich wieder gehorchen muss, so wie ich schon diesen ganzen letzten Monat gehorcht habe, dass ich mich erneut darum drücke, Ja oder Nein zu sagen, und trotzdem stehe ich auf und folge ihm in die Businessclass, als ob ich vor seinem Sitzplatz die Beichte ablegen wollte.
Vater Bessarion schnallt sich flink mit zittrigen Händen an und vertraut mir mit zugekniffenen Augen und besorgt-müdem Gesicht seine Reisegeschichten an: Diese Megi und die anderen Frauen seien Mitglieder seiner Gemeinde, die via Istanbul nach Griechenland geflogen und jetzt aus Athen zurückgekommen seien, sie hätten an den Gräbern orthodoxer Heiliger gebetet und auch überdies allerhand erlebt, was er mir ausführlich erklärt. Dann erzählt Vater Bessarion von Megis Abenteuern. »Ein gutherziges Mädchen«, sagt er leise, »hat seinerzeit viel erreicht … hat eine Chance bekommen, auch finanziell, nur …«
Jedenfalls sieht es aus, als habe man ihr später alles weggenommen, denn nun stand ihr der Sinn nach einer Reise zu heiligen Gräbern.
»Sie schauen anders auf den Glauben … nicht so, dass sie sagen würden: Wo ist das Wunder, lass es mich berühren … Nein, so nicht … Wie Apostel Thomas den Finger in die Wunde legt, so in etwa.«
Vater Bessarion versucht sich umzuschauen, er will wissen, ob ihn jemand hört, aber er hat den Gurt so festgezogen, dass er sich nicht umdrehen kann oder ihm schlecht wird, wenn er sich bewegt. Plötzlich errötet er wieder. Stattdessen blicke ich mich um und schaue Megi an, die schon schläft, den Mund offen: Es gibt Menschen, die unheimlich schnell einschlafen. Genau so ein Mensch ist Megi.
»Hat sich dein Problem gelöst?«, fragt er mich, wartet allerdings meine Antwort nicht ab, sondern spricht weiter. »Ich hab mich dafür geschämt, was sie mit dir gemacht haben, das schwöre ich dir, aber ich konnte nichts sagen. Hätte ich sagen sollen ›Was macht ihr da? Gegen wen stellt ihr euch? Gegen die Künstler?‹«, richtet sich Vater Bessarion an einen unsichtbaren Gegner, der sich seiner Meinung nach irgendwo zwischen Cockpit und Toilette befinden muss.
Während Vater Bessarion redet, zeigt der Alkohol Wirkung. Manchmal hebt er die Stimme, dreht sich dann sogleich um und geht zum Flüstern über, ich vermute, er hat Flugangst, weil er, als eine Lampe plötzlich flackert, verwirrt erstarrt: »Was ist los, sollen wir die Kabine verlassen?«, sich dann aber beruhigt: »Nein, doch nicht … Da hat nur jemand die Stewardess gerufen.«
Ich möchte Vater Bessarion loben, weil er so ehrlich mir gegenüber ist. Es scheint, als würde er sich wirklich für irgendetwas schämen.
»Du warst damals mit deinen Freunden zusammen, und ich dachte: Die halten uns wahrscheinlich für Ewiggestrige, dabei konnte ich nichts sagen, weil man auch auf uns ein Auge hat: Diese Augen … In denen wütet ein großer Krieg. Ihr wisst es noch nicht, aber bald wird sich alles klären …«
Vater Bessarion nimmt ein Feuchttuch aus der Tüte und wischt sich zwischen den dicken, neurotisch zitternden Fingern herum.
»Wolltest du sie reizen?«, fragt er lächelnd. »Wolltest du Publicity?«
Ich tue so, als verstünde ich nicht, was er meint. Ich mag den Mann nicht, seinen vertraulich-ehrlichen Tonfall, ich möchte aufstehen und zu meinem Platz zurückgehen.
»Die Kirche will uns abwatschen, tja, was soll man machen, ihr müsst uns bloßstellen, beleidigen, diese Lügner beschimpfen … Aber weißt du, was alle stört? Dass ihr die beleidigt, die der Patriarch liebt. Ihn dürft ihr nicht anrühren, beschimpft uns, aber nicht ihn …«
Ich verstehe nicht, worauf er hinauswill, was für ein Typ er ist. Wahrscheinlich ist er einfach betrunken und plappert dummes Zeug. Oder hat Angst vorm Fliegen und will nicht alleine sitzen. Er wollte Megi nicht neben sich haben – wahrscheinlich hatte er sich die Geschichten der Frauen aus seiner Gemeinde schon zur Genüge angehört.
»Andere müsst ihr bloßstellen, die Pharisäer, in Wirklichkeit ist doch die Entwicklung schon im Gange, der Antichrist ist schon da, der Krieg der Zivilisationen bricht aus, warum will das keiner wahrhaben?«
Vater Bessarion spricht immer noch an die Ecke gewandt – die Lücke zwischen Toilette und Cockpit.
Am meisten ermüdet mich, erfolglos dem roten Faden seiner Rede zu folgen, der Priester springt mit vernichtender Schnelligkeit nicht nur von einem Thema zum anderen, sondern auch von einem Gemütszustand zum anderen: Gerade dachte man noch, er sagt etwas Passendes, und schon sagt er etwas Paranoides und lässt dich ratlos zurück. In seinem Kopf, den er jetzt ängstlich an die Lehne seines Sitzes drückt, herrscht ein völliges kulturell-religiös-sozialökonomisch-philosophisches Durcheinander, er könnte im Herzen sogar Atheist sein und sich nur in den turbulenten Zeiten wie ein Gläubiger benehmen.
Er ist doch ein Lieber, verängstigt und verwirrt, vielleicht möchte er gar kein Priester sein.
Und er ist offenbar auch noch eine Labertasche. Vater Bessarion lässt sich über die Konflikte innerhalb der geistlichen Hierarchie aus, beschimpft die Bischöfe, irgendwelche Leute, die nicht begreifen, wie unethisch es ist, manche Dinge auszusprechen, selbst in der Beichte: »Warum soll ich mir das Gefasel anhören!«, sagt er, lobt jedoch umgehend irgendeinen Mann, der eine Beichte abgelegt habe, die ihm bis heute nicht aus dem Kopf gehe. Ich bekomme das Gefühl, dass er mir dessen Geschichte erzählen will. Er merkt selbst nicht mehr, wovon er eigentlich erzählt, noch vor Kurzen hatte er zumindest seine Stimme im Griff, jetzt jedoch schreit er, wie er will und was er will: »Diese Schweine drängen uns zurück in die Sowjetunion, schaufeln den alten Bonzen das Geld in die Taschen und scheißen drauf, was ich will oder was du willst, was das Volk will. Sie häufen weiß Gott wie viel an und hetzen die Leute auf, währenddessen vermehrt sich ihr Geld und ihr Einfluss. Sieh mal, so was sagen die: Der Antichrist ist im Westen, Europa – die Wiege des Bösen! Wohin wollt ihr? Wollt ihr dorthin? Nun, ratet mal, wer die Sintflut überleben wird! Das orthodoxe Russland! Das neue Byzanz. Du solltest mal hören, was die in den Predigten für Sachen erzählen …«
Am Vorhang erscheint Megis Kopf, sie lächelt.
»Warum schreist du so, Vater Bessarion?«
»Was ist los, fühlt sich jemand gestört?« Sein Gesicht hellt sich auf.
Soll sich diese Megi doch zu dem Mann setzen und ihn beruhigen, so gut sie kann. Ich löse den Gurt, sage, ich müsse etwas schreiben, und stehe auf. Er fragt mich: »Wieder etwas Skandalöses?« Wir lachen. Plötzlich legt er die Hand auf mich: »Du hättest die Heilige nicht beleidigen dürfen. Das ist eine Sünde. Was die Ewiggestrigen sagen, ist das eine, in Wirklichkeit liegt das Problem ganz woanders. Warum sollte man mit der Sünde herumlaufen?«
Er hat wieder den Gemütszustand gewechselt, er wird zu einem anderen Mann.
Eigentlich sollte es mir zuwider sein, ist es aber nicht, und ich stelle die Frage, die ich diesen Monat fast täglich gestellt habe: »Haben Sie selbst meine Erzählung gelesen?«
»Ja«, erwidert er, aber ich bin sicher, dass er lügt.
»Wo habe ich etwas Beleidigendes geschrieben?«
»Du hast geschrieben, dass sie einen Hängearsch hatte. Das ist eine Sünde.« Vater Bessarion lässt nicht locker. »Das sollte dir leidtun, aber nur den ehrenhaften Leuten gegenüber, jenen gegenüber nicht … Vielleicht quassele ich jetzt viel, aber ich bin auf deiner Seite.«
Wer ist dieser betrunkene Mann, warum stehe ich hier bei ihm? Die Sache ist für mich schon seit einer Woche vorbei, doch ich lasse mir nichts anmerken, antworte nichts, lächle ihn furchtbar verlogen an und verabschiede mich fürs Erste.
Der Priester löst den Gurt – hoffentlich nicht, um sich zu geißeln (was für ihn zweifellos eine Heldentat ist) –, steht auf, wendet sich zu mir und flüstert mir ins Ohr: »Tu, was du willst, wem’s nicht gefällt, soll erst vor der eigenen Tür kehren.«
Perversionen. Februar 2002
Selbst ohne zu wissen, bei wem du zu Besuch bist, würdest du gleich beim Eintreten merken, dass hier Künstler wohnen. An den Wänden hängen große und kleine Gemälde, auf den Regalen und an allen Orten, wo Platz ist, liegen zahllose Bücher. Vom Fenster aus sind die Wendeltreppen und Holzbalkone des italienischen Hofes zu sehen. Man spürt, hier muss ein kleiner Hort der Kultur und des geistigen Lebens sein. Des geistigen Lebens?, wird der Leser fragen, denn entweder findet er diesen Begriff abgedroschen, oder er bringt ihn nicht mit unserem Gesprächspartner in Verbindung. Ist das etwa »geistiges Leben«, wenn ein junger Mann, der sich für einen Künstler hält, eine Episode aus dem Leben einer von den Georgiern verehrten Heiligen auf abstoßende Art und Weise beschreibt und generell die Geschichte in den Schmutz zieht? Oder sind wir einfach rückständig und halten das für Schmiererei, was für »solche Leute« Kunst sein soll? Unser heutiger Gast ist genau diese Person, die solche Fragen aufwirft und, ich übertreibe nicht, solche Empörung verursacht: ein dreiundzwanzigjähriger Mann, der aufgrund seiner skandalösen Erzählung in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt ist. Hier muss ich erwähnen, dass ich ihn ein paarmal im Fernsehen gesehen habe und er jedes Mal in mir den Eindruck eines arroganten jungen Mannes hinterlassen hat, in Wirklichkeit jedoch ein höflicher Mensch ist. Sein Vater hatte sein Atelier gleich nebenan und arbeitete dort an der Staffelei.
Ich habe unserem Gast Fragen gestellt, welche die Gesellschaft hinsichtlich seiner Person beschäftigen, und entschuldigte mich im Voraus, falls die eine oder andere davon inakzeptabel sei.
Sie: Deine Erzählung haben zwar nicht viele gelesen, aber der Text hat schon dermaßen großes Aufsehen und Ärger hervorgerufen, dass selbst im Parlament über eine Zensur diskutiert wurde. Es hieß, ein Schriftsteller dürfe nicht alles schreiben. Kannst du uns schildern, was du geschrieben hast?
Ich: Es ist ein satirischer Text über Königin Tamar und ihren ersten Ehemann, Juri Bogoljubski, der nach zwei Jahren Ehe auf ihr Geheiß aus Georgien vertrieben wurde. Diese Geschichte ist detailliert von Basili Esosmodsghwari, einem Chronisten im dreizehnten Jahrhundert, in seinem Werk »Das Leben der Königin und Herrscherin Tamar« niedergeschrieben worden. Der Historiker führt aus, wie ihre Tante und hohe Kirchenmänner einen Ehemann für die neunzehnjährige Königin auswählten. Königin Tamar hatte viele Bewerber – unter anderem natürlich im Byzantinischen Reich – doch fiel die Wahl auf den russischen Prinzen, den Sohn des Nowgoroder Großfürsten Andrej Bogoljubski, Juri, oder wie er in Georgien genannt wird, Giorgi. Komisch, dass man Prinz Juri auserwählte und keinen anderen, denn zur Zeit der Wahl gehörte ihm Nowgorod schon nicht mehr – die Großfürsten, die Bojaren, hatten seinen Vater, Andrej, umgebracht und verhinderten die Nachfolge Juris. Aber Tamars Tante Rusudan und andere, die großen Einfluss auf die junge georgische Regentin hatten, legten ein gutes Wort für Juri ein und, so schreibt Basili, verheirateten ihn mit Tamar. Tamar äußerte zwar Zweifel, ob es richtig sei, jemanden zum Mann zu nehmen, über den man so gut wie nichts wisse, beugte sich jedoch dem Willen der Mehrheit und willigte in die Heirat mit dem russischen Prinzen ein. Das ist eine aufregende und verworrene Geschichte, die viele Fragen aufwirft. Auch dürfen wir nicht vergessen, dass der Chronist Basili diese erst nach Tamars zweiter Eheschließung mit Dawit Soslani niederschrieb und deshalb dem ersten Ehemann gegenüber umso kritischer war. Sei’s drum, Juri Bogoljubski ist jedenfalls der erste Russe, den es nach Georgien verschlagen hat, und da beginnt die tragische Geschichte der russisch-georgischen Beziehungen. Am Ende enttäuschte Juri die Erwartungen der Georgier: Basili Esosmodsghwari zufolge habe sich dieser durch Sodomie versündigt und sei dem Suff verfallen, streitsüchtig und vollkommen untauglich für den Königsthron gewesen. Ich habe dem noch hinzugefügt, dass er in der ersten Nacht nicht in der Lage gewesen sei, seine ehelichen Pflichten zu erfüllen, und seine Lust auf andere Weise befriedigt habe.
Sie: In welcher Form?
Ich: Es ist eine Satire …
Sie: Verstehe ich, aber vielleicht tut das der eine oder andere von unseren Lesern nicht. Also wie nun?
Ich: Es ist die Geschichte des ersten Russen in Georgien. Eine politisch-literarische Allegorie über die Beziehung von Russland und Georgien. Mit Königin Tamar hat das nichts zu tun.
Sie: Das war keine Antwort auf meine Frage.
Ich: Welche?
Sie: In welcher Form Juri Bogoljubski sein sexuelles Verlangen in der Hochzeitsnacht befriedigt hat.
Ich: Haben Sie die Erzählung nicht gelesen?
Sie: Noch nicht, leider, aber ich verspreche dir, ich werde das auf jeden Fall tun.
Ich: Mir gefiel die Geschichte, der Stil, wie der Chronist die Geschichte beschreibt, und ich dachte mir, ich schreibe einen politischen Text über die historische Heirat im dreizehnten Jahrhundert.
Sie: Aber am Ende kam es so, dass du die von vielen verehrte Heilige verunglimpft hast.
Ich: Wie denn?
Sie: In der Hochzeitsnacht spielt sich ein schändliches Ereignis ab …
Ich: Basili Esosmodsghwari schreibt, dass sich Tamar von Juri geschändet fühlte.
Sie: Aber nicht Basili Esosmodsghwari, sondern du hast dir die Schlafzimmerepisode ausgedacht …
Ich: Woher wissen Sie das, wenn Sie meine Erzählung nicht gelesen haben?
Sie: Das wissen doch mittlerweile alle, man erzählt es sich eben …
Ich: Was erzählt man sich?
Sie: Man erzählt, in deiner Erzählung wird Juri Bogoljubskis sexueller Kontakt zu einer Henne beschrieben. Tja, jetzt hast du sogar mich dazu gebracht, es auszusprechen!
Ich: Ja, das hab ich mir ausgedacht, aber das ist keine Verunglimpfung von Königin Tamar …
Sie: Königin Tamar steht daneben und ist faktisch Augenzeugin. Denkst du nicht, dass hier, wo – komm, nennen wir die Sache beim Namen – so eine obszöne Episode beschrieben wird, die Anwesenheit einer Heiligen ein kleines bisschen blasphemisch ist? Viele haben das so gesehen.
Ich: Nun, weil sie es sieht, wirft sie ihn hinaus, aber Juri Bogoljubski versucht, auf den Thron zurückzukehren und sich auf die Seite von Tamars Widersachern zu schlagen. Diese Henne wird am Ende das goldene Ei legen, metaphorisch ausgedrückt.
Sie: Darf ich eine Frage stellen?
Ich: Klar.
Sie: Bist du in einer Beziehung?
Ich: Über persönliche Dinge spreche ich nicht.
Sie: Diese Frage steht im Zusammenhang mit unserem Thema.
Ich: Es interessiert Sie also, ob ich zoophil bin? Bin ich nicht. Ich bin in einer Beziehung.
Sie: Entschuldigung, aber ich muss dich das fragen: mit einem Mann oder einer Frau?
Ich: Was?
Sie: Hast du außergewöhnliche Vorlieben? Es interessiert die Öffentlichkeit.
Ich: Was hat das damit zu tun?
»Wieso hat das nichts damit zu tun?« Mein Vater platzte herein, er war offenbar irgendwo in der Nähe gewesen und hatte uns belauscht. »Sag einfach Nein, antworte einfach, was eierst du rum, Mann!«
Das Interview brach ab.
»Die Frage war wohl schlecht formuliert, Entschuldigung«, rechtfertigte sich die Journalistin, »ich verehre Sie beide so sehr …«
»Warum sagst du ihr nicht, dass du heterosexuell bist?« Mein Vater konnte seine Verwunderung nicht verbergen. Der Arme verschluckte sich (er war wohl gerade dabei, sein geliebtes Maisbrot zu essen, als er das provokante Interview mitbekam und die Hände am Schnurrbart abwischte). »Also wirklich, was ist das denn für eine Frage? Warum antwortest du so ausweichend?«
Meiner Meinung nach eierte ich überhaupt nicht herum, ich wusste bloß nicht, wie ich reagieren sollte – sollte ich ernsthaft beteuern, dass Juri Bogoljubski und ich keine ähnlichen Vorlieben hätten? Erstens hatte ich solch eine dumme Journalistenfrage nicht erwartet, zweitens genierte ich mich, über dieses Thema zu reden, und drittens stellte ich mir plötzlich vor – genauer gesagt, der Snob in mir stellte sich vor –, was meine schwulen Bekannten sagen würden, wenn sie dieses Interview lesen würden. Meine Güte, Vater, dachte ich verärgert, ich bin doch liberal, was hat das mit Heterosexualität zu tun, konntest du dir nicht denken, in welchem Kontext sie mich das fragt? Ich sollte mir wohl eine richtige Antwort ausdenken, überlegte und sagte schließlich irgendwie mehr zu mir selbst: »Nein, beziehungsweise jawohl, ich bin heterosexuell, aber warum erwähnen Sie Schwule in so verächtlicher Weise?«
Ich sagte das sogar so laut, dass die Journalistin es tatsächlich hörte, aber sie schrieb meine Worte nicht mal auf.
»Mach die Sache doch nicht komplizierter, als sie ist!« Mein Vater regte sich noch mehr auf: »Merkst du nicht, was die wollen? Die wollen dir jetzt alles Unglück in die Schuhe schieben und damit die verwirrten Leute noch mehr zur Weißglut bringen. Damit, dass du angeblich ein Schwuler bist, ein Pädophiler, ein Zoophiler und ein Serienmörder!«
»Gute Güte, was erlauben Sie sich …« Die Journalistin tat betroffen. »Ich möchte meinen Interviewpartner möglichst objektiv darstellen, warum sollte ich es sonst wagen, solche Dinge zu fragen.«
Was mir noch mehr Sorge bereitete, war, dass die frischgebackenen ein, zwei Liberalen, die mich in der Sache zu verteidigen versuchten, kaum zufrieden wären, wenn sie lesen würden, dass mein Vater »alles Unglück« der Homosexualität zuschrieb.
»Sei nicht besserwisserisch, ich bitte dich! Weißt du, was die als Überschrift nehmen werden?!«, rief mein Vater.
»Du meine Güte, nein«, flötete die Journalistin, sie schien nun wirklich betroffen.
Plötzlich öffnete sich unbemerkt die Tür, und Ani schaute ins Zimmer – diejenige, die mich normalerweise bei Journalisten mahnte, ich solle nicht zu viel darüber nachdenken, ob eine Antwort ausgewogen und diplomatisch sei. Sie machte ein verängstigtes Gesicht, wahrscheinlich, weil meine laute Stimme bis auf den Flur zu hören war.
»Sieh mal einer an, seine Freundin! Schau!« Mein Vater lief Ani entgegen. »Schaut sie euch an! Ist sie ein schlechtes Mädel?«, und er wandte sich ihr zu: »Bist du ein Mann oder eine Frau?«
»Oh, Sie sind so süß!«, flötete die Journalistin.
»Sie soll dir sagen, ob sie ein Mann oder eine Frau ist!« Mein Vater ließ nicht locker.
»Eine Frau, allerdings mit dem Charakter eines Mannes«, sagte ich.
Nach einem Monat Schlaflosigkeit, dem Hin und Her und der Flucht aus dem Patriarchat, dem Untertauchen, den ausgesprochenen und unausgesprochenen Entschuldigungen, den erschöpfenden und zermürbenden Missverständnissen und dem allumfassenden Stress, benahm sich kein einziger von uns angemessen. Zu dieser Zeit sahen wir überall Feinde und Verschwörer.
Ani nahm so etwas wie eine Kampfpose ein, weil sie dachte, ich hätte jetzt eine Auseinandersetzung mit der Journalistin und müsse verteidigt werden, obwohl diese sich so oft für die »unbedacht gestellte Frage« entschuldigte, dass sie mir plötzlich mit Vorwürfen kam (sie war schon auf Krawall gebürstet, und mit irgendwem musste sie sich ja anlegen): »Nun, aber (so fing sie an), hättest du dir nicht im Voraus die Fragen geben lassen können, damit du hier keine unbedachten Antworten geben musst?«
»Ich konnte ja auch nicht ahnen, dass mein Vater hereingeplatzt kommt!«, sagte ich wütend.
»Soll er doch sagen, warum ich hereingeplatzt bin!«, schrie mein Vater los.
»Bitte nicht streiten wegen mir, bitte!« Die Journalistin wäre wohl am liebsten gegangen.
»Ich bin gleich wieder weg«, sagte mein Vater und ging zur Tür, »aber schreiben Sie jetzt bloß nicht, wie ich hereingeplatzt bin.«
»Wie könnte ich.« Die Journalistin war zerknittert, wie auch unser »Angriff« ihren Blazer über dem Bauch zerknittert zu haben schien (irgendwie sah er plötzlich schäbig und lumpig aus), der Mantel war sogar auf den Boden gefallen.
Ich hob den Mantel auf, hängte ihn über den Stuhl und schloss hinter meinem Vater die Tür.
»Was haben Sie denn so Schlimmes gefragt?«, wandte sich Ani an die Journalistin.
»Ob du etwa zoophil bist«, antwortete ich.
»Jetzt schiebt nicht mir die Schuld in die Schuhe, so hab ich nicht gefragt«, plapperte die Journalistin laut los. Man konnte nicht erkennen, was in ihr vorging, ihr Gesichtsausdruck wechselte von einer Emotion zur nächsten. Wahrscheinlich dachte sie, sie sei bei einem Psychopathen gelandet (Nicht dass er mich einsperrt und mir etwas antut!).
»Sollen wir weitermachen?«, fragte sie mich. »Solche Fragen stelle ich nicht mehr, versprochen.«
Ani zog die Augenbrauen hoch, nach dem Motto »Wen hast du da nur reingelassen?«, und setzte sich irgendwohin: Weder konnte sie gehen noch wollte sie zu meinem Vater hinaus.
»Machen wir weiter«, sagte ich.
Die Journalistin drückte auf den roten Aufnahmeknopf.
Sie: Was ist passiert, kannst du mir das erklären? Sag mir wenigstens, warum die Leute so wütend auf dich sind.
Ich: Diese Leute sind immer auf alles wütend. Im Voraus. Sie wollen Blut sehen.
»Das dürfen Sie nicht drucken!«, rief mein Vater uns aus seinem Atelier zu.