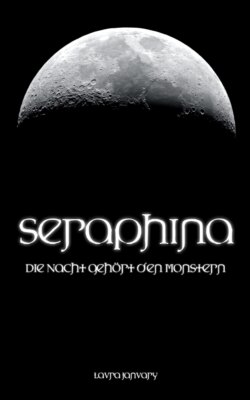Читать книгу Seraphina - Laura January - Страница 6
02 – Das Mädchen und der Wolf 02 - Das Mädchen und der Wolf
ОглавлениеAls mein Bewusstsein allmählich zurückkehrte, spürte ich zuallererst, wie ich hin und her schaukelte, wie bei leichtem Wellengang. Und ich befand mich in einer Position, die alles andere als angenehm war.
Ich hing über einer stabilen, aber gleichzeitig weichen Kante, die unaufhörlich schwankte und mich dabei ebenfalls bewegte. Sie drückte mir in den Bauch, was vermutlich der Grund für das flaue Gefühl in meinem Magen war. Meine Beine wurden durch irgendwas festgehalten, und mein Unterbewusstsein verriet mir, dass das der einzige Grund war, weshalb ich nicht sofort von der Kante rutschte.
Ich wollte die Augen öffnen, wollte wissen, wo ich war. Doch ich wusste, sobald ich die Augen öffnen würde, würde ich mich an etwas erinnern, dass jetzt noch in irgendeinem Winkel meines Gedächtnisses schlummerte.
Aber irgendwann musste ich die Augen öffnen. Also ließ ich meine Neugier die Oberhand gewinnen.
Ich blinzelte und hatte ein schwarzes T-Shirt direkt vor meiner Nase. Ich schaute nach oben, da ich kopfüber hing wohl eher nach unten, und entdeckte außerdem ein Paar Beine, die in einer dunklen Jeanshose steckten. Sie bewegten sich über eine gepflasterte Straße und mein Gehirn funktionierte wieder in so fern gut genug, um zu begreifen, dass die Kante, über der ich hing, eine Schulter war. Und das, was meine Beine festhielt, war vermutlich ein Arm. Irgendein Fremder hatte mich über seine Schulter geworfen und lief mit mir durch eine dunkle Gasse.
Und in dem Moment stürzte meine Erinnerung über mich herein. Der Vampir, sein Betrug und, am schlimmsten, sein Gift.
Von dem Grauen der Erinnerung beherrscht, fing ich sofort wieder an, zu schreien und strampelte mit übermenschlicher Kraft gegen den Griff des Fremden an. Überrumpelt ließ er mich los und ich versuchte sofort, wegzurennen, doch ich kam nicht weit, ehe ich über meine eigenen Füße stolperte und der Länge nach hinfiel. Ich hatte diese verfluchten Schuhe also immer noch an, und jetzt würden sie Schuld an meinem Tod sein. Ohne einen Blick auf das unbekannte Grauen hinter mir zu werfen, rappelte ich mich auf und wollte weiter rennen, doch da legte sich plötzlich ein warmer Arm um meine Mitte und eine Hand wurde auf meinen Mund gedrückt. Ich schrie meinen Frust in die Hand hinein und stemmte mich gegen die Umklammerung, doch wie schon zuvor bei dem Vampir war ich hoffnungslos unterlegen.
Also versuchte ich es mit einer anderen Taktik. Ich ließ mich zurückfallen und machte mich so schwer, dass er einen Schritt nach vorn stolpern musste, um weiterhin seine Arme um mich zu klammern. Ich nutzte seine Überraschung und versuchte mich aus seinem Griff zu winden, was ihm ein leises Ächzen entlockte. Doch er hatte meine Absicht schon viel zu bald erkannt und zog mich wieder hoch, wobei er mich diesmal so fest an sich presste, dass mir absolut kein Aktionsspielraum blieb.
„Hey, beruhige dich! Bitte, ich will dir doch nichts tun!“, rief eine tiefe Stimme eindringlich an meinem Ohr. Ich glaubte ihm nicht so schnell, allerdings hatte ich keine Chance gegen ihn und verletzte mich bei meinem Fluchtversuch nur selbst. In einigen meiner Wunden steckten noch immer Glassplitter und mein Kopf pochte wie verrückt. Ich ließ locker und versuchte erneut, ihn mein ganzes Gewicht spüren zu lassen, doch diesmal war er darauf gefasst und hatte mich besser ausbalanciert, wodurch er mich mit seinen übernatürlichen Kräften kaum zu spüren schien.
„Ich nehme jetzt die Hand von deinem Mund, in Ordnung? Du würdest mir wirklich einen großen Gefallen tun, wenn du nicht schreien würdest, sonst machst du nämlich die falschen Leute auf uns aufmerksam“, sagte er mir. Dann nahm er seine Pranke aus meinem Gesicht und wartete meine Reaktion ab.
„Lass mich los!“, verlangte ich. Augenblicklich riss er den Arm weg, als stünde ich plötzlich unter Strom und er hätte einen Schlag bekommen. Ich brachte sofort Sicherheitsabstand zwischen uns und fuhr zu ihm herum. Doch die schnellen Bewegungen ließen Schwindel in mir aufsteigen und ich konnte gerade noch einen Schritt zur Seite machen, ehe ich gefallen wäre. Mein Kopfschütteln ließ mich kurz die Orientierung verlieren. Verdammt, wie viel Blut hatte ich denn bitte verloren?
„Tut mir leid, ich wollte nur nicht, dass du wegrennst. In deiner Verfassung ist das keine gute Idee, außerdem befindest du dich immer noch im Gebiet der Übernatürlichen“, entschuldigte der Mann sich. Daraufhin sah ich ihn zum ersten Mal direkt an, darum bemüht, nicht so schwach zu erscheinen, wie ich mich gerade fühlte. Er war eine imposante Gestalt. Trotz meiner hohen Schuhe überragte er mich noch immer um einige Zentimeter, wobei er jedoch nicht schlaksig, sondern muskulös aussah. Alles an ihm war irgendwie dunkel, seine Kleidung, seine Haut, seine Augen und auch seine Haare, die ihm wirr vom Kopf abstanden, als wäre er gerade erst aufgestanden. Oder als hätte er gekämpft. Ich erkannte einige Narben auf seinen Armen, die von tiefen Wunden stammen mussten. Und einen frischen Kratzer, dem ich ihm wohl zugefügt haben musste. Selbst in seinem Gesicht befand sich eine Narbe auf der linken Wange. Seine markanten, aber dennoch hübschen Gesichtszüge waren besorgt verzerrt und betrachteten mich ebenso eindringlich, wie ich ihn.
Schließlich räusperte er sich und fragte: „Wie geht es dir?“ Seine Stimme hatte einen rauchigen Klang, der mich aus irgendeinem Grund an Lagerfeuer-Erlebnisse aus meiner Kindheit zurückerinnerte.
Ich zögerte noch einen Augenblick mit meiner Antwort, ehe ich schließlich den Mund aufmachte. „Ich bin nicht tot“, stellte ich fest, doch es war auch eine Frage. Warum war ich nicht tot?
„Nein, bist du nicht, Glück gehabt...“ Er lächelte unsicher und seine Haltung entspannte sich ein wenig. Offenbar glaubte er, dass ich keinen weiteren Fluchtversuch starten würde. Vermutlich würde ich auch nach den ersten drei Metern desorientiert umfallen. Ich konnte mich ja kaum auf den Füßen halten. „Du hast so laut geschrien, dass ich mit sonst was gerechnet hatte, als ich da reingeplatzt bin. Was ich gesehen habe, hat mich überrascht. Normalerweise reagieren Menschen... anders auf Vampirbisse.“ Er warf mir einen prüfenden Blick zu und ich hob ahnungslos die Schultern.
„Das hat er auch behauptet, aber...“ Ich wich seinem Blick aus, damit er die Angst in meinem Blick nicht sehen konnte und schlang die Arme um mich selbst, um die Kälte zu verdrängen. „Es hat sich für mich eher so angefühlt, als würde man meine Adern mit Feuer ausbrennen.“
Der Mann nickte nachdenklich, wirkte jedoch so, als hätte er sich das schon gedacht. „Du bist doch aber keine Übernatürliche, oder?“, fragte er nach.
„Wenn ich das wäre, hätte ich wohl kaum mein Blut verkaufen wollen.“ Ich stolperte über meine eigenen Worte und mir fiel etwas ein. „Oh. Verdammt!“
„Was ist los?“
„Ich hab das Geld nicht! Der Typ hat mich verarscht! Ich habe Höllenqualen erlitten, nur um genauso arm zu sein wie vorher!“, rief ich entgeistert. Ich wühlte durch meine wirren Haare und schaute verzweifelt hinter den Fremden, als würde der Vampir dort mit meinem versprochenen Geld stehen und winken.
„Naja, du lebst noch. Das können nicht viele von sich behaupten, wenn sie so einen Angriff hinter sich haben. Und was die Höllenqualen angeht... Wenn du mit in meine Wohnung kommst, könnte ich dich verarzten. Wenn... wenn du willst“, bot der Fremde mit einem sanften Lächeln an. Doch meine Naivität war mir schon einmal teuer zu stehen gekommen.
Sofort wieder misstrauisch geworden sah ich ihn skeptisch an. „Du bist doch auch Einer, oder? Ein Übernatürlicher. Natürlich, sonst hättest du gegen den Vampir doch keine Chance gehabt!“ Ich hatte es ja schon gemerkt, als ich mit ihm gekämpft hatte. Eigentlich war die Frage vollkommen überflüssig.
Er sah ertappt aus und lächelte entschuldigend. „Ich wollte dir das eigentlich ersparen, nachdem du fast von einem Vampir getötet worden wärst...“, erklärte er. Hatte er wirklich gedacht, es wäre nicht offensichtlich?
„Bis jetzt hast du noch nicht versucht, mich zu töten, so schlimm kann es ja nicht sein. Was bist du?“, fragte ich. Ich bemühte mich, aufgeschlossen zu wirken, obwohl ich eigentlich am liebsten 100 Kilometer Abstand zu allen Übernatürlichen hätte. Aber es war besser, zu wissen, mit wem man es zu tun hatte. Auch, wenn ich gegen niemanden eine realistische Chance hätte.
„Ein Werwolf“, sagte er und verzog das Gesicht, als würde er sich schämen.
„Okay, könnte schlimmer sein“, rutschte es mir eine Spur zu ehrlich heraus. Doch anhand seiner Reaktion vermutete ich, ihn nicht beleidigt zu haben.
„Ach echt? Ich dachte jetzt, du würdest ausflippen! Schließlich sind die meisten Morde an Menschen durch Übernatürliche auf unser Konto gegangen. Wir sind die instinktgesteuerten Monster, die nichts als Tod und Schmerz bringen.“ Seine Stimme war von Schmerz und Selbsthass geschwängert, als er die Worte ausstieß. Sein Ausdruck traf mich unerwartet hart und ich konnte nicht anders, als plötzlich Mitgefühl zu empfinden. Er wird es sich nicht ausgesucht haben, in einen Werwolf verwandelt worden zu sein. Wenn nicht gerade Vollmond war, war er genauso wie ein Mensch – und er musste sich mit dem Wissen auseinandersetzen, dass er ein Mörder sein konnte. Aber die Gewissheit fehlte ihm immer.
„Tja, jetzt gerade bist du nur ein Mensch“, erklärte ich überflüssigerweise, während ich im Himmel nach dem eiförmigen Mond suchte. „Und in dieser Gestalt unterscheidest du dich nur durch deine Stärke und die besseren Sinne von uns anderen. Und bis Vollmond sind es ja noch ein paar Tage.“ Ich wusste nicht, ob ich ihn oder mich selbst davon überzeugen wollte.
Wieder schnitt er eine Grimasse, als er mich berichtigte: „Vollmond ist übermorgen. Und die erste Verwandlung ist schon morgen.“
„Hm. Wie die Zeit schon wieder vergeht.“
„Willst du trotzdem mitkommen?“
„Wohin nochmal?“
„Zu mir“, erklärte er verlegen. „Ich hab einen Verbandskasten daheim und weiß dank jahrelanger Erfahrung auch, wie man mit Wunden am besten umgeht.“
Ich sah ihm kritisch entgegen und schürzte die Lippen. Die Wahrheit war, dass ich mir in meinem derzeitigen Zustand kaum zutraute, den Weg bis nach Hause zu schaffen. Am liebsten hätte ich mich hingesetzt, aber ich wollte vor dem Werwolf auf keinen Fall schwach wirken.
„Ich weiß nicht so recht...“, murmelte ich unsicher. Denn einen zweiten Übernatürlichen, der sich in irgendeiner Art und Weise über mich hermachen wollte, konnte ich auf keinen Fall gebrauchen. Zugegeben, würde der Mann vor mir mich umbringen wollen, könnte er das wohl sofort tun, ohne mich erst in sein Haus locken zu müssen. Und wenn ich ihn wegschickte, stieg dadurch wohl eher die Wahrscheinlichkeit, von anderen Übernatürlichen angegriffen zu werden.
Eindringlich musterte ich ihn. Gerade war er ein Mensch, aber bedeutete das auch, dass er sich menschlich verhielt? Würde ich mit ihm gehen, wenn er kein Monster war?
Meine Antwort schien ihn nicht gerade zu begeistern, aber er sah auch nicht überrascht aus. Vermutlich hatte er schon damit gerechnet, abgelehnt zu werden. „Ist schon klar, ich bin der große böse Wolf“, machte er einen halbherzigen Witz. „Aber in deinem Zustand würde ich dich nur ungern allein lassen. Hast du jemanden, den du anrufen kannst, um dich abzuholen?“
„Ähm...“ Meine Gedanken schweiften zu Phoebe, aber ich würde sie ungern mitten in der Nacht mitten ins Gebiet der Übernatürlichen herbestellen. Doch als ich nach meinem Handy suchte, um in meinen Kontakten nachzusehen, wen ich sonst vielleicht anrufen könnte, fand ich es nicht. Bis ausgerechnet er es mir hinhielt.
Überrascht sah ich auf, woraufhin er entschuldigend mit den Schultern zuckte.
„Ich hab vergessen, dass ich es selbst eingesteckt hatte, tut mir leid.“
„Alles gut“, erwiderte ich. Immerhin hatte er es überhaupt mitgenommen. Andernfalls läge es wohl immer noch in der Lagerhalle. Ich nahm es ihm ab, doch als ich den Bildschirm anschalten wollte, blieb dieser schwarz.
„Ich glaub, der Akku ist alle“, meinte ich. Zumindest hoffte ich, dass es nur am Akku lag und mein Handy nicht tatsächlich kaputt war.
„Also... kann dich niemand abholen?“, hakte er nach.
Ich schüttelte langsam den Kopf. „Aber das geht schon. Ich finde auch alleine nach Hause. Danke nochmal“, murmelte ich und wollte mich schnell umdrehen, doch dabei war ich wohl etwas zu schnell. Ich schwankte und spürte schon, wie ich zur Seite kippte, ehe mein Fall plötzlich gebremst wurde. Verwirrt stellte ich fest, dass es erneut der Werwolf war, der mit unmenschlicher Geschwindigkeit zu meiner Rettung geeilt war. Wieder einmal.
„Danke“, wiederholte ich. „Du kannst mich wieder loslassen.“
Er stellte mich vorsichtig zurück auf die Füße, sah mich aber weiterhin besorgt an. „Ich will wirklich nicht aufdringlich wirken, aber so kann ich dich nicht mit gutem Gewissen gehen lassen.“
„Wieso? Du hast schon genug getan, wirklich. Ich will dich nicht weiter behelligen“, behauptete ich. Vor allem traute ich ihm aber nicht weiter, als ich ihn werfen konnte. Gemessen an der Tatsache, dass er über zwei Meter groß und ein Schrank von einem Mann war, war das dementsprechend nicht sehr weit. Er war eben ein Werwolf und ich nur Hundefutter.
„Okay, wenn du zehn Meter geradeaus gehen kannst, ohne zu wackeln oder umzufallen, glaube ich dir.“ Er verschränkte die Arme und sah mich herausfordernd an. Ich starrte ungläubig zurück. Für wie schwach hielt der mich eigentlich?
„Gut, wir haben einen Deal.“ Selbstbewusst, aber auch betont langsam, trat ich einen Schritt zurück und fixierte die dunkle Straße vor mir. Wie schwer konnte das schon sein? Ich war mein ganzes Leben lang geradeaus gelaufen. Doch jetzt schien mir die gerade Straße, die mit Müll und Glasscherben übersät war, wie ein unüberwindbares Hindernis. Ich wollte einfach nur nach Hause und schlafen.
Doch ohne mir meine Gedanken anmerken zu lassen, straffte ich die Schultern und machte die ersten Schritte. Er folgte mir langsam, ohne dabei ein Geräusch zu verursachen, während ich wie ein Elefant in einem Porzellanladen herumpolterte. Ich konnte auf diesen Schuhen einfach nicht laufen, da half es auch nicht, dass sie mir eine Nummer zu klein waren und meine Zehen zerquetschten. Die ersten Meter waren geschafft, obwohl die ganze Zeit über schwarze Punkte vor meinen Augen tanzten und sich eine Art Druck in meinem Ohr aufbaute. Doch ich war wild entschlossen, die zehn Meter zu schaffen, also ging ich immer weiter.
Als ich mein Ziel endlich erreicht hatte, ließ ich mich erleichtert in die Hocke sinken, wo ich dann doch noch das Gleichgewicht verlor und auf meinen Hintern plumpste. Der Werwolf sah auf mich herunter und ich erwiderte seinen Blick so würdevoll wie möglich.
„Ich mache nur eine kleine Verschnaufpause“, rechtfertigte ich mich.
„Okay, das reicht, ich nehme dich mit.“
Eine weitere Vorwarnung bekam ich nicht. Zu schnell, als dass mein übermüdetes Hirn hätte reagieren können, hatte er sich über mich gebeugt, hochgenommen und erneut über die Schulter geworfen, als wäre ich nicht schwerer als ein Handtuch. Einen Moment lang war ich wie erstarrt, doch dann begann ich mit Fäusten gegen seinen Rücken zu trommeln, als er sich wieder in Bewegung setzte.
„Lass mich sofort wieder runter!“, zischte ich schließlich empört, zu überrascht, als dass sich Panik in mir hätte ausbreiten können.
„Ach komm, vorhin hat es dir doch auch nichts ausgemacht!“, antwortete er nur belustigt.
„Vorhin war ich ohnmächtig!“, entkräftete ich seine Behauptung.
„Okay, guter Punkt. Aber wenn ich dich hier so auf der Straße hocken lasse, bin ich mir ziemlich sicher, dass du den Ärger schneller anziehst, als uns beiden lieb ist. Deshalb helfe ich dir jetzt, ob du willst oder nicht.“
„Ich glaube, das nennt man Kidnapping.“
„Zeig mich doch an.“
„Ich weiß ja nicht einmal, wie du heißt!“
„Adam“, stellte er sich damit vor. „Adam Miles, wenn du es genau wissen willst. Aber meine Papiere sind wohl vor einigen Jahren abgelaufen. Und du bist?“
„Zu schwer, um die ganze Zeit von dir getragen zu werden!“, quengelte ich. „Lass mich doch wenigstens selbst laufen“, wollte ich verhandeln.
„Im Ernst, auch wenn ich dich trage, sind wir immer noch zehnmal schneller bei meiner Wohnung, als wenn du im Dunkeln so rumstolperst wie eine Babygiraffe, die gerade das Laufen lernt“, lehnte er ab.
„Wie eine Babygiraffe?“, hakte ich entrüstet nach.
„Weil du so groß bist“, erklärte er gut gelaunt.
„Sagt der, der so groß wie ein verdammter Blauwal ist“, brummte ich mürrisch.
Ich spürte seinen Brustkorb vor Lachen leicht vibrieren und musste unwillkürlich ebenfalls grinsen, ehe ich meine Mundwinkel wieder unter Kontrolle brachte. War er nicht ein bisschen zu gut gelaunt? Das hier war schon eine Entführung, streng genommen.
„Verrätst du mir jetzt vielleicht auch, wie du heißt?“, nahm er einen zweiten Anlauf, um meinen Namen herauszufinden. Ich gab mich mit einem Seufzen geschlagen.
„Seraphina. Aber eigentlich nennt mich jeder nur Sera.“
„Freut mich, dich kennenzulernen, Sera.“
„Hmpf. Gleichfalls, Adam“, erwiderte ich leicht mürrisch und brachte ihn damit erneut zum Lachen. Sein Gang schien durch mich in keiner Art und Weise beeinträchtigt zu sein, und das erinnerte mich an eine Frage, die ich noch stellen wollte. Es konnte kaum schaden, ein bisschen was über ihn herauszufinden, wenn ich schon in dieser Situation steckte. Wenn ich schon über dem Rücken eines Fremden hing, konnte ich die Zeit wenigstens sinnvoll nutzen.
„Wie stark sind Werwölfe eigentlich? Ich meine, wenn du sogar einen Vampir besiegen konntest...“ Ich ließ den Satz in der Luft hängen und hoffte, dass er ihn aufgreifen würde.
„In den Nächten vor Vollmond sind wir am stärksten. Selbst in unserer menschlichen Gestalt sind wir dann stärker als die meisten anderen Übernatürlichen. Aber nach der letzten Verwandlung, die in der Nacht nach Vollmond stattfindet, ist unsere gesamte Kraft erst mal erschöpft. Wir sind dann genau so lahm und schwach wie Menschen. Allerdings sind unsere Sinne immer noch so scharf wie sonst auch. So ist es übrigens bei allen Therianthropen“, erklärte er.
„Theri...- was?“
„Therianthropen“, wiederholte er lachend. „Der Sammelbegriff für Menschen, die sich in eine Kreatur verwandeln, die Merkmale von Mensch und Tier hat. Wie Werwölfe und Werkatzen. Allerdings ist der Werwolf der einzige Therianthrop, der sich in drei Nächten verwandelt, die anderen tun das wirklich nur in der Vollmondnacht. Ich vermute ja, dass das damit zusammenhängt, dass wir so unzivilisiert sind, dass das Tier in uns einfach öfter ausbricht.“ Im letzten Teil seiner Erzählung hat er eher mit sich selbst gesprochen, fast so, als würde er einem Rätsel auf den Grund gehen.
„Sind Formwandler auch Therianthropen?“, hakte ich nach.
„Nein. Wir können uns lediglich an Vollmond und nur in eine andere Kreatur verwandeln, Formwandler sind, was das angeht, absolut uneingeschränkt.“
„Wow. Das ist... ziemlich interessant. Schade, dass es nicht auf dem Lehrplan steht“, bedauerte ich. Der Unterricht wäre dadurch auf jeden Fall bereichert worden. Und es wäre sicherlich von Vorteil, mehr über die Monster zu erfahren, die uns das Leben so viel schwerer machten. Doch die nächsten Worte Adams leuchteten ein.
„Naja, eigentlich bemühen sich die Übernatürlichen, die Geschichten geheim zu halten.“ Doch bevor ich weiter bohren konnte, wechselte er abrupt das Thema. „Hey, wir sind da.“ Er setzte mich behutsam ab, jedoch nicht ohne eine Hand um meinen Arm geschlossen zu lassen, und erst jetzt konnte ich sehen, das wir vor einem zweistöckigen Haus inmitten einer Wohnsiedlung standen. Die gepflasterten Wege waren größtenteils intakt und verdorrte Rasenflächen deuteten darauf hin, dass die Gegend bestimmt einmal schön gewesen war. Jetzt, da sich niemand mehr um diesen Ort kümmerte, wirkte er allerdings nahezu gespenstisch.
„Sagtest du nicht etwas von Wohnung? Das hier ist ein Haus“, murmelte ich, als ich meinen Blick über die Fassade gleiten ließ. Abgesehen von dem abblätternden Putz sah das Haus sogar noch recht hübsch aus mit den weiß angestrichenen Fenstern und dem roten Ziegeldach.
„Schon, aber wir sind hier nur zur Miete“, grinste Adam, während er einen Schlüssel aus seiner Hosentasche zog und damit aufschloss. Er winkte mich herein und der Holzboden des Flurs knarzte laut, als wir ihn betraten.
„Ihr bezahlt Miete?“, wunderte ich mich.
„Nein.“ Er lachte leise bei seinem Geständnis.
„Und wenn du 'wir' sagst...“
„Dann meine ich mich und meine Mitbewohner.“ Er lächelte entschuldigend und ich zog überrascht meine Brauen in die Höhe, während ich ihm durch das Haus folgte.
„Du hast Mitbewohner?“
„Ja, alles Werwölfe. Obwohl wir eigentlich Einzelgänger sind, haben wir in unserer menschlichen Form oft das Bedürfnis, uns Gleichgesinnte zu suchen. In so einer Art Rudel zu sein, gibt uns das Gefühl, noch Kontrolle zu haben, auch nachdem... wir uns verwandeln. Zwar greifen sich verwandelte Werwölfe auch oft gegenseitig an, aber es ist trotzdem schön zu wissen, dass man nicht allein ist“, erzählte er mir. Als wir die Treppe zum ersten Stock betraten, schaute ich mich vorsichtig nach den anderen Übernatürlichen um, ehe ich zurück zu ihm schaute.
„Hast du deswegen so viele Narben?“, fragte ich neugierig. Als er mich daraufhin scharf ansah, biss ich mir auf die Zunge und ruderte sofort zurück. „Äh, du musst das natürlich nicht beantworten, wenn das zu privat ist. Tut mir leid. Manchmal spreche ich, ohne vorher nachzudenken.“
„Ist schon okay, ich hätte nur nicht gedacht, dass sie dir aufgefallen wären... Hier sind wir. Das ist mein Zimmer.“
Er öffnete eine hölzerne Tür und ließ mich vorangehen, wobei mir dennoch auffiel, dass er die Frage nicht beantwortet hatte. Sein Zimmer war zwar nicht besonders groß, dafür jedoch hoffnungslos überfüllt. Dass es vermutlich mal ein Kinderzimmer gewesen war, erkannte ich daran, dass unter dem weißen Anstrich die vorherige Blumentapete durchschimmerte. An den Schränken waren bunte Griffe festgeschraubt und eine Spitzengardine hielt neugierige Blicke fern. Das Kinderbett hatte Adam zu einem Sofa umfunktioniert und stattdessen eine riesige Matratze auf den Boden gelegt. Überall standen leere Wasserflaschen und dreckiges Geschirr herum.
„Ähm, die Unordnung tut mir leid, ich -“ Hastig sammelte er Teller vom Boden auf und klemmte sich drei Flaschen unter den Arm. „Ich hab heute nicht mit Besuch gerechnet. Und die Einrichtung ist auch nicht auf meinem Mist gewachsen.“
Ich erkannte, wie sich rote Flecken in seinem Gesicht bildeten und grinste, als ich beschwichtigend die Hände hob. „Ich urteile überhaupt nicht. Du solltest mal mein Zimmer sehen. Wobei, lieber doch nicht.“, lachte ich und er erwiderte mein Lächeln, sichtlich erleichtert, dass ich ihn nicht deswegen aufzog.
„Ich bring mal was von dem Zeug weg.“, informierte er mich und deutete mit dem Kinn auf die Sachen, die er sich geschnappt hatte. „Hast du vielleicht Hunger? Soll ich dir was zu Essen mitbringen?“
„Nein danke... Aber vielleicht was zu trinken?“, bat ich ihn.
„Klar, was hättest du denn gerne? Wir haben Wasser, Kaffee... Und das war's, fürchte ich.“ Er lächelte entschuldigend.
„Dann nehme ich Wasser, schätze ich.“ Ich erwiderte das Grinsen und er nickte.
„Kommt sofort. Mach es dir ruhig so lange gemütlich, ich bleib nicht lange weg.“ Mit diesen Worten verließ er das Zimmer und schloss die Tür hinter sich. Ich blieb unschlüssig mitten im Raum stehen und sah mich um, ehe ich mich schließlich dazu entschloss, mich auf das Sofa-Bett zu setzen. Die Matratze war so alt, dass ich die Federn spüren konnte, also rückte ich weiter an den Rand, wo sie noch nicht so durchgelegen war. Jetzt, da Adam weg war, kamen alle Sorgen mit heftiger Intensität zurück. Mir fiel auf, dass ich die wichtigsten Fragen noch gar nicht gestellt hatte: Was war mit dem Vampir passiert? War Phoebe immer noch wach und drehte meinetwegen gerade durch? Würde mich der Biss selbst in einen Vampir verwandeln? Und, die wichtigste Frage: Warum zur Hölle hat mich ein fremder Mann, der sich dreimal im Monat in ein menschenfressendes Monster verwandelt, in seine Wohnung gebracht, anstatt mich einfach direkt nach Hause gehen zu lassen? Konnte ich Adam wirklich vertrauen?
Ein Teil von mir tat es bereits. Irgendwie. Er benahm sich nicht viel anders als die menschlichen Männer, die ich bisher kennengelernt hatte und lachte ständig. Außerdem hatte er mein Leben gerettet, und wenn er mich töten wollte, hätte er sich nicht die Mühe machen müssen, mich vorher in seine Wohnung zu schleppen, es sei denn, er wollte mich mit seinen Mitbewohnern teilen.
Der Gedanke bereitete mir Unbehagen, aber davon einmal abgesehen hatte ich auch überhaupt keine Ahnung, wo ich war. Da mein Handy gerade tot war, hatte ich keinen Stadtplan und müsste mir wohl oder übel von Adam erklären lassen, wie ich zum nächsten Bahnhof kam.
In dem Moment kehrte er zurück. Er trug zwei volle Wasserflaschen bei sich und hielt einen Erste-Hilfe-Koffer im Arm. Er setzte sich zu mir auf das Sofa und drückte mir eine der Flaschen in die Hand, ehe er den Koffer öffnete und den Inhalt unter die Lupe nahm. Wenn ich ihn so ansah, fiel mir auf, dass ich mich eigentlich noch gar nicht angemessen bedankt hatte.
„Danke“, sagte ich also so inbrünstig, dass er überrascht den Blick von einer Packung Pflaster abwendete und stattdessen mich ansah, mit einem fragenden Blick im Gesicht.
„Keine Ursache, ist doch nur Wasser. Vermutlich auch nicht bezahlt, so wie ich Mike kenne...“, murmelte er.
„Ich meine ja auch nicht das Wasser. Also, auch, aber vor allem wollte ich mich dafür bedanken, dass du mein Leben gerettet hast. Das hab ich nämlich noch gar nicht gemacht, also... Danke. Ich bin dir echt was schuldig.“ Ich schaute ihm fest in die Augen und hielt seinem prüfenden Blick stand. Ich hatte keine Ahnung, wie ich diese Schuld einlösen sollte, wahrscheinlich war ihm das bewusst. Doch dann verschwand der ernste Ausdruck aus seinem Gesicht und er grinste wieder.
„Einer Jungfer in Nöten helfe ich doch jederzeit“, spottete er nur.
„Der Zug ist abgefahren“, informierte ich ihn, ohne vorher darüber nachzudenken. Sofort wurde ich knallrot und sein Grinsen wurde noch breiter, ehe er weitersprach.
„Ich helfe trotzdem gerne, wo ich kann, und schulden tust du mir auch nichts. Ich sehe das als Ausgleich für all die Leben, die ich nicht mehr retten kann...“ Seine Stimme wurde wieder leiser und der traurige Ausdruck kehrte in seine Augen zurück. Er inspizierte meine zerschnittene Haut und zog mit einer Pinzette einen Splitter aus meinem Arm. Ich zuckte unwillkürlich zusammen und er entschuldigte sich, zog aber gleich den nächsten Splitter aus einer anderen Wunde.
Ich schluckte, bevor ich mich traute, die nächste Frage zu stellen. Es war ein heikles Thema und ich wollte eigentlich nicht taktlos sein, doch die Ungewissheit nagte an mir und hinterließ Bissspuren an meinem Gewissen.
„Hast du denn schon mal... Also, hast du schon Menschen...“
„Getötet?“, beendete er den Satz für mich, ohne von meinem Arm aufzusehen. Seine scharf geschnittenen Gesichtszüge wirkten noch härter, als er seinen Kiefer anspannte, und sein Griff um meinen Arm war jetzt leicht schmerzhaft. „Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Wenn wir uns verwandeln, dann verschwindet alles... in einem Rausch. Und wenn wir wieder wir selbst sind, können wir uns kaum an etwas erinnern. Insbesondere dann nicht, wenn wir es vergessen wollen.“ Unterdrückte Wut schwang in seiner Stimme mit, doch sie schien sich vor allem gegen ihn selbst zu richten.
„Ich glaube nicht, dass du ein Mörder bist, Adam. Und selbst wenn, wärst das nicht du, sondern... Naja, der Wolf. Das bist du nicht. Du bist gut“, behauptete ich automatisch, ohne zu wissen, ob es der Wahrheit entsprach. Ich wusste selbst nicht, wen von uns beiden ich davon überzeugen wollte.
„Interessant, wie du darüber denkst. Du bist der erste Mensch, den ich treffe, der nicht fest davon überzeugt ist, dass man Werwölfe mit Stumpf und Stiel ausrotten sollte. Bist du überhaupt ein Mensch? So etwas wie deine Augen habe ich noch nie zuvor gesehen.“ Er versuchte vom Thema abzulenken und ich sprang sofort darauf an. Denn während mein linkes Auge braun war, genau wie die Augen meiner Mutter und meiner Tante, war mein rechtes Auge blau mit einem gelben Kreis um der Pupille. Ich hatte dieses Merkmal mit der Zeit zu schätzen gelernt, denn obwohl ich in der Grundschule noch dafür gehänselt wurde, habe ich später immer mehr Komplimente deswegen bekommen. Und jetzt hatten Adams Worte mich neugierig gemacht.
„Wieso? Gibt es Übernatürliche, die zwei unterschiedliche Augenfarben haben?“
Er schnitt eine Grimasse und schüttelte entschuldigend den Kopf. „Nicht öfter, als es auch bei Menschen vorkommt, glaube ich. Eine genetische Laune der Natur. Trotzdem sind deine Augen echt der Hammer. Zwei verschiedene Iris und dann noch mit gelb. Ich wette, es gibt Models, die für solche Augen töten würden.“
„Und ich dachte schon, ich könnte es demnächst selbst mit meinen Vampiren aufnehmen“, grinste ich.
„Träum weiter, Menschenmädchen“, lachte er. „Ich glaube, ich hab alle Splitter erwischt. Das Kleid hat einiges abgefangen, ist aber nicht mehr zu gebrauchen, fürchte ich.“
Erst jetzt nahm ich bewusst mein Erscheinungsbild und stellte mit Entsetzen fest, dass mein Kleid mit mehreren Löchern gespickt war. Es passte allerdings zu dem Rest meines blutigen Körpers. Ich sah aus, als hätte man mich versehentlich in einen Mixer geworfen und gerade noch rechtzeitig wieder herausgeholt.
„Wie geht es deinem Kopf? Du hast ja ziemlich heftig geblutet.“
Vorsichtig tastete ich nach der Stelle, an der ich die Wunde vermutete. Ich ertastete mein eigenes Blut, doch es schien sich bereits Schorf gebildet zu haben. Ich wischte das Blut an meinem Kleid ab – es hatte ohnehin schon einiges abbekommen – und wandte mich wieder Adam zu.
„Bin fit wie ein Turnschuh, ging mir nie besser“, grinste ich gequält. Die offensichtliche Lüge ließ ihn mein Grinsen unwillkürlich erwidern.
„Soll ich dich noch mit Pflastern tapezieren?“, bot er an, und ich zuckte mit den Schultern, was mehr weh tat, als ich gedacht hätte. Also fing er an, Pflaster von der Rolle abzuschneiden und sie auf die Stellen zu kleben, die ich selbst nicht erreichen konnte. Ich half ihm und wir konzentrierten uns auf die größeren Schnitte, da die Rolle sonst niemals gereicht hätte. Als wir fertig waren, packte er den Erste-Hilfe-Koffer wieder zusammen und musterte mich eingehend.
„Du siehst aus wie ein Werk des Dadaismus“, erklärte er mir spöttisch.
„Was ist das denn?“, fragte ich, unsicher, ob ich mich beleidigt fühlen sollte oder nicht.
„Eine Kunstrichtung“, klärte er mich mit einem Zwinkern auf, ohne darauf einzugehen, was genau dahintersteckte. Also war es wohl nichts allzu Positives.
„Interessierst du dich für Kunst?“
„Ich wollte mal so etwas in der Richtung studieren, doch dann kam das Leben dazwischen und jetzt heule ich den Mond an“, erzählte er.
„Ach echt? Wann hast du dich denn in einen Werwolf verwandelt?“, hakte ich interessiert nach. „Ist das angeboren oder wie passiert das?“
Er schüttelte den Kopf und lächelte nachsichtig. Meine Neugier schien ihm nichts auszumachen, was ganz gut war, da ich noch gefühlt hundert weitere Fragen an ihn richten wollte. „Nein, es liegt nicht in unseren Genen. Soweit ich weiß, sind alle Therianthropen unfruchtbar, und Werwölfe auf jeden Fall. Ich habe mich verwandelt, weil ich von einem anderen Werwolf gebissen wurde, und zwar als einer der Ersten, seit wir von der Existenz Übernatürlicher wissen. Vor ziemlich genau elf Jahren.“
Sofort drängten sich mir neue Fragen auf, auf die ich eine Antwort haben wollte. Ich entschied mich für eine, die zwar harmlos, aber nicht unwichtig war. „Wie alt warst du denn, als du gebissen wurdest?“
„Siebzehn.“
Meine Augen weiteten sich und nach einer kurzen Rechnung wurde mir klar, dass Adam mindestens 28 Jahre alt sein musste. Ich hätte ihn auf Anfang Zwanzig geschätzt.
„Hab mich gut gehalten, was?“, erriet er meinen Gedankengang. Er fuhr sich durch die Haare und klimperte übertrieben mit den Augen, ehe er zu einer Erklärung ansetzte. „Meine neue Art altert nur halb so schnell wie einfache Menschen, deshalb bin ich – rein biologisch betrachtet - eigentlich erst 22 oder 23 Jahre alt.“
„Und du wurdest durch einen Biss verwandelt. Bei Vampiren ist das doch auch so, oder? Weil ich ja auch gebissen wurde. Werde ich mich... verwandeln?“, traute ich mich schließlich zu fragen. Es fühlte sich nicht so an, als stünde ich kurz vor einer Transformation, aber man konnte ja nie wissen. Letzten Endes hatte ich keine Ahnung davon, welche die Anzeichen waren. Doch zum Glück konnte Adam mir die Entwarnung geben.
„Nein, so funktioniert das nicht bei den Blutsaugern. Wenn ein Vampir sein Opfer zu einem von Seinesgleichen machen will, muss er ihm das gesamte Blut aussaugen, sonst kann das Gift nicht wirken. Und selbst dann überleben nur die stärksten Menschen die Wandlung, weil sie einem wirklich an die Substanz geht... Deshalb gibt es kaum alte oder sehr junge Vampire. Zumindest erzählt man sich das.“ Er zuckte mit den Schultern und setzte ein gleichgültiges Gesicht auf.
„Der, der mich angegriffen hat... Ist er tot?“
„Nein, so einfach ist es leider nicht, Vampire zu töten“, verneinte er seufzend und schon machte ich mir Sorgen, dass ich ihn möglicherweise wiedersehen könnte.
„Muss man ihnen nicht einfach nur einen Holzpflock durch das Herz schlagen?“, wunderte ich mich, woraufhin ich einen belustigten Blick erntete.
„Ich weiß echt nicht, wie sich dieses Gerücht so lange bei euch Menschen halten konnte...“ Er schüttelte den Kopf. „Vampire sind doch praktisch wandelnde Leichen, ihre Herzen schlagen seit Jahrhunderten nicht mehr. Man könnte ihnen das Herz rausreißen und sie würden es nicht einmal bemerken, es ist ein vollkommen überflüssiges Organ. Wie eine dritte Niere. Nein, Vampiren muss man den Kopf abschlagen, allerdings gibt es nur wenige Klingen, die ihre Haut durchdringen können.“
„Aber die Sache mit dem Sonnenlicht stimmt doch, oder?“, fragte ich beunruhigt.
„Ja, das stimmt. Sonst würden sie die Menschen auch tagsüber terrorisieren. An stark bewölkten Tagen solltest du aber aufpassen, sie verbrennen nur bei direkter Sonneneinstrahlung.“
„Und sonst haben sie keine Schwächen? Ich meine, was ist, wenn der Vampir Rache nehmen will?“, fragte ich besorgt.
„Ich bin mir nicht sicher...“, antwortete er zögerlich.
„Was meinst du?“
„Naja, ich weiß nicht wirklich viel über Vampire, verstehst du? Die Übernatürlichen bleiben für gewöhnlich unter sich. Die meisten von uns sind Einzelgänger, und auch wenn wir so viel stärker sind als Menschen, so müssen wir doch trotzdem um unser Überleben kämpfen. Denn die Übernatürlichen sind machthungrig und selbstsüchtig und bereit, über Leichen zu gehen. Deshalb bemühen wir uns, sowohl unsere Stärken als auch unsere Schwächen für uns zu behalten“, erläuterte er mir. Ich hatte schon gehört, dass die einzelnen Arten lieber unter sich blieben und sich sogar mit anderen Arten anlegten, wenn es um bestimmte Gebiete ging. Trotzdem dachte ich irgendwie immer, dass sie alles übereinander wissen.
„Klingt einleuchtend“, gab ich zu. „Aber mir wäre es trotzdem lieber, ich wüsste genauestens Bescheid.“
„Er wird bestimmt nicht wieder kommen. Ich glaube nicht, dass er ein Jäger ist. Er ist es gewöhnt, dass sein Essen zu ihm kommt und nicht anders herum.“
„Ich hoffe wirklich, dass du Recht hast“, murmelte ich. Am liebsten würde ich Phoebe sagen, dass sie heute Nacht auf keinen Fall irgendwem die Tür öffnen sollte. „Sag mal, hast du zufälligerweise ein Telefon, dass ich benutzen könnte? Ich glaube, ich sollte meine Freundin warnen.“
„Sorry, keiner von uns hat ein Handy.“ Er zuckte entschuldigend mit den Schultern und verzog den Mund.
„Schon gut, sie würde nachts bestimmt eh nicht an die Tür gehen“, murmelte ich leise vor mich hin, um mein Gewissen zu beruhigen.
„Deine Freundin?“ Natürlich hatte er mich gehört. Die Ohren von Werwölfen waren menschlichen überlegen.
„Phoebe. Wir wohnen zusammen und sie hat mich davor gewarnt, zu diesem Treffen zu gehen. Natürlich hatte sie wie immer Recht“, seufzte ich.
„Wie lange seid ihr denn schon zusammen?“, fragte er beiläufig.
„Als sie achtzehn war, hat sie sich eine Wohnung gesucht und ich bin dann...“ Ich hielt inne, als mir die Bedeutung seiner Frage so richtig bewusst wurde. „Oh. Oh. Nein, wir sind nicht... Wir sind kein Paar. Wir sind nur Freunde-Freunde“, erklärte ich leicht verlegen. „Wir haben früher in derselben Straße gewohnt und sind immer zusammen zur Schule gefahren. Wir wurden Freunde, obwohl sie eine Stufe über mir war, und sind es immer noch.“
„Verstehe... Dann rück mal deine Lebensgeschichte raus, das wäre nur fair, nachdem ich dir schon so viel von mir erzählt habe“, schmunzelte er. Ich wurde wieder rot und schüttelte den Kopf.
„Lieber nicht. Sie ist nicht ganz so leicht verdaulich...“, zögerte ich.
„Du meinst, nicht ganz so leicht verdaulich wie 'Ich wurde von einem Werwolf gebissen und bin jetzt selbst einer, in meiner Freizeit lege ich mich mit anderen Übernatürlichen an und drücke mich vor der Miete'?“, hakte er spöttisch nach und entlockte mir damit ein schwaches Lächeln.
„Nein, anders... Wenn ich die Geschichte erzähle, haben die Menschen meistens das Gefühl, mir irgendeine Sonderbehandlung zukommen lassen zu müssen, bevor sie dann für immer aus meinem Leben verschwinden.“ Ich lächelte wehmütig.
„Na ja, aber ich bin ein Fremder. Die Chancen, dass ich sowieso wieder aus deinem Leben verschwinde, stehen relativ gut.“ Er kratzte sich verlegen am Kopf und ich merkte, dass ich nicht wollte, dass er wieder verschwand. Ich ignorierte das komische Gefühl in meinem Magen und antwortete: „Wenn du nicht vorhast, zu bleiben, lohnt es sich wohl kaum, dir mein Herz auszuschütten.“
„Willst du denn, dass ich bleibe?“, hakte er nach und plötzlich sah er verletzlich aus. Irgendetwas sagte mir, dass er aufgrund seines übernatürlichen Wesens schon öfter abserviert worden war, und Mitleid flammte in mir auf.
„Natürlich. Du hast mir das Leben gerettet, da muss ich mich doch noch irgendwie revanchieren“, meinte ich grinsend.
„Wenn mich das nächste mal ein Vampir angreift, ruf ich dich an“, spottete er.
„Mit welchem Telefon?“, entgegnete ich.
„Vielleicht besorge ich mir ja mal eins“, überlegte er. „Kann ja nicht schaden.“
„Nur dem armen Verkäufer, der keinen Cent dafür kriegt.“ Ich hob eine Augenbraue und lachte, als er mich mit verengten Augen ansah.
„Mir fällt auf, dass du vom Thema ablenkst“, sagte er nur.
„Welches Thema?“, flötete ich unschuldig.
„Wer bist du, wo kommst du her, war es überhaupt sicher, dich mit in meine Wohnung zu schleppen, oder wirst du uns alle im Schlaf erdrosseln?“, half er mir auf die Sprünge und ich verdrehte die Augen. Klar, ich war die Bedrohung hier.
„Du willst also die ganze Geschichte hören.“
„Und keinen Satz weniger.“
„Na schön“, seufzte ich und machte eine dramatische Pause. „Alles begann vor zwanzig Jahren, als meine Mutter und mein Vater sich kennenlernten. Ich weiß praktisch nichts über die Umstände ihres ersten Treffens, nur, dass meine Mutter sofort hin und weg von meinem Vater war. Sie war sehr jung – erst 23 – und leicht zu beeindrucken. Es dauerte nicht lange, bis sie sich auf ihn einließ und danach verging noch weniger Zeit, bis er sie wieder verließ. Mit gebrochenem Herzen und halb wahnsinnig machte sie sich auf die Suche nach ihm. Sie erzählte den Leuten davon, dass sie einen Engel getroffen hätte und war völlig davon besessen. So sehr, dass sie zu einer Gefahr für sich selbst wurde. Ihre Schwester – meine Tante – sorgte schließlich dafür, dass meine Mutter in eine Klinik für psychisch gestörte Menschen gebracht wurde und dort auch nicht mehr rauskam. Sie litt angeblich unter Halluzinationen und Wahrnehmungsstörungen. Niemand hat vor zwanzig Jahren auch nur in Betracht gezogen, dass Engel mehr als eine Legende sein könnten. Tja, und dann kam einige Monate später ich auf die Welt, Tochter einer Geisteskranken und eines unidentifizierten Vaters. Meine Mutter gab mir den Namen Seraphina – ein passender Name für das Kind eines Engels – und dann wurde das Sorgerecht meiner Tante übergeben. Einige Wochen oder Monate später nahm meine Mutter sich das Leben. Mann und Kind zu verlieren, war einfach zu viel für sie. Sie hatte schon lange Depressionen.“
Ich hatte die ganze Zeit auf meine Hände geschaut und erst jetzt, als ich eine Pause machte, wagte ich es, in Adams Gesicht zu sehen. Er erwiderte meinen Blick, doch ich konnte weder Mitleid noch Unbehagen in seinen Zügen erkennen. Er wirkte einfach nur so, als würde er konzentriert zuhören. Also räusperte ich mich und fuhr fort.
„Brit, also meine Tante, hatte keine eigenen Kinder. Sie mochte keine Kinder und das änderte sich auch nicht, als sie sich dazu bereit erklärte, die Verantwortung für mich zu übernehmen. Sie hat mich zwar nie misshandelt oder etwas dergleichen, aber Zuneigung war lange Zeit ein Fremdwort für mich, etwas, dass ich zwar kannte, aber nicht verstand. Und dann kam Phoebe in mein Leben und adoptierte mich praktisch. Sie schloss mich in ihr Herz und wir wurden beste Freundinnen, absolut unzertrennlich. Als sie mit achtzehn auszog, um zu studieren, kam ich mit ihr, obwohl ich erst siebzehn war. Aber meine Tante war erleichtert, mich loszuwerden, also machte sie mir deswegen keine Probleme. Und dann sind wir auch schon in der Gegenwart angekommen... Jetzt bin ich neunzehn, studiere Literaturwissenschaften und arbeite nebenbei als Kellnerin. Phoebe und ich sind sind immer knapp bei Kasse, aber bisher sind wir immer irgendwie über die Runden gekommen. Nur kommt momentan leider echt viel auf einmal zusammen... Deshalb wollte ich auch mein Blut verkaufen.“ Ich war am Ende der Geschichte angelangt und musterte jetzt Adams Gesichtsausdruck. Er war entspannt und schien über etwas nachzudenken.
„Und das ist so eine furchtbare Geschichte, dass sie Leute in die Flucht schlägt?“, fragte er schließlich.
„Meine Mutter ist tot, mein Vater verschwunden und in meiner Kindheit habe ich keine Liebe erfahren – mit dem dramatischen Hintergrund könnte ich jede Castingshow gewinnen!“, scherzte ich lahm.
„Tut mir leid, dass dir das passiert ist.“
Ich zuckte mit den Schultern. „Was soll's? Es spielt keine Rolle mehr. Ich kann mich an meine Eltern nicht erinnern, also kann ich sie auch nicht vermissen.“
„Würdest du deinen Vater gerne kennenlernen?“, erkundigte er sich.
„Nein. Wenn er meine Mutter geschwängert und im Stich gelassen hat, gehört er nicht zu der Sorte Menschen, die ich in meinem Leben haben will“, sagte ich kalt. Ich hatte schon zu viel Zeit damit verbracht, einen Fremden zu hassen und für den Tod meiner Mutter verantwortlich zu machen.
„Und was glaubst du, hat es mit der Engel-Sache auf sich?“, grübelte er.
„Es gibt keine Engel, Adam. Seit elf Jahren warten wir Menschen auf einen Funken Hoffnung, doch selbst der Vampir hat mir gesagt, dass sie nicht real sind. Meine Tante hat es geliebt, allen möglichen Leuten zu erzählen, was für eine Last ihres geisteskranke Schwester war, doch im Endeffekt hatte sie Recht. Meine Mutter hat etwas gesehen, was es nicht gab.“
„Vielleicht war er ja ein Formwandler...“
„Ich bin aber nicht übernatürlich“, erinnerte ich ihn.
„Na gut, dann stimmt es wohl“, gab er sich geschlagen und lehnte sich zurück.
„Was ist mit deinen Eltern? Habt ihr noch Kontakt?“ Ich wollte das Gespräch von mir abwenden, doch als ich den Ausdruck in Adams Gesicht sah, bereute ich es sofort.
„Ich hab sie die letzten Jahre einmal im Monat von einer Telefonzelle aus angerufen. Doch jetzt haben sie wohl eine neue Nummer.“ Bitterkeit schwang in seiner Stimme mit, als er davon erzählte.
„Was ist denn passiert?“
„Ich bin ein Werwolf und sie nicht. Sie reagierten so, wie alle normalen Menschen es tun würden: Sie distanzierten sich immer weiter von mir.“ Seine Stimme war kalt und sein Gesichtsausdruck undurchdringlich, doch unter der Oberfläche schien es zu brodeln.
„Aber du bist doch immer noch ihr Sohn!“, protestierte ich ungläubig.
„Ich bin ein potenzieller Mörder, Sera“, wandte er ein.
„Das ist doch Bullshit“, antwortete ich mürrisch. „Jeder ist ein potenzieller Mörder. Nur weil du dich in etwas anderes verwandelst, bist du deswegen doch noch lange nicht böse!“
„Das ist nur deine Sichtweise“, murmelte er. „Aber hey, meine Schwester sehe ich noch manchmal“, sagte er lächelnd, von seinen Eltern ablenkend.
„Und ihr macht es nichts aus, das du ein Werwolf bist?“
„Nein, ganz im Gegenteil, sie findet die Welt der Übernatürlichen faszinierend. Sie hat mich sogar schon mal gefragt, ob ich sie nicht in eine von uns verwandeln könnte...“ Er runzelte die Stirn und schüttelte den Kopf. „Du kannst dir ja sicher denken, was ich gesagt habe.“
„Drei Achtzig, bitte?“
Er guckte mich kurz blöd an, dann begriff er, dass ich nur einen Witz gemacht hatte und lachte schwach.
„Ja, genau. Aber mal im Ernst, dieses Leben wünsche ich niemandem.“ Er streckte seine Arme über den Kopf und ließ seine Finger knacken, wobei er schließlich ein unbekümmertes Gesicht aufsetzte. „Ich glaub, ich mach mir eine Pizza. Ich hab die ganze Nacht noch nichts gegessen. Willst du mitkommen oder lieber hier warten?“
„Ich komm mit“, entschied ich mich und stand auf. Ich folgte ihm aus dem Zimmer und in die Küche im ersten Stock, wo er eine einfache Salamipizza aus dem Tiefkühlfach holte. Er befreite sie aus der Plastikpackung und schob sie in den Ofen.
„Woher kommt eigentlich euer Strom? Ich dachte, man hätte ihn in diesen Gebieten bereits abgeschaltet?“, wunderte ich mich.
„Wir haben einen Generator im Keller, der das ganze Haus mit Strom versorgt“, erklärte er und ich verkniff mir die Frage nach dem Kellereingang, weil ich ihn noch nicht gesehen hatte.
Während er die Temperatur einstellte, bemerkte ich, dass bereits erstes Dämmerlicht durch die Schlitze der Jalousien fiel, und fragte mich, wie spät es wohl war. War Phoebe noch wach? Gingen Vampire um diese Uhrzeit noch nach draußen?
„Sag mal, schlafen Vampire eigentlich in Särgen?“, fragte ich Adam, während ich beobachtete, wie vor dem Haus ein Vogel in dem Baum landete.
„Ich weiß nicht einmal, ob sie überhaupt schlafen“, antwortete er mit gerümpfter Nase. Sofort wirbelte ich zu ihm herum.
„Vampire schlafen nicht?“, rief ich erschrocken und eine Spur zu laut.
„Pssst! Wenn du die Werwölfe weckst, darf ich dich nie wieder einladen“, warnte er mich mit belustigter Stimme. „Und ich weiß nicht, ob sie Schlaf brauchen oder nicht. Das ist wieder eines dieser elenden Geheimnisse. Aber wenn, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie in Särgen schlafen. Ich meine, so wären sie vor den Sonnenstrahlen geschützt“, äußerte er seine Überlegungen.
„Ich hab in nur einer Nacht schon mehr über die Übernatürlichen gelernt, als je zuvor in meinem Leben“, staunte ich.
„Und ich wette, du hast noch dreitausend weitere Fragen“, meinte er unbeeindruckt. Ich streckte ihm die Zunge raus, denn er lag goldrichtig.
„Schon möglich. Und eine davon ist: Wie komme ich von hier aus am schnellsten zum Bahnhof?“, wollte ich wissen.
„Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.“
Ich grinste. „Ich muss ja irgendwann wieder nach Hause fahren. Ich hab einen Job, muss studieren und meiner Mitbewohnerin beweisen, dass ich noch nicht tot bin.“
„Ach ja.“ Er überlegte kurz, dann nahm er sich einen Zettel und einen Stift von einem der Küchentresen und malte eine winzige Karte auf das quadratische Papier. Als er fertig war, drückte er sie mir in die Hand. „Ist eigentlich ganz einfach. Du gehst zur Haustür links raus und bis zum Ende der Straße, was ungefähr 400 Meter sind. Dann folgst du der Straße an der Kreuzung nach rechts und gehst dort immer weiter, bis du an einen unbefestigten Weg kommst, der etwa zwei Meter breit ist. Merk dir das, zwei Meter! Davor kommt nämlich noch so ein Weg, aber der ist deutlich schmaler. Und wenn du den richtigen Weg gehst, kommst du am Ende an einem Bahnsteig raus. Auf Straßennamen kannst du dich leider nicht verlassen, die Leute hier finden es nämlich ungeheuer witzig, die Schilder zu klauen oder zu vertauschen. Aber eigentlich ist der Weg ganz leicht zu finden. Wenn du willst, kann ich ihn dir auch später zeigen“, bot er an.
„Danke, das wäre echt nett.“ Ich umschloss die Karte mit meiner Faust und lächelte ihn dankbar an. Dann gab der Ofen ein schrilles Piepen von sich und Adam wandte sich von mir ab, um es schnell auszuschalten, damit niemand wach werden würde. Er betrachtete die Pizza und beschloss, sie noch fünf Minuten drin zu lassen.
„Ich mag Pizza lieber knusprig“, erklärte er mir.
„Ich mag sie labbrig. Dicker, weicher Teig und ganz viel Fäden ziehender Käse.“, schwärmte ich.
„Bäh, labbrige Pizza.“ Er verzog das Gesicht.
„Pizza muss labbrig sein! Wenn du es lieber knusprig magst, kauf dir Kekse“, neckte ich ihn.
„Schön, ich hol sie raus“, sagte er, wobei er die Augen verdrehte.
„Nein, sie gehört doch dir!“, protestierte ich. „Du musst sie essen.“
„Du hilfst mir dabei. Außerdem“ Er zwinkerte mir zu. „War deine Argumentation sehr überzeugend.“
Ich ließ ihn also machen und versuchte, mich nützlich zu machen, indem ich nach Tellern und Besteck suchte. Allerdings herrschte so eine unlogische Ordnung in der Küche, dass Adam mir zeigen musste, wo sich das Besteck befand (in einem Wandschrank über dem Tiefkühlfach) ehe er mir erklärte, dass sämtliche Teller entweder in Benutzung oder im Geschirrspüler waren.
„Das habe ich gar nicht bedacht.“ Er blies die Backen auf und ließ die Luft anschließend wieder unter einem lauten Zischen entgleiten. „Dann essen wir die Pizza eben aus Schüsseln.“
„Im Ernst?“, fragte ich leicht ungläubig.
„Du kannst sie natürlich auch in die Hand nehmen. Ist ja nur 180 Grad heiß.“ Er hatte sich jedoch bereits zwei große Schüsseln genommen und stellte sie neben die Pizza, bevor er diese in acht gleichgroße Stücke schnitt und 50-50 zwischen uns aufteilte.
Wir aßen die Pizza als wir wieder in seinem Zimmer waren, wobei ich dieses Mal das Sofa für mich allein hatte, da er sich auf seine Matratze gesetzt hatte. Ich musste zugeben, dass ich Adams Gesellschaft genoss; mit ihm war alles irgendwie so unkompliziert und entspannt. Es wäre wirklich schade, wenn ich ihn nach der heutigen Nacht nicht mehr wiedersehen würde.
„Wenn du mal zu mir kommen solltest, werde ich dir mal Pizza auf einem richtigen Teller servieren“, sagte ich, als ich bei meinem letzten Stück angelangt war. Er blickte zu mir auf und zog einen Flunsch.
„Was hast du gegen Schüsseln? Ich glaube, ich werde ab sofort nur noch Schüsseln benutzen“, behauptete er mit zufriedenem Blick auf den traurigen Teller-Ersatz.
„Du hast doch 'nen Knall“, stellte ich kopfschüttelnd fest.
„Ich bin lediglich offen für kreative Lösungsansätze, das ist ein Unterschied“, berichtigte er mich mit mahnendem Zeigefinger. Ich schnaubte nur und schlang den letzten Bissen, gierig wie ich war, auf einmal runter.
„Hast du hier irgendwo eine Uhr?“, erkundigte ich mich, da inzwischen richtiges Tageslicht durch einen Spalt in der Gardine fiel. Adam warf mir einen Wecker zu und ich stellte fest, dass es schon weit nach acht war.
„Wir müssen unbedingt daran denken, dass du hier rausgehst, bevor der Mond wieder aufgeht. Nicht, dass du mir auf die Nerven gehst, aber ich würde dich ungern lebendig verspeisen. Du scheinst ganz in Ordnung zu sein und ich denke, es wäre echt schade um dich“, meinte er, während er sich mit einem lauten Gähnen auf seinem Bett ausstreckte.
„Danke. Oder so.“ Ich räusperte mich leise und stellte meine Schüssel neben seine auf den Boden, ehe ich es mir ebenfalls bequemer machte. Eine Weile lang starrte ich einfach nur an die Decke, während ich versuchte, einen klaren Gedanken zu fassen. Es war über 24 Stunden her, dass ich richtig geschlafen hatte – die kurze Phase der Bewusstlosigkeit mal ausgenommen. Immerhin war heute Samstag und ich musste weder zur Uni, noch arbeiten. Wenn ich endlich wieder ins Bett kam, würde ich so richtig ausschlafen.
„Wie viele verschiedene Arten von Übernatürlichen gibt es eigentlich?“, fragte ich, den Blick immer noch zur Decke gerichtet. Als Adam nicht antwortete, wandte ich meinen Kopf unwillig davon ab und zu ihm hin.
„Adam?“ Seine Augen waren geschlossen, sein Brustkorb hob und senkte sich regelmäßig. Er war tatsächlich eingeschlafen. Ich schnaubte entrüstet und brummte leise: „So viel zum Thema du bringst mich zum Bahnhof.“
Andererseits konnte er das ja auch noch immer machen, wenn er wieder wach war. Ich könnte auch eine Mütze voll Schlaf gebrauchen, sonst würde ich vermutlich bald im Stehen einschlafen. Bis die Sonne unterging, würde ich wieder aufgewacht sein und rechtzeitig vor Adams Verwandlung im Zug nach Hause sitzen. Und als mir beim Gähnen die Augen zufielen, beschloss ich einfach, sie nicht mehr zu öffnen.
Ein merkwürdiges Geräusch riss mich einige Stunden später aus dem Schlaf. Die Sonne schien mir ins Gesicht und kam jetzt aus einer anderen Richtung als vorhin.
„Du musst hier sofort raus, Seraphina.“ Ich hörte Adams Stimme hinter mir, doch sie klang merkwürdig verzerrt und angespannt. Ich warf einen schnellen Blick auf den Wecker – es war gerade mal halb fünf – und drehte mich dann zu ihm.
Ich brauchte einen Moment, um das Bild, dass sich mir bot, zu verstehen. Adam hatte sich neben seiner Matratze zusammengekrümmt und irgendwas schien mit seinen Proportionen nicht mehr zu stimmen. Irgendwie war alles auf einmal zu groß und sehnig, außerdem sprossen fellartige Haare aus seiner Haut.
Und dann verstand ich. Werwölfe verwandelten sich nicht nachts. Sie verwandelten sich, wenn der Mond aufging. Und der Mond konnte auch tagsüber am Himmel stehen. Adam schien gegen die Verwandlung anzukämpfen, aber aufhalten konnte er sie nicht. Und ich befand mich in einem Haus voller menschenfressender Werwölfe.
Ich war sofort hellwach und sprang von dem Sofa auf, wobei mein Körper von diversen Stellen aus Schmerzsignale sendete. Ich steckte den Notizzettel mit der aufgezeichneten Karte ein und lief an Adam vorbei, um die Tür aufzureißen und die Treppe runter zu rennen. Toll, da hatte ich einen sadistischen Vampir überlebt, nur um anschließend aus purer Dummheit schon wieder in einer lebensgefährlichen Situation zu landen.
Doch als ich unten ankam, verging mir mein Sinn für schwarzen Humor. Vor der Tür zum Flur und damit zur lebensrettenden Haustür kauerte ein riesiger, grauer Werwolf, die Gliedmaßen schon zum Sprung angespannt. Er taxierte mich aus herzlosen, schwarzen Augen und hob seine Schnauze, um meine Witterung aufzunehmen. Ein Knurren löste sich aus seiner Kehle, als er meinen menschlichen Geruch erfasste und mich als Nahrung identifizierte. Ängstlich wich ich zurück und stieß mit dem Rücken gegen eine Wand, als ich versuchte, mich vor dem Unvermeidlichen zu drücken. Der Werwolf duckte sich und ich fragte mich noch einen Moment, ob es sich wohl um den Mike handelte, von dem Adam gesprochen hatte, ehe ich meine Augen schloss und ein Stoßgebet an jeden Gott schickte, der mir zuhörte.
Doch ein Geräusch aus unerwarteter Richtung zwang mich dazu, die Augen wieder aufzureißen und mich nach der Quelle umzusehen. Ich erkannte Adam, beinahe vollständig verwandelt, der jetzt den anderen Werwolf anknurrte. Dieser ließ von mir ab, winkelte die Beine zum Sprung an und stürzte sich auf Adam, weil er ihn als Bedrohung erkannt hatte. Voller Angst beobachtete ich einen Moment, wie die Zähne des grauen Werwolfs sich in einem Teil noch menschlicher Haut Adams verbissen. Er heulte laut auf, doch schien sich behaupten zu können. Und ich musste hier dringend verschwinden, sonst würde ich sterben. Ich rannte in den Flur und schloss so schnell ich konnte die Haustür auf, um nach draußen zu laufen.
Nachdem ich die Tür hinter mir wieder zugeschmissen hatte, nahm ich kurz die Lage in Augenschein. Die Straße schien zwar größtenteils unbewohnt zu sein, doch aus manchen Hauseingängen stolperten bereits verwirrte Werwölfe heraus.
Ich würde rennen müssen. Gegen das Tempo eines Lykaners hatte ein Mensch zwar keine Chance, aber ich hoffte darauf, dass sie durch die Verwandlung noch so verwirrt waren, dass sie nicht sofort die Verfolgung aufnehmen würden. Und Verstecken war keine Option, sie würden mich zweifellos riechen. Rennen war meine einzige Chance.
Im Haus hinter mir hörte ich ein bedrohliches Knacken und ich zögerte nicht länger. So schnell ich konnte, sprintete ich los und rannte barfuß über den Asphalt, an meinen Fressfeinden vorbei. Das Adrenalin rauschte abermals durch meinen Körper und mein Herz klopfte mir bis zum Hals, doch ich zwang meine Beine weiter voran. Kleine Steine bohrten sich in meine Fußsohlen und die Wunden an meinen Beinen fingen durch die heftigen Bewegungen wieder an, zu bluten. Das Ende der Straße war noch hundert Meter entfernt, als ich merkte, wie mir langsam die Kraft ausging. Ich keuchte lauter und verfluchte mich dafür, dass ich Phoebe im Sommer beim Joggen nicht öfter begleitet hatte.
Als ich das Ende der Straße erreicht hatte, gönnte ich mir eine Sekunde Verschnaufpause, um einen Blick zurück zu werfen. Erleichtert stellte ich fest, dass mir nichts und niemand folgte. Doch auf der nächsten Straße hatten sich noch mehr Werwölfe gesammelt und ich stieß innerlich sämtliche Kraftausdrücke aus, die ich kannte. War das hier eine verdammte Werwolfsiedlung oder was?
Ich musste mir eingestehen, dass ich an ihnen unmöglich unbemerkt vorbeirennen könnte. Ich bräuchte eine Waffe. Und einen weniger menschlichen Geruch.
Mein Blick fiel auf das Straßenschild über mir und ich erinnerte mich daran, was Adam mir vor einigen Stunden erzählt hatte. Die Leute hier finden es nämlich ungeheuer witzig, die Schilder zu klauen oder zu vertauschen. Seine Stimme klang ganz deutlich in meiner Erinnerung wieder. Ich beschloss, mein Glück einfach zu versuchen, und sprang an der Stange hoch, um nach dem Schild zu greifen. Erleichtert stellte ich fest, dass es tatsächlich locker war und zerrte es runter. Scheinbar hatte die Straße wohl ursprünglich nicht Eichenweg geheißen. Ich war den unbekannten Vandalen plötzlich eigenartig dankbar für ihre sinnlosen Tauschaktionen und schlich, nur mit dem Schild bewaffnet, zu einem Busch in der Straße weiter, in die ich einbiegen musste. Ich überlegte mir die beste Taktik und entschied mich dafür, mich schnell, aber verdeckt zu bewegen. Ich bildete mir ein, dass die Werwölfe auf diese Weise nicht so schnell meinen Geruch aufnehmen würden, mich aber auch nicht sehen und jagen würden. Und jetzt war es Zeit, diese Theorie zu testen.
Ich rannte geduckt zu einer Ansammlung von Mülltonnen weiter, wobei ich etwa zehn Meter zurücklegte. Ich hielt Ausschau nach den Werwölfen; noch waren sie weit entfernt. Ich rannte schnell hinter ein am Straßenrand geparktes Auto – diese Entfernung war schon länger als die letzte. Auf der anderen Straßenseite konnte ich einen Sandweg sehen, der zu schmal für ein Auto war. Es musste der sein, von dem Adam mir erzählt hatte. Diesen sollte ich nicht nehmen. Ich versuchte, einen weiteren zu entdecken, aber von meiner Perspektive aus war das ein vergebliches Unterfangen. Jetzt hatte ich die Wahl, ob ich zu einem Busch auf der anderen Straßenseite oder zu einigen Mülltonnen weiter rennen wollte. Beides war gut fünfzig Meter von mir entfernt und ein einzelner Werwolf stand mit dem Rücken zu mir genau zwischen den beiden Verstecken. Ich starrte ihn eindringlich an, als könnte ich ihn nur mit meiner Gedankenkraft dazu überreden, ein kleines bisschen weiterzugehen.
Als würde er mir einen Gefallen tun wollen, lief er in diesem Moment tatsächlich einige Schritte weiter weg. Ich fasste mir ein Herz und rannte so schnell und gleichzeitig so leise wie möglich hinter die Mülltonnen. Doch als ich mich wieder hinkniete, verlor ich das Gleichgewicht und stieß gegen eine der Tonnen. Natürlich fiel sie sofort um und rollte unerträglich laut über die Straße. Ich zuckte zusammen als der Werwolf herumfuhr und sofort Kurs auf meinen Standort nahm. Ich schluckte und spürte, wie mir der Angstschweiß am Körper herunterlief. Und dann sah ich hinter dem Werwolf etwas, dass mir neue Hoffnung schenkte. Etwa sechzig Meter entfernt sah ich den zweiten unbefestigten Weg, der von der Straße abbog und im Grünen verschwand. Es war meine einzige Chance. Und ich wollte leben.
Hundeschnauzen sind empfindlich, erinnerte ich mich. Und noch ehe ich gründlich darüber nachdenken konnte, sprang ich aus meinem Versteck und schlug dem Werwolf mit voller Kraft das Straßenschild auf die Nase. Er heulte so laut auf, dass mich Mitleid durchzuckte, als ich sah, wie er benommen zurücktaumelte. Doch für Reue war keine Zeit, denn ich wusste, dass er mir etwas viel Schlimmeres antun würde. Ich rannte los.
Zu meinem Unglück hatte das Geheul des Werwolfs die anderen ebenfalls auf mich aufmerksam gemacht und ich erreichte den Weg gleichzeitig mit einem anderen Werwolf. Ich konnte seinem zuschlagenden Gebiss gerade noch rechtzeitig ausweichen, ehe ich auch ihm mit voller Kraft auf die Schnauze schlug. Er taumelte zur Seite und ließ fürs Erste von mir ab, doch er war nicht allein, also ließ ich mir keine Verschnaufpause und hetzte weiter. Es fühlte sich so an, als würde der Schotterweg meine nackten Füße in Fetzen reißen, doch die Kreaturen in meinem Nacken trieben mich unaufhörlich voran.
Plötzlich ragte vor mir ein Gittertor auf, von dem Adam nichts gesagt hatte. Doch ich nahm mir nicht die Zeit, darüber nachzudenken, sondern beschleunigte nochmals, sprang ab und zog mich über den Rand auf die andere Seite. Es war viel zu hoch. Ich landete unsanft auf der anderen Seite und rollte ein Stück weiter, ehe ich mich abfing und langsam wieder auf die Füße kam. Es wäre mein sicherer Tod gewesen, hätten die Werwölfe nicht vor dem Tor gebremst, um jetzt wütend in meine Richtung zu knurren. Offenbar waren sie keine guten Kletterer. Mit dem Blick immer noch auf die Monster gerichtet, ging ich ein Stück rückwärts weiter, ehe ich mich umdrehte und schnell weiter humpelte. Ein erleichtertes Lächeln breitete sich auf meinem Gesicht aus, als ich den Bahnsteig ausmachen konnte. Deshalb wohl das Gittertor, als Werwolf-Schutz.
Ich stieg in den erstbesten Zug, der weiter ins Stadtinnere fuhr, und setzte mich auf einen der wenigen leeren Plätze. Die Blicke der Leute folgten mir wie Motten dem Licht, und ich konnte erahnen, was für einen Anblick ich abgeben musste. Völlig verdreckte, nackte Füße, ein zerschlissenes Minikleid und Schnittwunden am gesamten Körper. Erst jetzt fiel mir auf, dass ich immer noch das Straßenschild umklammert hielt und vermutlich wie eine Irre aussah. Es war mir egal. Der Eichenweg hatte mein Leben gerettet. Ich würde dieses Schild auf jeden Fall behalten.