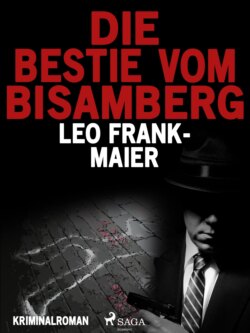Читать книгу Die Bestie vom Bisamberg - Leo Frank-Maier - Страница 6
ОглавлениеDie Kriminalbeamtin der Abteilung »Gewaltverbrechen« des Sicherheitsbüros in Wien hieß Birgit Herzog und war eine ebenso hübsche wie resolute Frau. Sie war 35 Jahre alt und seit zehn Jahren in diesem Beruf. In zehn Jahren Kriminaldienst erlebt man einiges, und sie hatte gelernt, sich durchzusetzen, sowohl bei ihren männlichen Kollegen als auch bei ihren »Kundschaften«. Das waren vornehmlich Prostituierte oder Ladendiebinnen, aber auch weibliche Verbrechensopfer, Jugendliche und Kinder. Es ist nun einmal so, daß Frauen oftmals zu ihren Geschlechtsgenossinnen mehr Vertrauen haben und bei Verhören einer weiblichen Beamtin Einzelheiten preisgeben, die sie einem Mann niemals sagen würden. Diese Erkenntnis hat sich auch die Kriminalpolizei zunutze gemacht: Sie bildet für alle Dienststellen Kriminalbeamtinnen aus. Im Durchschnitt kommt in Wien allerdings auf vierzig Kriminalbeamte nur eine Frau. Viel zuwenig, nach Ansicht von Birgit Herzog.
An diesem schwülen Nachmittag im August 1982 war die Frau Inspektor besonders übellaunig. Von Freunden hatte sie eine Eintrittskarte zu einer Aufführung bei den Salzburger Festspielen bekommen und hätte sich gerne zwei Tage Urlaub genommen, um sich den »Jedermann« anzusehen. Doch ausgerechnet da wurde wieder ein Notzuchtattentat auf eine junge Frau am nördlichen Stadtrand Wiens verübt, schon der siebte Fall dieser Art in drei Monaten. Keine Spur vom Täter, das Opfer war lebensgefährlich verletzt und lag auf der Intensivstation im Krankenhaus. »Du kannst jetzt keinen Urlaub nehmen, Biggi«, hatte der Chefinspektor gesagt, »das mußt du doch einsehen.« Natürlich sah sie es ein, aber das besserte ihre Laune keineswegs. So fuhr sie also ins Krankenhaus und hoffte, dort irgendwelche Hinweise auf den Verbrecher zu erhalten. Alles hing davon ab, ob die Frau überleben würde oder wenigstens noch etwas sagen konnte, bevor sie starb. Am Telefon hatte der Arzt mitgeteilt, daß die Patientin noch ohne Bewußtsein wäre. Biggi machte sich auf eine lange Nacht am Krankenbett gefaßt.
Im Spital befragte sie vorerst einmal den Arzt. Die Schädeldecke der Frau war zertrümmert, erfuhr sie, nach mehreren wuchtigen Schlägen mit einem schweren, stumpfen Gegenstand. Die Kriminalbeamtin wußte, daß es ein faustgroßer Stein gewesen war. Man hatte ihn am Tatort gefunden. Der Doktor machte ein bedenkliches Gesicht, dann eilte er zu einer Notoperation von dannen.
Biggi Herzog hatte darauf einen heftigen Streit mit der Stationsschwester, die ihr partout den Eintritt in das Zimmer der Schwerverletzten verwehren wollte.
Schließlich, nach einem harten Wortwechsel, kapitulierte die Krankenschwester. »Auf Ihre Verantwortung!« rief sie der in ihren Augen unverschämten Polizistin böse nach.
Die Verletzte hieß Maria Weber. Ihr Kopf war dick verbunden, die Augen geschlossen, sie atmete kaum hörbar. Biggi schob einen Sessel neben das Bett, setzte sich, ergriff eine Hand der Frau und streichelte sie zärtlich. Die Hand fühlte sich kalt und feucht an.
»Frau Weber«, sagte sie nach einer Weile leise, »können Sie mich hören?«
Das Gesicht der Frau blieb ausdruckslos. Biggi seufzte.
In der nächsten Stunde stellte sie diese Frage immer wieder. »Können Sie mich hören? Geben Sie mir ein Zeichen, wenn Sie mich hören können.« Aber es gab kein Zeichen.
Die Kriminalbeamtin kannte die sechs vorangegangenen Überfälle nicht nur aus den Akten, sie hatte die Opfer auch direkt befragt. Der Tathergang war immer der gleiche gewesen. Jede der Frauen war auf ihrem Heimweg von der Arbeit nach Einbruch der Dunkelheit in den menschenleeren Gassen des Wiener Vorortes überfallen worden. Der Täter hatte ihnen aufgelauert, sie zu Boden gerissen und gewürgt, um Hilfeschreie zu ersticken. Nachdem er seine Opfer wehrlos gemacht hatte, vergewaltigte er sie. Die Frauen vor Maria Weber hatten leichte Verletzungen erlitten, Kratzer am Hals und Hautabschürfungen. Nie aber hatte der Täter so brutal zugeschlagen wie im Fall der Maria Weber. Was die Kriminalbeamtin auf die Idee brachte, daß diese den Täter erkannt, ihn vielleicht sogar beim Namen genannt hatte. Woraufhin er ihr in der Absicht, sie zu töten, mit einem Stein den Schädel einschlug.
Es gab eine vage Personenbeschreibung des Täters: ein großer, schwerer Kerl, dessen Atem nach Alkohol stank. Für die Polizei stand fest, daß es immer ein und derselbe gewesen sein mußte.
Mehr als eine Stunde war mittlerweile vergangen.
Zuerst glaubte Biggi, sich getäuscht zu haben. Dann aber wurde es ihr zur Gewißheit: Die Augenlider des Opfers begannen zu flattern, als Biggi ihre Frage zum x-ten Mal wiederholte: »Sie können mich hören, Frau Maria, nicht wahr …? Ich bin Kriminalbeamtin. Wir müssen dieses Schwein erwischen, das Sie so zugerichtet hat. Ich glaube, Sie haben ihn erkannt. Ist das richtig …? Haben Sie ihn erkannt …?«
Maria Weber atmete jetzt heftiger. Wieder dieses Zittern in ihrem Gesicht, als ob sie verzweifelt versuchte, die Augen zu öffnen.
»Beruhigen Sie sich, Frau Maria. Ich glaube, Sie zu verstehen. Sie haben ihn erkannt, nicht wahr …? Sie haben ihn erkannt.«
Der Hauch eines »Ja« hing in der Luft.
»Wer war es, wer war dieses Schwein?« Sie streichelte jetzt die Wangen der Frau.
Unverständliche Laute. Das Gesicht begann sich zu verkrampfen.
»Beruhigen Sie sich, Maria. Ich hole jetzt den Arzt, bin gleich wieder da.«
Sie stand auf, eilte auf den Gang. Der Arzt trank gerade im Schwesternzimmer Kaffee. »Kommen Sie bitte rasch«, rief Biggi, »ich glaube, sie kommt jetzt zu Bewußtsein.« Es klang wie ein Befehl. Der Doktor ließ seinen Kaffee stehen und eilte mit ihr zur Intensivstation.
Dort warf er einen kurzen Blick auf die Apparaturen, an die Maria Weber angeschlossen war. Fühlte dann ihren Puls und hob mit dem Daumen ein Augenlid. »Die Frau ist tot«, sagte er dann und nickte der Stationsschwester zu, die ihn fragend angesehen hatte.
Als Chefinspektor Fichtl den Bericht der Kriminalbeamtin gelesen hatte, fiel ihm nur noch ein Wort ein: »Scheiße«, sagte er.
Birgit Herzog hatte einen knapp gehaltenen schriftlichen Bericht über den Tod der Maria Weber abgeliefert. Da sie jedoch Vertrauen zu ihrem Chef hatte, konnte sie ihm darüber hinaus auch ihre Empfindungen und Vermutungen mitteilen. »Es ist ein Jammer, daß sie nicht mehr reden konnte«, sagte sie. »Aber sie hat meine Fragen verstanden, und ich bin ganz sicher, daß sie den Täter erkannt hat. Das konnte ich natürlich im Bericht nicht schreiben, sonst hieße es gleich wieder, das sei Weiberphantasterei. Kennst ja unseren Hofrat.«
Fichtl stimmte ihr zu. Er war sehr nachdenklich geworden. »Wenn du recht hast, Biggi, dann müssen wir den Bekanntenkreis der Frau unter die Lupe nehmen«, sagte er. »Und die Gendarmerie muß uns dabei helfen.«
Die Überfälle waren alle knapp am Stadtrand passiert, wo die örtliche Kompetenz der Wiener Kriminalpolizei endet und die Zuständigkeit der Gendarmerie Niederösterreichs beginnt. Natürlich arbeiten beide im Normalfall zusammen, doch wenn zwei verschiedene Wachkörper eine Sache bearbeiten müssen, kann es schon einmal zu Kompetenzüberschreitungen kommen. Ohne gute persönliche Beziehungen geht da nichts: Das war es, was der Chefinspektor mit seinem letzten Satz gemeint hatte.
Die beiden waren noch mitten im Gespräch, als Hofrat Putner ins Büro kam, in der Hand einige Zeitungen und eine Personalakte. Der Hofrat war ein Mann um die sechzig und Leiter des Sicherheitsbüros. Auch Ambitionen auf den Posten des Wiener Polizeipräsidenten wurden ihm nachgesagt. Ein sehr ehrgeiziger Polizeijurist also. Jetzt war er, wie seine Miene zeigte, aufgeregt und verärgert.
»Das hat mir gerade noch gefehlt!« rief er und warf die Zeitungen auf einen Schreibtisch. »Diese verdammten Zeitungsfritzen! Das müßt ihr lesen … hier … Die Bestie vom Bisamberg hat wieder zugeschlagen! Grauenvoller Sexualmord in Stammersdorf! Polizei unfähig und hilflos! … nach dem siebten Überfall der Bestie …!«
Chefinspektor Fichtl blieb gelassen. Er kannte diese Pressemeldungen, sie regten ihn nicht mehr auf. »Wir werden ihn schon kriegen, Hofrat«, meinte er nur.
Dieser Satz beruhigte den Hofrat natürlich nicht, doch er hörte wenigstens auf zu schimpfen und wechselte das Thema. »Hat sich der Neue noch nicht gemeldet, dieser Inspektor Brucker?« fragte er nervös.
»Der tritt seinen Dienst doch erst morgen an«, antwortete Fichtl ruhig.
Der junge Peter Brucker hatte den einjährigen Lehrgang für Kriminalbeamte und die vorgeschriebene Abschlußprüfung eben erst bestanden und war von der Personalabteilung dem Sicherheitsbüro zugeteilt worden. Was außergewöhnlich war, denn das SB ist eine Art Elitetruppe bei der Kripo, und man mußte zuvor auf den Bezirks-Kommissariaten seine Meriten erworben haben, um dorthin versetzt zu werden. Es war Chefinspektor Fichtl gewesen, der seinen ganzen Einfluß geltend gemacht hatte, diesen Brucker in seine Abteilung zu bekommen. Das aber wußte Hofrat Putner nicht.
»Da ist die Personalakte des jungen Herrn«, sagte er anklagend. »Na, da haben wir ja einen schönen Fang gemacht! Ich habe die Akte gelesen. Neigt zur Oberflächlichkeit und Unpünktlichkeit, steht da drin. Und als sehr eigenwillig wird er beschrieben, und von seinen Vorgesetzten nimmt er wenig Notiz, steht da. – Ich verstehe nicht, wie man uns einen solchen Typen überlassen kann!«
Die Kriminalbeamtin kicherte leise. Sie kannte den Grund von Fichtls Bemühungen. Indigniert verließ der Hofrat das Büro, jetzt lachte Biggi laut. »Bin schon echt neugierig auf deinen Schützling, Chef.«
»Daß du dich bloß nicht verliebst in den Brucker«, grinste der Chefinspektor, »so wie ich vor einem Jahr.«
Vor einem Jahr war im 12. Wiener Gemeindebezirk ein Großkaufhaus überfallen worden, kurz nach Ladenschluß. Der unbekannte Täter war mit fast einer Million Schilling geflüchtet. Chefinspektor Fichtl recherchierte am Tatort. Er fluchte, weil gar kein Anhaltspunkt, keine Spuren zu finden waren. Ein dunkel gekleideter Mann mit dunkler Brille war plötzlich wie aus dem Boden gewachsen vor den Kassierern aufgetaucht und hatte mit einer Pistole gedroht, die Geldsäcke geschnappt und war darauf sofort wieder verschwunden. Als die Kassierer den Alarm auslösten, war von dem Täter nichts mehr zu sehen. Nur eine Zeugin, eine ältere Dame, wußte zu berichten, daß auf dem Parkplatz vor dem Kaufhaus, gerade als die Alarmsirenen zu heulen begannen, ein Auto wegfuhr. Es war schon dunkel, und ihr fiel auf, daß der Fahrer die Autoscheinwerfer nicht eingeschaltet hatte. Kennzeichen und Automarke konnte die alte Dame nicht angeben. Ein rotes Auto war es, mehr wußte sie nicht. Diese Nachricht war über Funk an alle Polizisten durchgegeben worden. Es wurden Straßensperren errichtet, und Polizeistreifen kontrollierten alle roten Autos in der Umgebung des Tatortes. Die Chance, den Täter zu finden, war gering.
Als die Tatbestandsaufnahme schon beendet war und Fichtl und seine Leute im Kommissariat Niederschriften und Berichte tippten, kam der diensthabende Wachkommandant herein und flüsterte Fichtl etwas ins Ohr. »Der Täter sitzt bei uns im Wachzimmer«, sagte er. »Geld und Tatwaffe sind sichergestellt, er ist geständig.«
Chefinspektor Fichtl glaubte zu träumen.
Unten im Wachzimmer deutete ein junger Polizist namens Peter Brucker auf einen gefesselten Mann, dann auf die Geldsäcke und eine Pistole. »Das ist der Trottel«, sagte der junge Polizist freundlich. Er hatte den Räuber festgenommen. Fichtl ließ sich den Sachverhalt von ihm unter vier Augen berichten.
Wachmann Brucker hatte an einer ungeregelten Straßenkreuzung Verkehrsdienst gehabt. Eine Stunde lang hatte er Halte- und Freizeichen gegeben. »Luftmischen« nennt man das bei der Sicherheitswache. Von dem Raubüberfall und der Fahndung nach dem roten Auto hatte er aus seinem Handfunkgerät gehört. Auf dem Weg in sein Wachzimmer mußte er an seinen Wachkommandanten denken, der mit ihm wieder unzufrieden sein würde. Im Rahmen eines sogenannten »Schwerpunktprogramms« sollte unverschlossen abgestellten Autos besondere Aufmerksamkeit gelten. Die hohen Herren Polizeistrategen waren nämlich der Ansicht, daß dieser Leichtsinn an den vielen Autodiebstählen schuld wäre. Der junge Wachmann Brucker teilte diese Ansicht allerdings nicht. Er hatte vor einigen Jahren einen Urlaub auf Zypern verbracht und festgestellt, daß dort kaum jemand sein Auto abschließt. Trotzdem wird selten gestohlen. Weil die Strafe für Diebstahl beträchtlich hoch ist und Diebe geächtet sind. Wachmann Brucker hatte also, im Gegensatz zu seinen Kollegen, noch kein unverschlossen abgestelltes Auto gemeldet.
Bis er vor einem Wohngebäude eines sichtete, einen roten Opel. Er wollte schon vorbeigehen, als ihm der Raubüberfall im Kaufhaus einfiel. Routinemäßig prüfte er Motorhaube und Auspuff, beides war noch warm.
Vom Hausmeister des Wohnblocks erfuhr er den Namen des Fahrzeugbesitzers. Ein paar Minuten später läutete er an dessen Wohnungstür. Als geöffnet wurde, grüßte er höflich, murmelte etwas von einer Routinekontrolle und fragte, wie lange der rote Opel schon vor dem Haus stehe.
Anton Germek, so hieß der Autobesitzer, erklärte überzeugend, daß er den ganzen Tag das Auto noch nicht bewegt habe, und wollte schon die Tür schließen. Das sollte ihm jedoch nicht gelingen. Erschrocken sah er, daß der freundliche Polizist plötzlich eine Pistole in der Hand hielt. Im Nu waren ihm Handschellen angelegt. Die Geldsäcke und die Pistole fand Peter Brucker im Wohnzimmer, Germek hatte ja noch keine Zeit gehabt, beides zu verstecken. Wieso die Polizei ihm so rasch auf die Spur gekommen war, verstand dieser ganz und gar nicht.
Chefinspektor Fichtl gefiel die Schilderung des Wachmanns ganz ausgezeichnet. Besonders imponierte ihm dessen bescheidene Darstellung, wonach das Ganze purer Zufall war. Er hätte sich ja als Sherlock Holmes aufspielen können, wie das so oft geschieht.
»Du hörst in den nächsten Tagen von mir, junger Kollege«, sagte der Chefinspektor. Dann befaßte er sich intensiv mit dem immer noch verwirrten Anton Germek.
Kurz danach erlebte Peter Brucker etwas Erfreuliches: Wegen außergewöhnlicher Dienstleistung wurde ihm ein lobendes Zeugnis überreicht – ein Zeichen besonderer Anerkennung für einen jungen Beamten wie ihn. Fichtl hatte das veranlaßt. Und dann wurde er eines Tages ins Sicherheitsbüro gerufen. Der Chefinspektor hätte mit ihm zu reden.
Der machte es sehr kurz. »Möchtest du Kriminalbeamter werden?«
Für Peter kam diese Frage völlig überraschend. »Natürlich möchte ich das«, sagte er. »Die Uniform los sein und mehr Geld verdienen, das wäre nicht schlecht. Aber ich habe doch keine Chance. Soviel ich weiß, kommen auf einen Dienstposten bei der Kripo fünfzig Bewerber. Oder noch mehr.«
»Bewirb dich trotzdem«, sagte Chefinspektor Fichtl, »alles weitere überlaß mir.«
»Keine Angst, Chef«, lachte Biggi Herzog. »Ich bin mehr für die reiferen Jahrgänge.« Dann wurde sie ernst. »Willst du den Brucker schon bei der Bisambergbestie einsetzen?« fragte sie.
Fichtl schüttelte den Kopf. »Zuerst muß er einmal bei uns das Gehen lernen«, sagte er. Dann telefonierte er mit dem Gendarmerieposten der Ortschaft Bisamberg. Er wollte mit dem Postenkommandanten reden. Der war aber im Außendienst. »Dann ruf ich morgen wieder an«, sagte Fichtl und legte auf. »Auf einen Tag wird es wohl jetzt nicht ankommen«, brummte er.
Am nächsten Morgen klingelte das Telefon, kaum daß Fichtl sein Büro betreten hatte. Es war der Bisamberger Postenkommandant, der meinte, es wäre höchste Zeit, sich einmal zusammenzusetzen. Dieser Meinung war der Chefinspektor ebenfalls und versprach, gleich hinauszufahren, bevor noch irgendein Hofrat oder Gendarmerieoberst etwas anderes anordnen konnte. Fichtl mußte so etwas wie eine Vorahnung gehabt haben, denn kaum war er draußen, kam Hofrat Putner herein und reagierte wie immer ziemlich verärgert, als Birgit Herzog ihm von Fichtls Weggang berichtete.
»Warum meldet er mir das nicht?« fauchte er. »Immer diese Eigenmächtigkeiten.«
»Aber Herr Hofrat«, versuchte Biggi zu beschwichtigen, »er wird Ihnen halt berichten, wenn er zurückkommt.«
»Dann ist es zu spät«, brummte Putner. Er erzählte daraufhin der Kriminalbeamtin, daß der Innenminister im Falle »Bisambergbestie« die Bildung einer Sonderkommission angeordnet hatte. Offenbar unter dem Druck der Presse sollte eine solche Kommission die Ermittlungen in diesem Fall koordinieren. »Die Zusammensetzung der Sonderkommission steht noch nicht fest, die einzelnen Mitglieder aus Polizei und Gendarmerie werden vom Ministerium bestimmt«, sagte der Hofrat.
Während er noch einmal seinen Unmut äußerte, klopfte es an der Tür, und ein junger Mann trat ein, grüßte freundlich. Er trug Bluejeans, darüber ein Jeanshemd mit aufgesetzten Taschen, die Ärmel hochgekrempelt. In einer Hand hatte er eine Plastiktasche.
»Sie wünschen bitte?« fragte der Hofrat knapp.
»Eigentlich nichts«, lächelte der junge Mann. »Ich soll mich hier zum Dienst melden. Mein Name ist Peter Brucker.«
Der Hofrat blickte scharf über seinen Brillenrand.
»Ach, Sie sind der Neue«, sagte er nur. Dann zu Birgit Herzog: »Der Chefinspektor soll sofort zu mir kommen, wenn er zurück ist.« Dann ging er. Unter der Tür drehte er sich noch einmal um. »Haben Sie keine Krawatte?« fragte er Brucker in scharfem Ton.
»Sogar fünf habe ich«, lächelte dieser, »sogar fünf.« Der Hofrat knallte die Tür zu.
»Wer war denn dieser Komiker?« fragte Brucker die Kriminalbeamtin. Mit unterdrücktem Lachen sagte sie: »Das war Hofrat Putner, der Leiter des Sicherheitsbüros.«
»Sieht so aus, als ob er mich nicht mag«, meinte Brucker unbekümmert. »Beruht aber ganz auf Gegenseitigkeit«, lächelte er wieder. »Und darf ich wissen, wer Sie sind?«
»Biggi Herzog, ich bin Kriminalbeamtin. Leider die einzige.«
»Tag, Biggi«, sagte er und streckte ihr die Hand hin. »Man sieht Ihnen an, daß Sie mehr kriminalistischen Verstand unter dem Rock haben als der Hofrat im Kopf.«
Sie wußte nicht, ob sie beleidigt reagieren oder lachen sollte.
»Bitte fassen Sie das als Kompliment auf«, sagte Brucker.
Da mußte Biggi doch laut und herzlich lachen.
Nachdem die Situation nun einigermaßen entspannt war, wollte Brucker wissen, ob es hier so etwas wie einen Schreibtisch für ihn gäbe. »Der Tisch dort in der Ecke«, sagte Biggi, »er wackelt zwar ein bißchen, aber daran gewöhnen Sie sich.«
Brucker ging in die Ecke.
»Das also ist mein neuer Arbeitsplatz«, sinnierte er. Der Schreibtisch wackelte wirklich beträchtlich. »Gibt es hier auch eine Dienstvorschrift für Kriminalbeamte?« Die Frage kam einigermaßen überraschend.
»Dort im Bücherregal, ganz rechts oben, in Leder gebunden«, sagte die Kriminalbeamtin.
Brucker holte sich das Büchlein.
Er ging wieder zu seinem Schreibtisch, schob die Dienstvorschrift unter das kürzere Tischbein. »Paßt genau«, sagte er. »Ich hab’ schon immer gewußt, daß eine Dienstvorschrift praktisch anwendbar sein kann.«
Peter Brucker wurde 1952 in Wien als uneheliches Kind geboren, seinen Vater hatte er nie kennengelernt. Die Mutter sprach wenig über ihn. Sie arbeitete als Verkäuferin in einem Textilgeschäft, und der kleine Peter war tagsüber in einem Kinderhort. Abends holte ihn seine Mutter dort ab. Die Wochenenden und Feiertage verbrachte er ganz bei ihr. Mit sechzehn begann er eine Lehre als Schlosser. Erst ab dieser Zeit vergaß er allmählich den Makel seiner unehelichen Geburt und die hämischen Fragen taktloser Mitschüler nach seinem Vater. Er war ein schlanker, gutaussehender junger Mann mit großem Interesse an Sport. Er spielte Tennis und Fußball in einem Unterklassenverein und träumte davon, einmal ein Profi zu werden.
Daraus wurde nichts, denn nach Abschluß seiner Lehrzeit fand er eine Stelle in einer Autofabrik und hatte viel zuwenig Zeit für ein geregeltes Training. Drei Jahre arbeitete er dort, dann spielte seine Mannschaft eines Sonntags gegen eine Mannschaft der Polizei. Unter seinen Gegenspielern waren ein paar nette Burschen, zu denen sich eine Art Freundschaft entwickelte. Er interessierte sich für deren Arbeit, und sie rieten ihm, sich doch einfach bei der Polizei zu bewerben. So absolvierte er die Eignungsprüfungen und besuchte dann zwei Jahre die Polizeischule. Anschließend fand er eine Stelle auf einem Kommissariats-Wachzimmer. In der Polizeischule wurde viel Wert auf körperliche Ertüchtigung gelegt, man trainierte hart, sehr zur Freude des jungen Brucker. Seit drei Jahren war er stolzer Titelverteidiger des österreichischen Polizei-Fünfkampfmeisters.
Abgesehen vom Sport interessierte sich Peter Brucker vorwiegend für zwei Gebiete. Erstens für das weibliche Geschlecht und zweitens für Psychologie. So selbstverständlich das eine war, so ungewöhnlich war das andere Hobby bei einem jungen Mann. Mit beidem befaßte er sich in Theorie und Praxis gleichermaßen intensiv, wenn auch seine praktischen Aktivitäten bei den Weibern bei weitem überwogen. Mit der Psychologie war das umgekehrt, da hatte mangels praktischer Möglichkeiten die Theorie Vorrang. Immerhin studierte er sehr ernsthaft die Werke von Wertheimer, Köhler und natürlich die von Sigmund Freud.
Seine Mutter hatte mittlerweile einen Lebensgefährten gefunden. Um die beiden nicht zu stören, und wohl auch, um selbst nicht gestört zu werden, mietete er sich eine kleine Junggesellenwohnung. Sie bestand nur aus einem einzigen Raum und einer Duschkammer, entsprach aber ansonsten all seinen Wünschen. Die Einrichtung bestand aus einem riesigen Bett mit vielen Decken und Polstern, daneben hatte er quer durch das Zimmer eine Hängematte gespannt. An der Wand hatte er ein Regal mit vielen Büchern festgemacht. Das war alles. Kleider, Schuhe und andere weniger wichtige Gegenstände des täglichen Lebens wurden mehr oder minder sorgfältig in den Zimmerecken verstaut.
Als Chefinspektor Fichtl von dem Gendarmerieposten Bisamberg zurück in sein Büro kam, hatte Hofrat Putner bereits zweimal nach ihm telefoniert. So blieb Fichtl gerade so viel Zeit, seinem Schützling Brukker die Hand zu drücken und eine Zigarette zu rauchen. Dann ging er hinüber in das Büro des Abteilungsleiters. Er blieb fast eine Stunde dort. Biggi Herzog meinte, das verheiße nichts Gutes. Und sie sollte recht behalten.
Als Fichtl in sein eigenes Büro zurückkam, schenkte er sich erst einmal einen Schnaps ein. Einen doppelten. Er trank langsam und wortlos. Das war bei ihm üblich, wenn er ein ernstes dienstliches Problem hatte. Beim zweiten Glas schilderte er seinen Mitarbeitern die Situation:
Die Sonderkommission zur »Bisambergbestie« war konstituiert, sie bestand aus sechs Mitgliedern: einem Gendarmeriegeneral, einem Gendarmerieoberst, einem Ministerialrat des Innenministeriums und dem Hofrat Putner vom Sicherheitsbüro, dem Chef des Gerichtsmedizinischen Instituts und zuletzt – und das war für Fichtl das schlimmste – aus einem Psychiater. Die Kommission würde ab morgen täglich um 10 Uhr zusammentreten, um den Stand der Ermittlungen zu diskutieren und die weiteren Fahndungsmaßnahmen zu beschließen.
Mit anderen Worten: Fichtl mußte Hofrat Putner täglich um 9 Uhr berichten und gegen elf die Weisungen der Kommission in Empfang nehmen. Er hielt überhaupt nichts von dem Ganzen, denn was sollte schon dabei herauskommen, wenn ein halbes Dutzend Theoretiker gescheit und wissenschaftlich daherredet. Leute, die ihre kriminalistischen Kenntnisse aus Lehrbüchern, Fachschriften oder Seminaren geschöpft hatten. Und von denen keiner auch nur einen Fahrraddiebstahl geklärt hatte.
Dabei hatte der Tag für Fichtl so hoffnungsvoll begonnen. Der Bisamberger Postenkommandant, den er getroffen hatte, hieß Hans Binder und war ein Mann ganz nach dem Geschmack des Chefinspektors. Ein Praktiker, der das Leben und auch die Menschen in seiner Abteilung kannte, dem gesunder Hausverstand über alles ging. Die beiden hatten sich vom ersten Augenblick an gut verstanden. Als Fichtl erzählte, daß nach Ansicht seiner Kriminalbeamtin der Verbrecher eventuell von der Ermordeten erkannt worden war, hatte Binder zustimmend genickt. Beide hatten daraufhin beschlossen, daß der Postenkommandant sich nun auf den Bekanntenkreis der Maria Weber konzentrieren werde. Auch vereinbarte man gemeinsame Nachtstreifen in der kritischen Gegend zu den kritischen Zeiten. Der Erfolg dieses Unternehmens fand sich aber jetzt, da die Sonderkommission das Sagen hatte, in Frage gestellt.
»Was haben denn die Gescheitwascheln in der Kommission vor?« fragte Biggi, nachdem Fichtl ihr von der Zusammenkunft berichtet hatte.
»Was die Polizei immer tut, wenn gar keine Spur vorhanden ist«, seufzte Fichtl. »Aufrufe an die Bevölkerung zur Mitarbeit, das heißt Aussetzung einer Geldprämie für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, Aufforderung an Frauen, nach Einbruch der Dunkelheit die betreffende Gegend zu meiden. Der übliche Blödsinn halt.«
In den nächsten Tagen lernte Peter Brucker also »das Gehen« bei der Kriminalpolizei, wie es der Chefinspektor formuliert hatte. Er lernte die Aktenerledigung und das Priorieren, er lernte seine Kollegen kennen, stellte fest, daß es hier wie überall hilfsbereite, abweisende und gleichgültige Mitarbeiter gab. Er erfuhr von den Möglichkeiten und Grenzen der Kriminaltechnik und des Erkennungsdienstes, und er lernte die Polizeijuristen des Sicherheitsbüros zu schätzen oder aber zu verabscheuen – zumeist war letzteres der Fall.
Er informierte sich über die Methoden der Fahndungsgruppe und war beeindruckt von den Lokal- und Personalkenntnissen dieser Kollegen. Sie kannten tatsächlich nicht nur die Ganoven, Zuhälter und Huren der einzelnen Bezirke persönlich, sondern waren auch mit deren Lebensgewohnheiten vertraut. Vieles zeigte sich in der Realität ganz anders, als man es ihm in der Kriminalbeamten-Schule beigebracht hatte, und oftmals dachte er über die Gründe nach, warum bei der Kriminalpolizei zwischen Theorie und Praxis eine so große Kluft besteht.
Wann immer er Zeit hatte, studierte er die dicke Akte über die Verbrechen der Bestie vom Bisamberg und versuchte von der Kriminalbeamtin Herzog weitere Einzelheiten zu erfahren, die nicht in der Akte standen. Biggi war grundsätzlich freundlich und hilfsbereit, aber sie hatte eben auch ihre eigene Arbeit mit ihren Problemen und war nicht immer zu Plaudereien mit dem neuen Kollegen aufgelegt. Chefinspektor Fichtl konnte sich um die praktische Ausbildung von Peter Brucker auch nicht so intensiv kümmern, wie er es gerne getan hätte. Denn all seine Befürchtungen bezüglich der Sonderkommission waren eingetreten, und er war ständig mit den Anweisungen von Hofrat Putner beschäftigt. »Alles leere Kilometer«, antwortete er nur auf neugierige Fragen des jungen Brucker.
Die »Hinweise aus der Bevölkerung«, die nach den massiven Presseverlautbarungen der Sonderkommission über die Bisambergbestie eingelangt waren, füllten einen eigenen Ordner. In Aktenvermerken hatten alle Sicherheitsdienststellen festgehalten, was brave Staatsbürger schriftlich oder mündlich den zuständigen Ordnungshütern anvertraut hatten. Der Chefinspektor blätterte in diesem Ordner nur flüchtig. Er fluchte und meinte, ebensogut wie diese Aussagen könnte er ein Mickey-Mouse-Heft lesen, es käme auf dasselbe heraus. Tatsächlich enthielt der Ordner überwiegend Meldungen von seiten älterer Menschen, die Nachbarn verdächtigten, weil diese ihre Hunde mißhandelten, öfter betrunken randalierten oder einen »stechenden Blick« hatten. Nur Biggi Herzog widmete diesen Meldungen täglich Aufmerksamkeit. Nach der Lektüre schien sie jedoch immer wieder enttäuscht zu sein. Neugierig fragte Brucker sie daher eines Tages, was sie denn von den »Hinweisen aus der Bevölkerung« eigentlich erwarte. Ihre Antwort überraschte ihn:
»Ich hoffe immer noch, daß sich einmal eine bisher unbekannte Frau meldet, die behauptet, ebenfalls überfallen worden zu sein«, sagte sie.
»Eine Frau, die wir noch nicht kennen …?« fragte er. »Was meinst du damit?«
»Ich bin ganz sicher, daß es einige gibt«, sagte Biggi. Und dann erklärte sie: Nach ihren Erfahrungen erstatten viele Frauen nach einem Sexualattentat keine Anzeige. Aus Schamgefühl und Angst vor dem dummen Gerede, das dann in ihrem Bekanntenkreis entsteht. Weil die Zeitungen solche Fälle gerne bis ins Detail berichten und bei Gerichtsverhandlungen die Verteidiger der Täter peinliche Fragen stellen: Ob die Opfer die Notzucht vielleicht durch provozierendes Verhalten selbst verursacht, eingeleitet hätten. Ob ihnen vielleicht der ganze Notzuchtvorgang gar nicht so unangenehm gewesen wäre.
»Ich bin ganz sicher«, wiederholte Biggi heftig, »daß es einige gibt, von denen wir gar nichts wissen. Und die uns helfen könnten. Aber es ist ja kein Wunder, wenn die das Maul halten. Wer will schon in der Zeitung namentlich und mit Foto als Opfer der Bisambergbestie vertreten sein.«
Peter Brucker hatte darauf geschwiegen. Aber als Biggi den Ausdruck »provozierendes Verhalten« gebraucht hatte, da war ihm zum ersten Mal der zündende Gedanke gekommen. Die Idee, wie man den Täter vom Bisamberg ausfindig machen könnte …
Für seine privaten Hobbys hatte Peter wenig Zeit in diesen turbulenten Tagen. Statt Sigmund Freud las er die Akte über die Bisambergbestie, und seine lockeren Mädchenkontakte reduzierte er auf Erika. Nicht daß er etwa in das Mädel verliebt gewesen wäre, umgekehrt war das wohl auch nicht der Fall. Aber es schmeichelte seiner männlichen Eitelkeit, wenn er mit Erika in ein Lokal ging und alles rundherum sie angaffte und tuschelte. Sie war ein außergewöhnlich hübsches Mädchen, die blonde Erika, mit guten Chancen, die Wahl zur Miss Vienna oder Miss Popo zu gewinnen. Doch sie hätte so etwas wie einen Manager zum Freund gebraucht, keinen Kriminalbeamten. Denn ihr Beruf, sie war Friseurin, brachte sie kaum mit einflußreichen Leuten zusammen, und ohne die landet man als Fotomodell – und das wollte sie werden – höchstens in drittklassigen Porno-Heftchen.
Peter saß mit seiner schönen Erika in einem Bistro in der Nähe seiner Wohnung, und sie beschwerte sich schon seit einer Viertelstunde, weil er sie so lange hatte warten lassen. Sie waren zum Kino verabredet gewesen, und nun verpaßte sie Rhett Butler in »Vom Winde verweht«. Erikas Lieblingsfilm. Peter hatte seine Unschuld beteuert und ihr zu erklären versucht, daß Kriminalbeamte ihre Arbeit nicht einfach nicht acht Stunden hinlegen können, aber Erika hielt das für eine faule Ausrede. Als sie dann, immer noch wütend, mit wiegenden Hüften auf die Toilette ging und er ihr interessiert nachsah, fiel ihm wieder Biggis Formulierung vom »provozierenden Verhalten« ein, worauf er beschloß, mit Erika über seinen Plan zu reden.
Er tastete sich sehr vorsichtig an das Thema heran, als sie wieder an seinem Tisch saß.
»Wollen wir vielleicht nach Stammersdorf fahren?« fragte er einschmeichelnd. »Nach Bisamberg?«
»Zum Heurigen?« reagierte sie erfreut.
»Na, nicht direkt«, schränkte er ein. Dann erklärte er ihr, wie er sich das vorstellte: Sie sollte von der Straßenbahn-Endstation Stammersdorf über den Feldweg in Richtung Bisamberg spazieren. Er würde in angemessener Entfernung folgen. So ein abendlicher Spaziergang würde sicher nicht schaden, und nachher könne man in Bisamberg ja ein Heurigenlokal besuchen, etwas essen und trinken.
Ihr Gesicht war jetzt so finster wie vorhin nach dem versäumten Film.
Sie zischte: »Du willst mich als Köder benutzen, du Dreckskerl. Denkst du, ich lese keine Zeitungen? Du willst diese Bisambergbestie fangen, und ich soll den Lockvogel spielen …«
Er versuchte sie zu beruhigen: »Ich bin ja in deiner Nähe, passe auf dich auf …«
Sie war aufgestanden, nahm ihre Handtasche.
»Das ist doch das Letzte!« sagte sie wütend. »Du mieses Polizistenschwein, ich will dich nie wieder sehen …«
Sie verließ das Lokal, und er mußte die schadenfrohen Blicke anderer Gäste ertragen. Mit Erika ging es also nicht. Und dabei hatte er sich alles so einfach vorgestellt. Wenn der Täter über sie hergefallen wäre, hätte er ihn sofort überwältigen, festnehmen und der Gendarmerie übergeben können. Und er wäre der Held des Sicherheitsbüros geworden. Doch eigensinnig wie er war, gab er seinen Plan nicht auf. Irgend jemand würde sich finden, der mitmachte.
Am nächsten Morgen musterte ihn der Chefinspektor eine Weile und fragte dann, ob er für den Abend schon etwas vorhabe. Peter verneinte erstaunt.
Fichtl erklärte, daß er mit der letzten Straßenbahn nach Stammersdorf fahren und dort ein Lokal besuchen wolle. Ob der junge Inspektor Brucker mitkommen wolle …? Jetzt verstand Peter überhaupt nichts mehr. Sein Chefinspektor konnte eine Nachtstreife doch einfach anordnen und mußte nicht höflich herumfragen, ob er Zeit habe.
Fichtl wurde jetzt deutlicher: Es sei ja bei der Kriminalpolizei so, daß außerplanmäßige Nachtdienste als Überstunden bezahlt werden. Solche Dienste bedürften jedoch der Unterschrift des Abteilungsleiters. Was Fichtl vorhatte, wollte er aber Hofrat Putner nicht unbedingt sagen. Also müßten beide sozusagen privat und ohne Bezahlung auf Tour gehen.
Peter war mit dem Plan einverstanden. Da erzählte ihm sein Chef, was der Postenkommandant Binder festgestellt hatte: Jede der sieben überfallenen Frauen war mit der letzten Straßenbahn der Linie 31 von der Innenstadt bis zur Endstation Stammersdorf gefahren und von dort zu Fuß weitergegangen. Fichtl wollte sich das jetzt einmal ansehen und dann mit Binder plaudern. Nicht am Gendarmerieposten, in einem Wirtshaus. Wenn er diese Tatsache jetzt Putner melden würde, wüßte es am nächsten Tag die hohe Sonderkommission, und das wollte sowohl Fichtl als auch Binder vermeiden.
Die letzte Bahn der Linie 31 fährt vom Schottenring im ersten Bezirk um 23.30 Uhr nach Stammersdorf und bleibt dort in der Remise bis zum nächsten Tag um 5 Uhr früh. An der Haltestelle Schottenring mischten sich Fichtl und Brucker unter die wartenden Menschen und taten so, als wären sie sich fremd.
Man konnte beobachten, daß diese Straßenbahn von fast immer denselben Menschen benutzt wurde. Man kannte einander vom Sehen, nickte einander zu und wechselte belanglose Worte. Männer und Frauen, die in der Innenstadt arbeiteten und jetzt nach Hause fuhren. Sie wirkten müde und abgespannt nach einem anstrengenden Arbeitstag. Alle waren einfach gekleidet. Die Frauen trugen Taschen, einige Männer hielten Plastiktüten in der Hand, in denen Werkzeug schepperte oder auch Bierflaschen klirrten.
Im schwach beleuchteten Waggon war noch etwa ein Drittel der Sitzplätze frei. Die Fahrt dauerte dreißig Minuten, von Haltestelle zu Haltestelle wurde es leerer. Ab Groß-Jedlersdorf waren noch zwanzig Fahrgäste im Wagen, Fichtl und Brucker inbegriffen.
Man döste vor sich hin, denn das Rattern der Straßenbahnen wirkt einschläfernd. Ein dicker Mann, der Brucker schräg gegenüber saß, öffnete eine Flasche Bier und trank gierig. Eine offensichtlich schwangere Frau neben ihm strickte an einem Babyjäckchen. Der Dicke wollte mit ihr ins Gespräch kommen, aber die Schwangere sah nicht auf und gab kaum Antwort.
»Endstation Stammersdorf, alles aussteigen«, tönte es krächzend aus dem Lautsprecher. Alle stiegen aus. Nach wenigen Minuten hatten sich die Fahrgäste verstreut, waren auf dem Weg zu ihren Wohnungen. Fichtl und Brucker waren allein. »Wie geht es weiter, Chef?« fragte Brucker.
»Wir gehen jetzt in den Schwarzen Adler«, sagte Fichtl. »Das ist gleich da drüben. Und wenn ich mich dort in ein Gespräch einmische, dann hörst du nur zu und mischst dich nicht ein, ist das klar?«
»Alles klar, Herr Kommissar«, grinste Brucker.
Der Wirt vom Schwarzen Adler empfing die beiden mit »Sperrstunde, meine Herren«. Aber er hatte es nur spaßhaft gemeint, denn er ließ sie eintreten und sich zum Postenkommandanten Binder setzen. Binder war zwar in Zivil, doch da im kleinen Stammersdorf jeder jeden kennt und der Herr Inspektor jetzt für die beiden Fremden je ein Viertel Wein bestellte, war natürlich von Sperrstunde noch lange keine Rede.
Nur noch wenig Gäste waren im Schwarzen Adler.
Genaugenommen waren Binder und die beiden Fremden die einzigen, die an einem Tisch saßen. An der Theke standen noch fünf Männer und tranken ihr Bier. Der Dicke mit der Bierflasche aus der Straßenbahn war auch darunter. Alle fünf waren leicht angesäuselt und schimpften lauthals über die Politik und die Politiker. Dann war das Wetter dran, weil es schon so lange nicht mehr geregnet hatte und die Weinstauden am Bisamberg verdorrten, und schließlich ließen sie sich über die unfähige Polizei aus, die einem zwar wegen eines oder zwei Viertel Wein zuviel den Führerschein abnahm, die Bisambergbestie aber immer noch nicht gefunden hatte. Ängstlich beobachtete der Wirt die drei am Tisch, er wollte keinen Ärger haben.
»Das hätt’s unter dem Hitler net gegeben!« schrie der Dicke. Er war jetzt sichtlich betrunken.
»Kusch, Ferdl«, sagte der Wirt, »da bist du noch zu jung dazu, das verstehst du net.«
»Die Todesstrafe gehört wieder her!« schrie der Ferdl und trank sein Glas leer. Seine Freunde murmelten zustimmend. »Kusch, Ferdl«, sagte der Wirt noch einmal und warf einen Blick zum Postenkommandanten. Der aber kümmerte sich nicht um die Schimpfenden. Die drei am Tisch hatten die Köpfe zusammengesteckt und unterhielten sich sehr leise.
Hans Binder hatte eine Liste von den Männern der Ortschaft zusammengestellt, welche die Maria Weber gekannt haben mußte. Es ergab sich, daß ein einschlägig als solcher bekannter Sittlichkeitsverbrecher nicht darunter war. Einige hatten Vorstrafen wegen Körperverletzung, aber alles in allem nichts Aufregendes. Die üblichen Wirtshausraufereien. Fichtl erhielt einen Durchschlag der Liste ausgehändigt. Von draußen hörte man jetzt Hundegebell.
»Das ist meine Sonderstreife«, erklärte der Postenkommandant. »Ich habe einen Fährtenhund angefordert, mit dem ab jetzt meine Leute täglich von dreiundzwanzig Uhr bis zwei Uhr früh in der Gegend patrouillieren.«
»Weiß das die Sonderkommission?« fragte Fichtl.
»Sie werden es morgen erfahren«, antwortete Binder verdrossen.
»Wir werden den Täter damit zwar verscheuchen, aber nicht erwischen«, sinnierte Fichtl.
Binder meinte, er wäre sehr froh, wenn nichts mehr passieren würde. Dann machte er Fichtl einen leisen Vorwurf: »Ihr hättet der Presse nicht sagen sollen, daß die Weber Mitzerl nicht mehr reden konnte. Hätte in einer Zeitung gestanden, sie hätte noch geredet – wer weiß, der Strolch hätte vielleicht reagiert und sich dadurch verraten.«
Fichtl nickte. »Ja«, gab er zu, »das ist versäumt worden.«
Brucker hatte den beiden aufmerksam zugehört, dabei immer wieder die Männergruppe an der Theke beobachtet. Jetzt gab er seinem Chef ein Zeichen. Er sollte ja nicht unaufgefordert reden.
»Was ist?« fragte Fichtl.
»Wer ist denn der besoffene Fettling dort?« fragte Brucker. »Er ist mit unserer Straßenbahn gekommen.«
»Ferdinand Polacek«, sagte der Postenkommandant. »Arbeitet als Tankwart in der Stadt. Ihr findet ihn auf der Liste. Er wohnt neben dem Elternhaus der Weber Mitzi. Viermal die Woche besoffen, aber sonst harmlos.«
Die Tür ging auf, und ein unangenehmer Typ kam herein. Jüngerer Mann mit langem Haar, Ohrstecker, schwarze Lederjacke, auf der Bildchen von nackten Weibern klebten.
»Der steht auch auf der Liste«, sagte Binder. »Leopold Kucharsky, ein Cousin des Wirts. Arbeitet hier aushilfsweise als Kellner. Hat es bei der Weber Maria immer wieder probiert, sie hat ihn aber abgelehnt.«
»Kann ich verstehen«, murmelte Fichtl und beobachtete den Leopold.
»Ich brauch’ dich heut’ nicht, Poldl«, sagte der Wirt, »ist ja nichts los.«
Der Poldl nickte, schenkte sich ein Glas ein und stellte sich zu den anderen. »Draußen ist alles voller Gendarmen«, sagte er. »Einen Hund haben’s jetzt auch. Das wird denen auch nichts nützen. Mit einem Hund werden’s die Bestie nicht fangen.«
Es entwickelte sich eine rege und laute Diskussion über den Wert eines Polizeihundes bei der Verbrechensbekämpfung. Mit jedem Schluck Wein wurden die vorgebrachten Argumente heftiger.
»Hör sie dir an«, meinte Binder. »In einer haben Stunde gehen dann alle heim, voll von Alkohol und Aggressionen. Und dann ist jedem alles zuzutrauen. Oder fast alles.«
Fichtl und Brucker fuhren mit einem Taxi zurück in die Innenstadt. In einem Café am Schottenring genehmigten sich die beiden noch ein Glas Wein. Dem Chefinspektor war anzumerken, daß er mit der Situation im Fall »Bisambergbestie« gar nicht zufrieden war.
»Er wird jetzt nicht zuschlagen, solange die Gendarmeriestreifen unterwegs sind«, sinnierte er. »Aber ewig kann man ja die Gegend nicht lückenlos überwachen. Ich muß mir da etwas einfallen lassen.«
»Wie wäre es mit einem Köder?« fragte Brucker unvermittelt.
»Ein Köder …?«
Brucker erklärte, er könne schon irgendwo eine junge Frau auftreiben, die für ihn die Feldwege nach Bisamberg benutzen würde. Sie müßte aber mit der letzten 31 er nach Stammersdorf fahren und das Ganze einige Nächte lang in aufreizender Kleidung durchexerzieren. »Es kann nichts passieren, Chef«, sagte er eifrig. »Ich bin immer in ihrer Nähe. Wenn er zuschlägt, dann fass’ ich ihn.«
»Vergiß diesen Blödsinn«, sagte Fichtl ernst.
»Aber warum, Chef?« Brucker war enttäuscht.
»So etwas nennt man ›agent provocateur‹, das ist nach der Strafprozeßordnung streng verboten. Wenn Hofrat Putner das erfährt, reißt er uns den Arsch auf.«
Für den Chefinspektor war dieses Thema hiermit erledigt. Nicht aber für den eigensinnigen jungen Brucker.
Kriminalbeamte müssen gemäß einer generellen Anordnung der Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit bis zu ihrem 42. Lebensjahr zweimal im Monat zum Judo-Training. Dieses Training findet zumeist morgens von 8 bis 10 Uhr statt. Die leitenden Kriminalbeamten sorgen dafür, daß sich keiner ihrer Untergebenen davor drücken kann, denn die Judo-Trainingsstunden sind nicht bei allen beliebt. Auch Kriminalbeamtinnen müssen daran teilnehmen, denn sie haben dieselben Rechte und Pflichten wie ihre männlichen Kollegen.
Am Tag nach dem Ausflug Fichtls und Bruckers nach Stammersdorf gingen Biggi und Brucker zum Judo-Training und kamen daher erst um 10 Uhr vormittags ins Büro. Biggi mit geröteten Wangen nach der heißen Dusche, Peter Brucker mit einem blauen Auge.
»Was ist denn mit dir passiert?« grinste Fichtl.
»Ah, die Biggi, dieses grobe Luder«, sagte Peter nur.
»Ich kann nichs dafür«, protestierte Biggi. »Wenn er bei den Abwehrgriffen so langsam schaut, dann passiert das eben.«
Der Chefinspektor lachte.
»Mach dir nichts draus«, tröstete er Brucker. »Die Biggi war einmal Jugendmeisterin im Judo und nimmt diesen Sport immer noch sehr ernst.«
Irgendwie beruhigte das Peter Brucker. »Nach dem nächsten Training muß sie ins Krankenhaus, Chef«, sagte er drohend.
»Wenn ihr mit euren Kindereien fertig seid«, sagte der Chefinspektor nun ernst, »darf ich euch vielleicht von den neuesten Anordnungen der Sonderkommission berichten.«
Fichtl machte es kurz:
»Alle in den letzten zehn Jahren wegen Sittlichkeitsdelikten gerichtlich abgeurteilten Personen männlichen Geschlechtes sind listenmäßig zu erfassen und für die Tatzeiten auf ihr Alibi zu überprüfen.«
»Aha«, meinte Peter Brucker interessiert.
Jetzt explodierte der Chefinspektor.
»Nix aha!« schrie er. »Merkst du nicht, was das für eine unsinnige Arbeitslawine ist?! Die von der Justiz werden uns jetzt eine Liste von einigen hundert Männern schicken, die wir alle befragen müssen. Die Antworten kenne ich im voraus. Oder weißt du vielleicht, wo du am Dienstag vor drei Monaten um 22.30 Uhr gewesen bist?! Du weißt es nicht mehr, stimmt’s?! Na also!!«
Brucker rieb sich sein blaues Auge. »Ach so meinen Sie das«, sagte er kleinlaut.
Dann dachte er eine Weile nach. »Meine Idee mit dem Köder wäre vielleicht doch erfolgversprechender«, wagte er vorzubringen. Er bereute es gleich wieder.
»Ich will davon nichts mehr hören«, sagte der Chefinspektor in sehr bestimmtem Ton. Da klingelte das Telefon, Fichtl mußte zu Hofrat Putner.
»Was war denn das für eine Idee mit dem Köder?« fragte Biggi neugierig.
Peter erzählte ihr alles. Auch seinen Reinfall mit Erika, er hatte sie seit damals nicht mehr gesehen.
»Du mußt das Mädel verstehen«, sagte Biggi. »Warum sollte sie sich Unannehmlichkeiten und Gefahren aussetzen? Das Ganze geht sie doch nichts an.«
Peter wurde nachdenklich.
»Hast du eigentlich Schuhe, die quietschen?« fragte er plötzlich.
»Was …??«
»Ob du daheim Schuhe hast, die quietschen?«
»Ist dir nicht gut? Hab’ ich vielleicht beim Judo zu fest hingelangt? Hast du Kopfschmerzen?«
Er lächelte.
»Ich hab’ mir nur gedacht«, sinnierte er, »daß, wenn ich einer Frau in der Nacht auf dem Feldweg nach Bisamberg folge, es doch gut wäre, wenn ihre Schuhe Geräusche verursachen. Ich kann mich dann orientieren und in Hörweite bleiben.«
»Ach, so meinst du das«, sagte sie leise.
Sie mußte jetzt an die Stunde am Bett der Maria Weber denken. Wie qualvoll diese arme Kreatur gestorben war. Sie sah ihr verkrampftes Gesicht, ihre flatternden Augenlider noch lebhaft vor sich.
»Du wirst lachen«, sagte sie. »Ich habe ein Paar Schuhe, die quietschen.«
Eine Minute lang schwiegen sie.
»Du bist ein Superweib«, sagte Peter bewundernd.
Ihre Antwort löste Heiterkeit in ihm aus. Sie gab genau denselben Satz von sich, den Fichtl um zwei Uhr früh in dem Café am Schottenring gesagt hatte: »Wenn Hofrat Putner das erfährt, reißt er uns den Arsch auf.«
Chefinspektor Fritz Fichtl war einer der erfolgreichsten Kriminalbeamten der Polizeidirektion Wien. Wenn er sich nicht gerade in seinem Büro über Sonderkommissionen und Hofräte ärgerte, saß er zumeist in seinem Stammlokal, im Café Martha. Er war geschieden, Kinder hatte er keine, und er fürchtete sich vor seiner leeren Wohnung. Zu bestellen brauchte er im Martha schon nicht mehr. Automatisch servierte ihm die Kellnerin sein Glas Wein und ein Tellerchen mit Erdnüssen. Er war ja dort wie zu Hause. Und wahrscheinlich hielt er sich in dem Café öfter und länger auf als in seiner Wohnung.
An diesem Abend dachte Fichtl bei zwei Gläsern Wein über den Fall »Bisambergbestie« nach. Beim dritten Glas jedoch schlugen seine Gedanken eine andere Richtung ein: Er überlegte ernsthaft, ob er vorzeitig in Pension gehen sollte. Rein formell könnte es da keine Schwierigkeiten geben. Der Polizeiarzt war ein Freund von ihm, und der würde schon irgendeinen Grund zur Pensionierung finden, wenn er ihm entsprechend vorjammerte. Aber was dann? Den ganzen Tag im Café Martha sitzen und Wein trinken war auch kein erstrebenswerter Lebensabend. Andererseits hatte er nach vierzig Dienstjahren »die Schnauze voll«, wie man so schön sagt. Immer unwilliger machte er seine Arbeit, und daran war nicht nur sein Alter schuld. Seine Vorgesetzten, die Herren Polizeijuristen, wechselten ständig, und sein jetziger Abteilungsleiter, Hofrat Putner, mochte ihn überhaupt nicht. Was ganz auf Gegenseitigkeit beruhte.
Jeder Beruf hinterläßt Spuren, und auch Kriminalbeamte sind ja nur Menschen. Nach längerer Dienstzeit werden sie, weil ständig mit Verbrechen und Elend konfrontiert, oftmals zu Zynikern. Auch auf Fritz Fichtl traf das zu. Sein beruflicher Ehrgeiz hatte zwar insgesamt stark nachgelassen, aber der Fall »Bisambergbestie« beschäftigte ihn doch sehr. Auch ging ihm der Vorschlag seines jungen Mitarbeiters Brucker nicht aus dem Kopf. Sicher, die Idee war gar nicht so übel. Aber sollte er sich so kurz vor seiner Pensionierung in so etwas Heikles einlassen, womöglich seine Altersversorgung riskieren?
Der nächste Tag war ein Samstag. Fichtl hatte heute nur »Finderdienst«, das heißt, der diensthabende Beamte im Sicherheitsbüro mußte wissen, wo er erreichbar war. Seine Anwesenheit im Büro war somit nicht notwendig, aber zu Hause wollte er auch nicht bleiben. Daher marschierte er also doch auf seine Dienststelle, trank zuvor noch den Frühstückskaffee in der Kantine.
In seinem Büro zündete er sich dann eine Zigarette an und blies den Rauch in Richtung der Akte »Bisambergbestie«. Es war sehr ruhig im Raum, die Fenster geschlossen, der blaue Zigarettendunst hing wie eine kleine Wolke über seinem Schreibtisch.
Er zuckte leicht zusammen, als das Telefon neben ihm schrillte, und ärgerte sich gleich darauf deswegen. »Keine Nerven mehr, Alter«, sagte er zu sich selbst, bevor er abhob.
Es war der Postenkommandant Binder, der ihm kurz angebunden mitteilte, daß er nächste Woche die verstärkten Streifen wieder einstellen mußte. Ein Sparerlaß des Landesgendarmeriekommandos war die Ursache. Diese Nachtstreifen mußten als Überstunden bezahlt werden, und es war kein Geld da. Der Diensthund würde auch abgezogen werden. Ab nächster Woche würde zwischen Stammersdorf und Bisamberg alles wieder sein wie vorher. Da fiel Fichtl Bruckers Vorschlag wieder ein. Die Liste des Justizministeriums über abgeurteilte Sexualverbrecher war bei der Sonderkommission noch nicht eingetroffen. Fichtl rechnete damit bis Montag der folgenden Woche. Ihm graute davor.
Er blickte kurz in den Tagesbericht und auf die Dienstliste. Brucker und die Kriminalbeamtin hatten heute Hauptdienst in der Journaldienstgruppe, sie waren also in den Diensträumen gleich neben dem Eingang. Nur weil er gar nicht wußte, was er tun sollte, ging Fichtl die Treppen hinunter zu ihrem Büro.
Er traf die beiden im Wachzimmer.
»Irgend etwas Besonderes heute, Biggi?« fragte er.
»Nix«, sagte die Kriminalbeamtin. »Nur einen Häftling, ein Exhibitionist. Mit dem bin ich bald fertig.«
»Und wie schaut es bei dir aus?« fragte der Alte den jungen Brakker.
»Ich soll bei der Vernehmung dabeisein«, antwortete der, »damit der Zipfelzeiger nicht frech wird.«
»Gut«, nickte Fichtl. »Macht es kurz und kommt dann zu mir. Ich hab’ was mit euch zu besprechen.«
Schon nach einer halben Stunde kam Brucker in Fichtls Büro. Er war allein, was den Alten wunderte. »Ich denke, du sollst bei der Vernehmung auf Biggi aufpassen?« sagte er.
Brucker blies die Backen auf. »Ich glaube, da bin ich überflüssig, denn ich müßte eher noch auf den Zipfelzeiger aufpassen«, antwortete er und ließ die Tür einen Spalt offen. »Hören Sie sich das an, Chef.«
Tatsächlich hörte man jetzt aus dem Verhörzimmer wildes Geschrei. Es war Biggis wütende Stimme, und man verstand einzelne Sätze wie – »Das werd’ ich Ihnen abgewöhnen, Sie Saukerl« oder »Und vorige Woche vor der Mädchenschule, das waren auch Sie …! Geben Sie es zu, sonst …!«
»Au weh«, sagte Fichtl, »da waren Kinder im Spiel.«
»Wieso wissen Sie das?« fragte Brucker neugierig.
»Du kennst unsere Biggi noch nicht«, belehrte ihn der Alte. »Sie wird immer hysterisch, wenn Kinder das Opfer von Sexualverbrechen sind. Ich nehme an, der Schweinekerl hat vor Schulkindern onaniert.«
»Vor einem Kindergarten«, berichtigte Brucker, »gestern nachmittag. Er wurde abends von der Sicherheitswache verhört und festgenommen. Jetzt sitzt er jammernd in einer Ecke und hat Angst, Biggi würde ihn in der Luft zerreißen.«
Es wurde dann bald ruhiger auf dem Korridor. Nach etwa einer halben Stunde kam Biggi ins Büro, ihre Stimme war ein wenig heiser. »Er ist voll geständig«, sagte sie knapp, »ich lasse ihn zum Gericht überstellen. Ein Wiederholungstäter.«
»Hältst du eine Gegenüberstellung nicht für nötig?« fragte Fichtl. »Der Hofrat wird verlangen, daß du die Kinder befragst und ihnen den Täter gegenüberstellst – eine Wahlkonfrontation.«
»Die Kinder befrag’ ich nachher im Kindergarten. Von Gegenüberstellungen dieser Art halte ich nichts, da kann sich der Hofrat auf den Kopf stellen. Ich sehe nicht ein, daß man die Kleinen noch einmal erschrecken muß.« Biggis heisere Stimme klang sehr bestimmt, und Fichtl wußte, daß es jetzt besser war, das Thema zu wechseln.
»Morgen ist Sonntag«, sagte er. »Ihr seid beide dienstfrei. Habt ihr privat was Besonderes vor …?«
»Woran denken Sie, Chef?« fragte Biggi.
»Ich denke an einen gemeinsamen Ausflug«, grinste der Alte hinterhältig. »Das Wetter ist schön – wie wäre es mit einer gemütlichen Wanderung auf den Bisamberg? Wir könnten dann gemeinsam was essen, oben im Restaurant. Ich lade euch ein.«
Die beiden sahen sich an, nickten einander zu. »Fein«, sagte Biggi, »ein ganz intimer kleiner Betriebsausflug. Einmal was anderes.« Sie verabredeten sich für Sonntag zehn Uhr. Dann eilte Biggi in den Kindergarten.
Mit der besonderen Sensibilität Birgit Herzogs in bezug auf Kinder hatte es eine eigene Bewandtnis.
Sie war in einer kleinen Stadt in Niederösterreich als wohlbehütete einzige Tochter eines Landarztes aufgewachsen. Ihre Mutter führte den Haushalt, wie es sich in bürgerlichen Kreisen gehört. Nach dem Gymnasium und der Matura zog sie nach Wien und immatrikulierte sich an der dortigen Universität im Fach Medizin, weil ihr Vater es so wollte. Finanzielle Probleme gab es keine, für die Kosten einer kleinen Wohnung und eines kleinen Autos kam der Papa auf, und ihr Taschengeld entsprach etwa dem Lohn eines Fabrikarbeiters, der damit allerdings oft eine dreiköpfige Familie unterhalten mußte. Sie war im dritten Semester, als sie sich heftig in Robert Stark verliebte, einen Sportlehrer und Fußballtrainer, vierzig Jahre alt und ein, wie man so schön sagt, Bild von einem Mann. Mit dem Studieren war es jetzt vorbei, denn ihr Robby war mit seiner Mannschaft viel unterwegs, und natürlich konnte sie ihn nicht alleine lassen. Sie wollte ihn heiraten und wünschte sich Kinder, und Robby versprach ihr beides.
Sie war damals 23 Jahre alt, und zwei recht unangenehme Entdekkungen lagen noch vor ihr. Von ihrem Arzt erfuhr sie, daß sie wegen eines Myoms am Uterus nicht schwanger werden könnte, es sei denn, sie ließe sich operieren. Und von einem Fußballspieler erfuhr sie, daß sein Trainer Robert Stark verheiratet und bereits Familienvater war. Diese beiden Tatsachen sollten ihr Leben entscheidend verändern.
Nach einigen wilden Monaten mit viel Alkohol, Männern und spontanen Auslandsreisen – alles, um sich zu betäuben –, kam sie allmählich wieder zur Besinnung, und es störte sie jetzt, daß sie als erwachsene Frau von ihrem Vater immer noch finanziell abhängig war. Sie wollte irgend etwas arbeiten und trat eine Stelle als Serviererin in einem Café an. Und dann hatte sie eines Tages ein für sie besonders eindrucksvolles Erlebnis:
Sie hatte an ihrem Auto einen Strafzettel wegen Falschparkens gefunden und ging in das zuständige Wachzimmer, um ihre Strafe zu bezahlen. Dort standen drei stämmige Polizisten um ein etwa vierjähriges Bübchen, das sich verlaufen hatte und bitterlich weinte. Die Wachleute wollten Namen und Adresse des Kindes in Erfahrung bringen: »Na wie heißt du denn?« fragten sie ständig, aber der Kleine fürchtete sich offensichtlich und zitterte. »Holt doch die Kriminalbeamtin«, sagte der Kommandant, und bevor Biggi noch ihre Strafe bezahlt hatte, kam eine Frau herein. Die Kriminalbeamtin.
»Na, was ist denn mit meinem kleinen Burschi?« sagte sie mütterlich und nahm das Kind in ihre Arme.
Nach drei Minuten schon hatte sich der Kleine beruhigt, sagte artig seinen Namen und wo er wohnte, seine kleinen Ärmchen fest um den Hals der Frau geschlungen.
Von diesem Moment an hatte Birgit Herzog nur einen einzigen Berufswunsch: Sie wollte Kriminalbeamtin werden. Und sie schaffte es auch.
Warm schien die Sonne auf das Wiener Becken, tiefblau war der Himmel. Kein Lüftchen regte sich. Die Bäume des Wienerwaldes auf den Anhöhen um die Stadt leuchteten grün in allen Schattierungen. Es war schwer zu glauben, was die Zeitungen ständig über Waldsterben und kranke Bäume berichteten. Die drei Sonntagswanderer hatten nun die Kuppe des Bisamberges erreicht, sahen hinunter auf das bunte Häusermeer, auf den silber glitzernden Donaustrom.
»Österreich ist doch das schönste Land auf dieser Welt«, schnaufte Fichtl. »Es hat nur den Nachteil, daß so viele Österreicher hier leben.«
Die beiden jungen Leute lachten. Dann ging man hinüber auf die Terrasse des Restaurants. Sie waren hungrig von der Wanderung bergauf.
Von der Endstation Stammersdorf hatten sie den Feldweg zur Ortschaft Bisamberg genommen. Langsamen Schritts hatten sie sich alles angesehen. Im prallen Sonnenlicht war schwer vorstellbar, daß in den letzten Monaten hier sieben Verbrechen passiert waren.
»Wir sollten die Strecke auch einmal bei Nacht ablaufen«, hatte Fichtl gemeint, worauf die beiden anderen einander zuzwinkerten.
Nach dem Essen erklärte der Chefinspektor seinen beiden Mitarbeitern bei einem Glas Wein, was er vorhatte:
Er hatte aus der Akte ersehen, daß sämtliche Überfälle immer nur an Arbeitstagen, nie an einem Samstag oder Sonntag verübt worden waren. Das ließ den Schluß zu, daß der Täter tatsächlich irgendwo in der Stadt arbeitete und dann auf dem Heimweg – womöglich nach einem Wirtshausbesuch – sein Opfer suchte. Fichtl wollte nun die Liste der Bekannten von Maria Weber noch einmal mit dem Postenkommandanten durchgehen und all jene heraussuchen lassen, auf die dies zutraf. »Wir können dadurch den Kreis der Verdächtigen vielleicht entscheidend einengen«, meinte Fichtl. »Wenn wir Glück haben, bleiben nur vier oder fünf übrig, und auf die konzentrieren wir uns dann. Denn man muß, wenn die Gendarmeriestreifen jetzt wieder eingestellt werden, damit rechnen, daß womöglich wieder etwas passiert.« Allein der Gedanke daran konnte dem Chefinspektor die Freude an dem schönen Wetter, der herrlichen Aussicht und dem guten Wein verderben.
Brucker fragte, was er mit »auf diese fünf oder sechs konzentrieren« gemeint hatte.
»Na, es ist doch sinnvoller«, rief der Alte, »mit diesen fünf oder sechs eine Alibiüberprüfung zu veranstalten, als die Liste der Sonderkommission alphabetisch durchzugehen.«
Brucker war anzumerken, daß er davon nicht gerade begeistert war.
Die Sonne schien immer noch, als sie den Berg wieder hinabstiegen.
In Stammersdorf trennten sich ihre Wege. Fichtl wollte im Schwarzen Adler Binder treffen, Brucker und Biggi fuhren in die Stadt zurück.
»Gehen wir noch irgendwohin auf ein Glas Wein?« fragte Peter. Biggi war einverstanden.
In einem gemütlichen Gasthausgarten beschlossen die beiden dann, kommenden Dienstag mit dem »Köderspiel« zu beginnen.
»Vergiß die quietschenden Schuhe nicht«, sagte Peter, und sie nickte. »Du mußt dich halt aufreizend anziehen und beim Gehen ordentlich mit dem Hintern wackeln«, meinte er, und wieder nickte Biggi.
Beim zweiten Glas Wein wurde Peter neugierig.
»Hast du eigentlich irgendeinen eifersüchtigen Freund?« fragte er.
»Das geht dich einen Dreck an«, antwortete Biggi lächelnd.
»Es ist ja nur, weil ich dir vielleicht sonst einen unsittlichen Antrag mache«, meinte Peter.
»Pure Zeitverschwendung«, sagte Biggi. »Merk dir eins: Es gibt zwei Sorten von Männern, mit denen ich nie ins Bett gehe: mit Fußballspielern und mit Berufskollegen. Kennst du dich jetzt aus?«
Ja, jetzt wußte er Bescheid, der Peter Brucker.
Die Liste der zu überprüfenden Vorbestraften übertraf alle Befürchtungen des Chefinspektors. Sie enthielt 417 Namen, und alle waren wegen Sittlichkeitsdelikten rechtskräftig verurteilt worden. Schon bei einer oberflächlichen Durchsicht wußte Fichtl nicht, ob er lachen oder fluchen sollte. Er entschied sich für letzteres. Denn die Beamten im Justizministerium hatten auch alle die Männer in die Liste aufgenommen, die wegen Zuhälterei verurteilt waren. Für diese Herren Bürokraten war Zuhälterei eben ein Vergehen gegen die Sittlichkeit.
Im Fall »Bisambergbestie« war das nun blanker Unsinn, denn Zuhälter fallen höchstens nachts in ihren Puffs, und das viel bequemer, über ihre Mädchen her. Im ersten Moment war Fichtl versucht, zu Hofrat Putner zu stürmen und sich dort auszutoben. Er unterließ es aber. Was hätte er schon erreicht außer einem eisigen: »Die Überprüfung dieser Liste ist eine Anordnung der Sonderkommission. Bitte richten Sie sich danach.«
Er mußte sich also in seinem Büro austoben, fand die gräßlichsten Schimpfworte für die Herren Theoretiker, diese Juristen. Danach war ihm leichter zumute.
Biggi und Brucker hatten ihm unbeeindruckt zugehört. Für die beiden war sein Schimpfvokabular ja nichts Neues.
Die andere Liste aber, nämlich die von Hans Binder, war bei weitem erfreulicher. Ganze vier Männer hatte der Postenkommandant ermittelt, die sowohl zum Bekanntenkreis der Maria Weber gehörten, als auch in der Innenstadt arbeiteten und zumeist abends mit der Straßenbahn nach Stammersdorf fuhren. Interessiert las Fichtl die Namen dieser vier und das, was Binder über sie berichtete:
Nummer eins war Ferdinand Polacek, den Fichtl ja noch vom Schwarzen Adler in Erinnerung hatte. 35 Jahre alt, unverheiratet, keine Freundin oder Lebensgefährtin. Essen und Trinken war sein ganzer Lebensinhalt; Volksschule, Tanzschule und Führerscheinprüfung seine erreichten Ausbildungsziele. Er galt als harmlos, als gutmütig, außer, wenn er einen Rausch hatte. Da wurde er streitsüchtig, aggressiv. Und in den letzten Monaten waren Räusche bei ihm an der Tagesordnung. Möglicher Grund dafür war der Tod seines Vaters, eines Eisenbahnrentners. Den hatte er immer noch respektiert und gefürchtet, seinetwegen hatte er sich immer wieder zusammengerissen. Diese hemmende Barriere war jetzt weg, denn vor seiner alten Mutter hatte der Ferdl weder Angst noch Hemmungen.
Er arbeitete als Tankwart in der Innenstadt. Dort durfte er nicht trinken. Um so eiliger hatte er es dann nach Feierabend. Vom weiblichen Geschlecht, so schrieb der Postenkommandant, wird der Polacek nur belächelt oder verspottet, keine läßt sich mit ihm ein. Kein Wunder, wenn man ihn so ansah. Auch geht das Gerücht, daß der Ferdl impotent sei. Letzteres würde ihn eigentlich als Täter ausschließen, denn in allen Fällen fanden Gerichtsmediziner Samenspuren in den Scheiden der Opfer. Auch bei der toten Maria Weber. Sie wohnte übrigens im Nachbarhaus der Polaceks.
Der zweite auf der Liste des Gendarmerie-Postenkommandanten war ein vierzigjähriger Familienvater, der zur Zeit als Koch in einem Gasthaus in der Innenstadt beschäftigt war. Er hieß Anton Obermoser und hatte früher einmal im Schwarzen Adler gearbeitet. Viermal war er wegen Körperverletzung vorbestraft. Interessiert las Fichtl eine unterstrichene Stelle in Binders Beschreibung, der zu entnehmen war, daß es immer Frauen waren, die der Obermoser verdroschen hatte. Zweimal war es seine eigene Frau, und das Motiv der Rauferei war nicht eruierbar, weil sie sich der Aussage vor Gericht entzogen hatte. Einmal war es eine Kellnerin in der Innenstadt, die sich geweigert hatte, ihm noch Alkohol auszuschenken, und schließlich eine Hilfsköchin, die sehr dagegen war, mit dem Obermoser in der Betriebsküche auch noch andere Dinge zu tun als zu kochen. Natürlich war in allen vier Fällen Alkohol im Spiel, was von den Gerichten wie üblich stets als mildernd gewertet wurde.
Nummer drei war ein Gastarbeiter aus Jugoslawien, der 37jährige Milan Belkovic, schon seit zehn Jahren in einer Baracke in Stammersdorf wohnhaft und als überaus fleißiger Arbeiter bekannt. Tagsüber war er bei einer Straßenbaufirma beschäftigt, abends pfuschte er privat bei Häuslbauern oder sonstwo, gegenwärtig schon seit Monaten bei der Renovierung einer Hausruine in der Innenstadt. Vorstrafen hatte er keine. Im Gegenteil, vor einem halben Jahr war er im Wiener Prater von einem Zuhälter mit einem Schlagring selbst erheblich verletzt worden. Der Postenkommandant berichtete, daß es der Milan in Stammersdorf bei der Befriedigung seiner sexuellen Wünsche eben recht schwer habe. Im Dorf war er »der Tschusch«, und Frauen oder Mädchen hätten sich ja der Verachtung ausgesetzt, wenn sie sich mit ihm eingelassen hätten. Was also blieb ihm anderes übrig, als ab und zu Prostituierte aufzusuchen? Auch hier war er sparsam und bevorzugte die als billig bekannten Praterhuren. Und bei dem Streit mit dem Zuhälter ging es ja auch um Geld, weil Milan eben für angebliche Sonderbehandlungen nicht mehr zahlen wollte, als er gewohnt war.
Der vierte und letzte auf Binders Liste war jener Leopold Kucharsky, den Fichtl ja schon im Schwarzen Adler gesehen hatte. Aushilfskellner und Cousin des Wirtes. Viel konnte der Postenkommandant nicht über ihn berichten, außer, daß er ihm »gefühlsmäßig« jede Gaunerei zutraute und daß er ihn seit langem in Verdacht hatte, Haschisch zu rauchen und damit auch zu handeln. Beweise gab es keine. Im Schwarzen Adler half er immer nur spät abends aus, tagsüber saß er in einer Videothek im dritten Bezirk herum und verlieh Pornofilme. Das war alles.
Es war zwar nicht viel, für den Chefinspektor aber Grund genug, von jedem der vier Männer eine Art Arbeitsakte anzulegen, nur für seinen persönlichen Gebrauch. Er nahm vier Umschläge und schrieb die Namen auf den Pappdeckel, forderte Fotos an, machte zur Sicherheit noch je eine Anfrage in der Datenstation und beim Erkennungsdienst und überlegte, ob und in welcher Form er seine nächsten Pläne Hofrat Putner zur Kenntnis bringen sollte. Lange überlegte er nicht. Wie er fand, war es noch viel zu früh, dem Hofrat etwas zu sagen.
Die vier Verdächtigen hatten eine gemeinsame Eigenschaft. Sie alle waren Stammgäste im Schwarzen Adler. Und sie trafen sich dort zumeist kurz vor Mitternacht, tranken und diskutierten an der Theke. Wenn der Wirt früher schlafen ging, übernahm sein Cousin Leopold das Einschenken und Abkassieren, was ihn aber nicht daran hinderte, an der geselligen Runde teilzunehmen. Der Chefinspektor hatte nun folgende Idee: Einem befreundeten Journalisten wollte er einen Tip geben, und dieser sollte einige Interviews, eine Art Meinungsumfrage, zum Fall »Bisambergbestie« durchführen. Für die Presse war das ja ein aktuelles Thema. Dabei sollte der Zeitungsmann auch in den Schwarzen Adler kommen. Zu einem Zeitpunkt, wo der Alkohol dort schon die Zungen gelockert hatte. Die Hoffnung Fichtls war dabei, daß sich vielleicht einer der vier verplapperte und irgendeine Kleinigkeit erzählte, die nur der Täter wissen konnte. Natürlich würde Fichtl vorher alles mit dem Postenkommandanten absprechen, mit dem die Interviews der Unauffälligkeit halber auch beginnen sollten. Der Journalist hieß Franz Wallisch und arbeitete für eine Wochenzeitung, ein tüchtiger Bursche. Er würde allen eine Menge Fragen stellen, auch wie und wo sie von den einzelnen Überfällen erfahren hatten. Die Antworten sollte er auf Tonband aufnehmen, und die Resultate wollte sich Fichtl dann genau anhören.
Als der Chefinspektor seinen engsten Mitarbeitern von diesem Plan erzählte, zeigten diese wenig Begeisterung. Brucker nickte nur und rieb sich sein noch immer blaues Auge, die Kriminalbeamtin gähnte herzhaft.
»Was ist denn mit euch los?« fragte Fichtl verärgert. »Eure Schläfrigkeit fällt mir jetzt schon seit Tagen auf. Was macht ihr denn eigentlich in der Nacht …? Habt ihr ein Verhältnis miteinander …?«
Die beiden lachten. »Aber Chef«, sagte Biggi, »was für eine unsinnige Verdächtigung.« Ihre Stimme klang müde.
Mit der schläfrigen Müdigkeit der beiden in den Bürostunden hatte es eine besondere Bewandtnis: Sie hatten mit ihrem »Köderspiel« begonnen, wanderten nachts zwischen Stammersdorf und Bisamberg hin und her. Biggi mit quietschenden Schuhen, Peter in Hörweite dahinter. Und vor drei Uhr morgens kamen sie eben nicht ins Bett. Ihr Dienst begann aber schon um halb acht.
Sie wollten sich gegenseitig nicht eingestehen, daß sie sich mit ihrem »Köderspielen« ein wenig zuviel zugemutet hatten. Denn nicht nur die Folgen der kurzen Schlafzeiten hatten sie unterschätzt. Auch die deprimierende Eintönigkeit dieser halben Nächte machte ihnen zu schaffen. Dieses langweilige Warten darauf, daß endlich etwas passieren würde. Es passierte aber nichts. Alles war ruhig, friedlich. So hofften sie auf die nächste Nacht. Erleichterung überfiel sie, wenn ein Wochenende bevorstand. An Samstagen und Sonntagen blieben sie daheim, weil an diesen Tagen noch nie etwas passiert war.
Der Ablauf des Köderspiels war jede Nacht der gleiche:
Peter fuhr mit seinem Auto zur Endstation Stammersdorf, wartete dort auf die letzte Straßenbahn. Biggi stieg in der Innenstadt, am Schottenring, in diesen letzten 31er, grell geschminkt, in einem kurzen Lederrock, dünner Seidenbluse. Ohne Büstenhalter, die Brüste wackelten im Takt des Ratterns der Straßenbahn. Wurde sie angesprochen, gab sie abweisende, schnippische Antworten und sah dann zum Fenster hinaus. Niemand hätte in dieser aufgemotzten Tussie eine Kriminalbeamtin vermutet. Wirklich niemand.
An der Endstation stieg sie aus, ging zielstrebig Richtung Bisamberg. Nicht, bevor sie den wartenden Peter gesehen hatte. Denn er hatte ihr eingeschärft, sofort per Taxi wieder heimzufahren, sollte er einmal nicht da sein. Es konnte ihm ja etwas dazwischengekommen sein, ein Unfall oder so.
Eine Stunde dauerte dann der Hin- und Rückweg. Peter hörte in dieser Zeit nur das Quietschen ihrer Schuhe, und ab und zu das Zirpen der Grillen.
Wieder in Stammersdorf, stiegen sie in Peters Auto, und er fuhr sie nach Hause. Beide einsilbig, in gedrückter Stimmung. Die Frage drängte sich auf, wie lange das noch so weitergehen sollte.
Es geschah am darauffolgenden Dienstag: Biggi hatte ihre Wanderung aufgenommen, Peter folgte in Hörweite. Alles war ruhig. Er hörte nur das Quietschen ihrer Schuhe und das Zirpen der Grillen. Es war Neumond, die Gegend war sehr finster.
Ganz plötzlich hörte das Geräusch ihrer Schuhe auf. Peter blieb stehen, lauschte. Nichts rührte sich.
Er begann zu laufen, zog seine Taschenlampe heraus, blieb wieder stehen, horchte. Kein Geräusch.
Wieder lief er ein paar Schritte. Links von dem Pfad war eine Böschung, es ging etwa drei Meter schräg abwärts in ein Feld.
Er schaltete die Taschenlampe ein, leuchtete herum. »Biggi!« schrie er in plötzlicher Panik. »Biggi, wo bist du?«
Er hörte ein leises Jammern, es kam von links hinter ihm.
»Biggi!« schrie er wieder. »Biggi!« Er rannte zurück, leuchtete die Böschung abwärts.
Dann sah er sie im grellen Lichtkegel. Sie lag im Feld, drehte sich jetzt zur Seite.
»Biggi!«
Mit einem Riesensprung war er bei ihr.
Ihr Gesicht war blutverschmiert. Sie massierte ihren Hals. Deutete dann in eine Richtung. »Renn ihm nach«, flüsterte sie heiser.
»Um Gottes willen, Biggi«, rief er, »ist dir was passiert? Du blutest …« Er schob einen Arm unter ihren Kopf, betrachtete sie ängstlich. Sie begann zu husten, ihr Körper vibrierte. Er streichelte ihr übers Haar. »Sag was, bitte sag was«, flüsterte er.
Sie hustete heiser. Hielt sich ihren Hals. »So renn ihm doch endlich nach«, stöhnte sie dann.
»Ich lass’ dich doch jetzt nicht allein, Biggi. Du blutest, du bist verletzt, du brauchst Hilfe.«
»Das ist nicht mein Blut. Ich hab’ ihn in die Hand gebissen.« Ihre Stimme klang eine Spur fester.
Er dachte nicht daran, jetzt wegzulaufen. Eine Sekunde lang bereute er, dieses Köderspiel organisiert zu haben. Wenn ihr nur nichts passiert ist, dachte er.
Sie richtete sich jetzt mühsam auf, atmete schwer. »War also alles umsonst«, sagte sie traurig.
»Ich bring’ dich zu einem Arzt«, sagte Peter. »Kannst du aufstehen?«
Mühsam rappelte sie sich hoch. »Keinen Arzt«, sagte sie, »es geht schon.«
Auch ihre Bluse war blutverschmiert, sie mußte ordentlich zugebissen haben. Peter hob ihre Handtasche auf; sie hatte sich geöffnet, und der Inhalt lag verstreut am Boden. Stockend schilderte Biggi den Hergang des Überfalls. Er hatte sie von hinten angefallen, sie brutal gewürgt und die Böschung hinab ins Feld gezerrt. Sie konnte nicht schreien, denn er hielt ihr Hals und Mund zu. Sie wehrte sich verzweifelt und biß ihn in die Hand. Das war genau in der Sekunde, als Peter zu schreien begann. Der Täter sprang sofort auf und flüchtete in die Dunkelheit. »Du bist gerade noch im richtigen Moment gekommen«, sagte Biggi.
Im Gras sah Peter etwas glitzern, hob es auf, ein Feuerzeug. »Das gehört nicht mir«, sagte Biggi, »das muß er verloren haben.«
Es war ein billiges Werbefeuerzeug, wie es Geschäftsleute oder Gastwirte an ihre Stammkunden verschenken. »Rosy’s Bar«, las Peter, »Treffpunkt der Gemütlichkeit. Wien I., Sonnenfelsgasse 11.« Er steckte das Ding ein. »Ich krieg’ dieses Schwein, Biggi«, sagte er, und seine Stimme war haßerfüllt. »Ich kriege ihn, das schwör’ ich dir.«
Sie schleppten sich bis zu Peters Auto.
Auf seine ständigen besorgten Fragen antwortete sie immer das gleiche: »Es ist nur der Hals, der weh tut. Er hat mir die Gurgel zugedrückt wie ein Irrer. Nein, ich brauche wirklich keinen Arzt, das wird schon wieder.«
Ein kräftiger Kerl war es gewesen, sein Atem roch stark nach Alkohol. Das war eigentlich alles, was sie zu berichten wußte. Und eine ordentliche Bißwunde müßte er jetzt haben, denn auch ihre Zähne taten leicht weh. Ob es seine rechte Hand war oder die linke konnte sie nicht sagen.
»Wir kriegen ihn, Biggi«, sagte Peter wieder. Langsam beruhigte er sich.
Sie waren schon in der Innenstadt, als Peter fragte, ob sie die Nacht bei ihm bleiben wollte. »Ich lass’ dich jetzt nicht gern allein«, meinte er, »versteh mich richtig.«
Sie verstand. »Besser, du kommst zu mir«, sagte sie. »Du kannst auf der Couch schlafen.«
Er war zum ersten Mal in ihrer Wohnung. Im Vorzimmer schlüpfte er aus den Schuhen, weil alles so sauber war und gediegen eingerichtet. Sie ging gleich ins Bad, hatte das starke Bedürfnis zu duschen. Die Bluse mit den Blutflecken warf sie ihm zu. »Heb das auf, wegen der Blutgruppenbestimmung«, rief sie. Dann rauschte die Dusche eine ganze Weile. In einen Bademantel gehüllt kam sie ins Wohnzimmer zurück. »So, jetzt geht’s mir besser«, sagte sie.
Peter betrachtete noch mal genau ihren Hals: starke Blutergüsse, auch Kratzer und Schwellungen. »Ich krieg’ dieses Schwein«, sagte er wieder wütend.
»Jetzt werde ich ein Schlafmittel nehmen«, sagte sie, »und ein Tee mit viel Rum wird uns beiden guttun, zumindest nicht schaden. Morgen rufe ich im Büro an und melde mich krank. Wegen einer Halsentzündung.« Sie massierte sich wieder. »Das ist ja nicht einmal gelogen«, sagte sie, und, tatsächlich, sie konnte wieder lachen.
Peter Bruckers Gedanken kreisten ständig um drei Punkte: Zum einen mußte der Täter eine Bißwunde an einer Hand haben. Das stand fest. Zum anderen lag da Biggis Bluse mit den Blutflecken in seiner Schreibtischschublade, und eventuell konnte man in der Gerichtsmedizin die Blutgruppe des Täters bestimmen. Aber wie sollte er die Bluse einer Untersuchung zuführen, wenn er keine Erklärung für die Blutflecken liefern konnte? Er hätte ja einen Bericht dazu abgeben müssen, und eine erlogene Geschichte konnte er nicht bringen. Aber die Wahrheit konnte er auch wiederum nicht sagen.
Zum dritten war da dieses Feuerzeug. Er war inzwischen in Rosy’s Bar gewesen. Viel war es nicht, was er dort erfahren hatte. Dabei hatte ihn Rosy, die Wirtin, gar nicht unfreundlich behandelt. Die Stammgäste des Lokals nannten sie allgemein nur »die finstere Rosy«, denn bei ihr war alles finster. Ihr Gesichtsausdruck, ihre Fingernägel, die Bar, und wahrscheinlich auch ihre Unterwäsche. Von der finsteren Rosy hatte er erfahren, daß sie vergangene Weihnachten fünfzig Exemplare dieses Feuerzeugs gekauft und an Stammgäste verschenkt hatte. Natürlich konnte niemand wissen, ob solche Feuerzeuge nicht wieder weiterverschenkt wurden. Daß der Täter also unbedingt Stammgast in Rosy’s Bar sein mußte, war sehr fraglich.
Ausführlich besprach er mit Biggi das Resultat seiner Ermittlungen. Sie machte nun wieder Dienst, wenn auch mit Halstuch. »Weißt du«, sagte Peter zu ihr, »manchmal glaube ich, es wäre das gescheiteste, wenn ich dem Chef alles beichte. Ohne ihn kommen wir jetzt nicht weiter.«
Biggi stimmte zu. »Überlaß die Beichte mir«, sagte sie, »ich kenne ihn schließlich länger.«
Chefinspektor Fichtl war ein wenig verwundert, als beide ihn nach Dienstschluß um eine Aussprache baten. Dann hörte er der Kriminalbeamtin aufmerksam zu. Sie verschwieg nichts, erzählte alle Einzelheiten. Als sie geendet hatte, war gespanntes Schweigen im Raum. Fichtl zündete sich eine Zigarette an. »Das ist ja eine schöne Geschichte«, murmelte er.
Seine Zigarette war schon halb ausgeraucht, als er schließlich meinte: »Das wichtigste ist jetzt, daß das alles unter uns dreien bleibt.« Er sah Biggi in die Augen. »Dann war dein Köderspiel nicht umsonst. Dann kriegen wir dieses Schwein. Von jetzt ab arbeiten wir zu dritt.«
Große Erleichterung bei den beiden, besonders bei Brucker.
»Auf den Schrecken brauche ich jetzt einen Schnaps«, sagte Fichtl.
»Ich auch«, sagten Biggi und Peter wie aus einem Munde.
Die Saufbruderschaft an der Theke im Schwarzen Adler war bei weitem nicht vollzählig. Fichtl saß mit Binder in einer Ecke, und sie beobachteten kartenspielend die Herrenrunde. Es war keiner dabei, der eine Verletzung an einer Hand hatte oder einen Verband trug. Aber es fehlten ja auch noch die nach Ansicht des Chefinspektors »großen Vier«, die eigentlich Verdächtigen. Die Männer an der Bar unterhielten sich lautstark über Politik. Ein dicker älterer Mann, der seinen Hut nie abnahm, erklärte seinen Freunden weise, warum Deutschland den Zweiten Weltkrieg verloren hatte. Und welche Fehler Adolf Hitler gemacht hatte.
»Entweder mit Weihrauch oder mit Knoblauch hätte er sich verbünden müssen«, dozierte er immer wieder. Mit Weihrauch war die Kirche, mit Knoblauch waren die Juden gemeint. Und weil er weder mit Weihrauch noch mit Knoblauch zusammengearbeitet hatte, der Adolf, hatte er unterliegen müssen. Die meisten der Anwesenden stimmten zu, auch der Wirt. »Er war halt ein sturer Hund, der Adi«, sagte er. Schnell wurde das Thema gewechselt, man diskutierte nun über Hunde. Jeder kannte irgendein ganz gescheites Hundevieh, klüger manchmal als ihre Herren. Die Hundegeschichten wollten kein Ende nehmen, und mit jedem Bier wurden die Hunde intelligenter und auch gefährlicher.
Fichtl und Binder hatten sich schon das vierte Bummerl ausgespielt, sie waren am Bauernschnapsen. Fichtl sagte gerade einen Vierziger an und drehte zu, als er einen der Hundeliebhaber sagen hörte: »Den Polacek Ferdl, den hat unlängst einer gebissen.« In der Runde ging diese Bemerkung unter, doch Fichtl war wie elektrisiert.
»Hast du das gehört?« fragte er gespannt.
Binder nickte. »Hoffentlich in die Hand«, sinnierte er. »Soll ich mir den Ferdl vorknöpfen?«
Fichtl überlegte.
»Wart noch damit«, sagte er. »Ich hab’ da so eine Idee.«
Der Postenkommandant legte die Karten weg, die beiden hörten auf zu spielen. »Schon wieder eine Idee?« grinste Binder. Fichtl wußte, worauf sein Partner anspielte: auf die eher mißglückte Sache mit dem Journalisten und den Interviews.
An dem Journalisten Wallisch lag es nicht, der hatte seine Sache ganz ausgezeichnet gemacht. Auch bei seiner Meinungsumfrage im Schwarzen Adler. Fichtl hatte sich die Tonbänder mehrmals angehört, er war enttäuscht. Seine Hoffnung, daß sich irgendeiner seiner Hauptverdächtigen verplappern könnte, hatte sich nicht erfüllt. Im Gegenteil. Alle hatten dem Pressemann ihre Entrüstung über die »Bisambergbestie« ins Mikrofon geschrien, die Einführung der Todesstrafe verlangt, die Polizei wegen ihrer Unfähigkeit kritisiert, nichts Neues also. Wallisch hatte darauf natürlich einen Stimmungsbericht in seiner Zeitung veröffentlicht, der auch Stellungnahmen der Beamten von der Sonderkommission enthielt. Einziges Resultat der ganzen Aktion war eine weitere Verschlechterung des Arbeitsklimas, und Hofrat Putner war wütend. Er wäre noch wütender gewesen, hätte er gewußt, daß sein Chefinspektor der Initiator der Pressekampagne war.
»Ich weiß schon«, lächelte Fichtl jetzt, »meine Idee mit den Interviews ging ordentlich daneben. Aber wie wäre es jetzt mit der Tollwut?«
»Tollwut?« fragte Binder mit einem Seitenblick auf Fichtls Weinglas. »Bist du schon besoffen?«
Der Chefinspektor winkte ab. Dann erklärte er: »Wenn Binder in seiner Gemeinde das Gerücht ausstreute, daß es in der Gegend tollwutverdächtige streunende Hunde gäbe und daher Schutzimpfungen angebracht wären, dann könnte man ja abwarten, ob der Polacek einen Arzt aufsuchen würde. Allein der gebissene Täter weiß ja, daß es kein Hund, sondern eine Frau war. Ginge er also nicht zu einem Arzt, wäre dies ein weiteres Indiz für seine Schuld.«
»Na, du hast Ideen«, sagte Binder, wußte aber nicht recht, was er davon halten sollte. Allein, alle Überlegungen erwiesen sich in der nächsten Minute schon als gegenstandslos. Denn der Polacek kam herein, gesellte sich zu seinen Freunden. Seine Hände waren unverletzt, aber er hinkte leicht. Und den nächsten Gesprächen der Männer an der Theke war zu entnehmen, daß der Polacek in eine Wade gebissen worden war.
Man war also wieder um eine Hoffnung ärmer.
»Wie wäre es mit einer neuen Idee?« grinste Binder anzüglich, und Fichtl fluchte leise in sein Weinglas. Die Aufregungen der beiden sollten an diesem ereignisreichen Abend aber noch nicht zu Ende sein. Denn fünf Minuten später kam Leopold Kucharsky in die Gaststube, der Aushilfskellner und Cousin des Wirts. Er trug einen Verband an der linken Hand.
Er grüßte und ging zuerst wie gewöhnlich in die Küche, um sich umzuziehen. Die beiden Alten sahen sich bedeutungsvoll an. Als der Wirt nachschenkte, fragte der Postenkommandant beiläufig: »Hat er sich weh getan, der Poldl?«
»Ja«, meinte der Wirt. »Beim Geschirrabwaschen hat er sich geschnitten. Schon vorige Woche.«
Es wurde Mitternacht, der Wirt ging schlafen, und der Leopold übernahm das Geschäft. »Bitte jetzt keine Idee«, sagte der Postenkommandant leise. Er meinte es ernst.
»Was schlägst du vor?« fragte Fichtl.
»Na das Einfachste, das Naheliegendste. Ich schnapp’ mir den Kucharsky, bring’ ihn zum Amtsarzt und lass’ die Wunde untersuchen. Wenn er feststellt, daß es kein Schnitt, sondern eine Bißwunde ist, dann haben wir ihn.«
Fichtl dachte nach.
»Und wenn der Doktor es nicht mit absoluter Sicherheit feststellen kann? So was gibt’s ja auch. Dann haben wir unseren besten Trumpf umsonst ausgespielt. Der Leopold bleibt bei seiner Behauptung, und die Sache ist vermurkst.«
Johann Binder seufzte. Mit dem Chefinspektor Fichtl zusammenzuarbeiten, meinte er, wäre wirklich nicht einfach. Ähnliches hatte sich Fichtl ja auch schon öfter im Sicherheitsbüro anhören müssen, insbesondere in den letzten Jahren. Die beiden Alten vereinbarten darauf, vorerst doch den Bericht des Gerichtsmedizinischen Instituts, das heißt den Blutbefund von Biggis Bluse abzuwarten. Spätestens übermorgen war damit zu rechnen. Denn was für den jungen Kriminalbeamten Brucker unmöglich gewesen war – ohne entsprechenden Bericht die Untersuchung der Bluse zu veranlassen –, stellte für den Chefinspektor kein Problem dar.
Die beiden hatten ausgetrunken und wollten bezahlen. Leopold Kucharsky kam an den Tisch, um zu kassieren.
Plötzlich bückte sich Fichtl unter den Tisch, hob etwas auf. Ein Feuerzeug. »Das muß jemand verloren haben«, meinte er und hielt es dem Leopold hin. »Ah, das ist meins«, sagte der und steckte es ein. »Hab’ mich schon gewundert, wo ich’s gelassen hab’.«
Draußen auf der Straße blieb der Postenkommandant stehen. »Also, ich versteh’ dich wirklich nicht«, sagte er ernst. »Auf was wartest du denn noch? Ist dir das immer noch nicht genug?«
»Nein«, sagte Fichtl. »Aber jetzt wird die Geschichte langsam warm. Ich rufe dich morgen an.«
Sie verabschiedeten sich. Fichtl klopfte seinem Freund auf die Schulter. Als er im Taxi saß und heimwärts fuhr, lachte er leise in sich hinein. Denn er hatte schon wieder eine Idee und wußte, daß es diesmal klappen würde.
Ungewöhnliche Dinge ereigneten sich jetzt im Leben des Leopold Kucharsky. Dinge, die er sich nicht erklären konnte, die ihn aber beunruhigten.
Da war einmal die seltsame Fragerei der »finsteren Rosy«, als er eines Abends wie üblich in ihrer Bar an der Theke saß. Ob er irgendwelche Schwierigkeiten mit der Polizei habe, wollte die Rosy mitfühlend wissen. Auf seine erstaunten Gegenfragen rückte die Rosy schließlich zögernd mit der Wahrheit heraus: Ein Kriminalbeamter wäre bei ihr gewesen. Ein Foto von ihm hätte er ihr gezeigt und gefragt, ob sie ihn kenne, ob er öfter ins Lokal käme.
»Ein Foto von mir?« hatte Leopold erstaunt gefragt, worauf die finstere Rosy nur nickte. Er erinnerte sich, daß die Polizei ihn einmal fotografiert hatte, als er wegen Hasch-Rauchens aufgeflogen war. Erkennungsdienstliche Behandlung hatten das die Kriminalbeamten genannt, und auch Fingerabdrücke hatten sie ihm abgenommen. »Reine Routineangelegenheit.« Leopold Kucharsky war es ein Rätsel, warum die Kiberer jetzt wissen wollten, ob er hier verkehre. Er fand keine Erklärung dafür.
Einen Tag später fragte ihn seine Mutter ängstlich, ob er denn wieder einmal irgendwo negativ aufgefallen wäre. Sein Gewissen war rein, und so versuchte er seine Mutter zu beruhigen, wollte den Grund für ihre Frage wissen. Sie erzählte, daß sie den Gendarmerie-Postenkommandanten beim Einkaufen getroffen habe. Und der habe sich so seltsam nach ihrem Sohn Leopold erkundigt, gefragt, wie es ihm gehe und was er so treibe. Mit dem Instinkt einer Mutter habe sie gemerkt, daß die Freundlichkeit des Johann Binder, seine plötzliche Anteilnahme, nur gespielt war. »Der ist ein falscher Zehner«, hatte die Mutter gesagt. »Wenn er so freundlich ist, ist er am gefährlichsten.« Und dann wiederholte sie bekümmert, was er die letzten Jahre schon über hundertmal gehört hatte: »Du solltest dir eine Frau suchen, ich lebe schließlich nicht ewig. Du brauchst eine Frau, die dann für dich sorgt.«
Um dies alles richtig verstehen zu können, mußte man das sonderbare Mutter-Sohn-Verhältnis der beiden kennen:
Der kleine Polderl war gerade zehn Jahre alt gewesen, als er eines Tages von der Schule heimkam und sich wunderte, weil es im Hause so erbärmlich nach Gas stank. Er fand seine Mutter in der Küche am Boden liegend mit einem Gasschlauch vom Backrohr in der Hand, bewußtlos. Der geschockte Junge riß die Fenster auf, rief Nachbarn zu Hilfe. Der Notarztwagen brachte seine Mutter ins Spital. Aus dem aufgeregten Getratsche der Nachbarsleute erfuhr er Schreckliches. Seine Mutter hatte Selbstmord verüben wollen, weil der Vater die Familie verlassen hatte. Der Bruder seiner Mutter, der Wirt vom Schwarzen Adler, holte ihn von daheim ab und schimpfte schrecklich über seinen Vater. Einen Verbrecher nannte er ihn. Und über diese Hure schimpfte er, über seine Kellnerin, die mit dem Vater davongelaufen war. Die wäre überhaupt an allem schuld.
Am nächsten Tag schickte ihn der Onkel wieder zur Schule, wo er sich von seinen Mitschülern anhören mußte, daß seine Mutter ein blödes Weib wäre, weil man sich eben nicht umbringt, wenn man ein Kind und damit Verantwortung hat. Die Kinder redeten das nach, was sie von ihren Eltern gehört hatten. Darauf entstand eine wilde Schlägerei unter den Buben, weil der Polderl nicht zulassen wollte, daß man seine Mutter ein blödes Weib nannte. Da die anderen in der Überzahl waren, wurde der Junge ordentlich verdroschen.
Nach drei Tagen war seine Mutter wieder aus dem Krankenhaus zurück. Sie sprach mit niemandem über ihr Problem, auch nicht mit ihrem Buben. »Das verstehst du noch nicht«, sagte sie nur. »Später, wenn du größer bist, erzähl’ ich’s dir.«
Ein- oder zweimal im Monat kam es jetzt vor, daß sie sich betrank. Und dann schrie sie manchmal wie eine Irre, und der Junge mußte sich anhören, daß er an der ganzen Misere schuld wäre, weil er sie damals nicht ruhig hatte sterben lassen.
An seinem 14. Geburtstag schenkte ihm die Mutter ein Fahrrad und erzählte ihm außerdem, daß sein Vater nach Australien ausgewandert wäre. Schuld an allem wäre nur diese Kellnerin, diese Hure. Er solle sich vor schlechten Frauenzimmern in acht nehmen, wenn er einmal erwachsen sei. Damals fing er an, im Schwimmbad durch Astlöcher in den hölzernen Umkleidekabinen Mädchen und Frauen beim Ausziehen zu beobachten, heimlich bei Freunden Nacktfotos zu tauschen und Porno-Heftchen zu sammeln. Und zu onanieren. Gleichaltrigen Mädchen rief er manchmal ordinäre Schimpfworte nach, oder er bewarf sie mit Steinen.
Mit 15 kam er in eine Lehre, zu einem Elektriker. Mit 18 legte er die Gesellenprüfung ab. Die gleichaltrigen Burschen hatten jetzt schon Freundinnen, mit denen sie halbe Nächte lang auf Parkbänken saßen. Leopold Kucharsky konnte oder wollte keine finden, weil er jedes Mädchen nach dem zweiten Glas Bier oder Wein gleich beschimpfte und eine Hure nannte. Die einzige Frau, mit der er eigentlich reden konnte, war seine Mutter.
Sie hatte aufgehört zu trinken und sorgte sich jetzt rührend um ihren Sohn.
Erst im Lauf der nächsten Jahre begann sie sich wegen der abartigen Veranlagung ihres Leopold dem weiblichen Geschlecht gegenüber Sorgen zu machen. Sie empfahl ihm dieses oder jenes Mädchen aus der Nachbarschaft, aber er winkte nur ab. »Die brauch’ ich nicht«, pflegte er zu sagen, »ich hab’ ja dich, Mutti.«
Die Warnung seiner Mutter vor dem Postenkommandanten nahm er nicht sonderlich tragisch. Was wußte schon so ein Landgendarm von seinem Leben, seinen Problemen. Trotzdem ließ ihm die Sache irgendwie keine Ruhe. Und siehe da, es kam noch schlimmer.
In der Videothek im dritten Bezirk, wo er angestellt war, erschien eines Vormittags ein jüngerer Mann, erkundigte sich nach diesem und jenem, kaufte aber nichts. Er ließ sich eine Videokassette vorspielen und ging dann wieder.
Der Kerl war ihm merkwürdig bekannt vorgekommen, er konnte ihn aber vorerst nirgends einordnen. Erst als er am nächsten Tag wiederkam und im Geschäft gelangweilt herumsuchte, wurde es dem Leopold zur Gewißheit: Er hatte ihn einmal in Gesellschaft des Postenkommandanten und eines älteren, ihm unbekannten Mannes im Schwarzen Adler gesehen. Und die drei, so hatte sein Onkel in der Küche behauptet, waren Kriminalbeamte aus der Stadt.
Konnte das ein Zufall sein? Und wenn nicht, was wollte der junge Kriminalbeamte in seiner Videothek? Wieder war er gegangen, ohne etwas zu kaufen, und so beschloß Leopold Kucharsky, ihn direkt zu fragen, sollte er noch einmal kommen.
Tatsächlich erschien der junge Inspektor drei Tage später wieder. Diesmal hatte er eine Videokassette bei sich und fragte, ob man sie ihm vorspielen könnte, weil er zu Hause keinen Recorder besitze. Mißtrauisch schob Leopold die Kassette in ein Gerät und schaltete ein.
Was dann geschah, wurde für Leopold Kucharsky zum Schock seines Lebens.
Der Bildschirm blieb schwarz. Nur der Ton funktionierte; man hörte undeutlich Schritte, das war alles. Leopold wollte gerade seiner Kundschaft erklären, daß mit der Kassette etwas nicht in Ordnung sei, als aus dem Gerät eine Männerstimme ertönte, laut und unheimlich anzuhören.
»Biggi!« schrie die Stimme. »Biggi, wo bist du … Biggi!!«
Leopold Kucharsky war starr vor Schreck, sein Gesicht kreideweiß.
Und wieder diese Stimme: »Biggi …! Biggi, wo bist du …?!«
In seinem Kopf dröhnte es. Inspektor Brucker schaltete den Apparat ab. Das Knacken des Schalters traf wie ein Schuß ins Bewußtsein des Leopold Kucharsky. Wie aus weiter Feme hörte er jetzt denselben Mann mit ruhiger Stimme sagen: »Sie sind verhaftet. Gegen Sie liegt Mordverdacht vor.«
Die Tür ging auf. Der Chefinspektor kam herein. Brucker nickte ihm zu. Sie zogen Kucharsky vom Sessel. Die Handschellen klickten. Sie nahmen ihn in die Mitte. Beim Verlassen der Videothek mußten sie ihn stützen. Im Auto auf der Fahrt ins Sicherheitsbüro begann Leopold Kucharsky zu weinen.
Als er im Büro auf einem Sessel saß, weinte er immer noch. Die Handschellen wurden ihm abgenommen.
»Tut es dir jetzt leid?« fragte der Chefinspektor. Merkwürdig, das klang beinahe mitfühlend.
»Ja«, hauchte Leopold.
Eine Frau kam ins Zimmer, stellte sich vor ihn. Sie sagte kein Wort. Wieder durchfuhr ihn ein gewaltiger Schreck. Es war diejenige, die ihn in die Hand gebissen hatte, die von der Straßenbahn.
»War das die letzte?« fragte der Chefinspektor.
»Ja«, antwortete Kucharsky. Alles drehte sich jetzt vor ihm. Die Frau verließ das Zimmer. Er mußte sich an der Sessellehne festhalten.
Ein Polizeiarzt kam herein, untersuchte seine fast vernarbte Bißwunde, zapfte ihm aus einem Ohrläppchen einige Blutstropfen ab. Dann mußte er aufstehen. Der junge Inspektor untersuchte seine Kleidertaschen und legte alles, was er fand, auf einen Schreibtisch. Das Feuerzeug aus Rosy’s Bar war darunter.
»Wir beginnen jetzt ganz von vorne«, sagte der Chefinspektor. Und wiederum klang seine Stimme beinahe väterlich.
In den nächsten 48 Stunden gestand Leopold Kucharsky elf Überfälle auf Frauen in der Gegend um Stammersdorf-Bisamberg. Zehn Notzuchtfälle und den Mord an Maria Weber. Die Kriminalbeamtin hatte recht gehabt: Die Weber Mitzi hatte den Täter erkannt. »Poldl«, hatte sie geschrien, »na wart, das sag’ ich bei der Gendarmerie.« Er war in Panik geraten und hatte nach einem Stein gegriffen, der in der Nähe lag.
Die Kriminalbeamtin hatte auch recht mit ihrer Annahme, daß nicht alle Verbrechensopfer Anzeige erstattet hatten. Kucharsky gestand Überfälle, die gar nicht aktenkundig waren. Und in all seinen Geständnissen gab er Einzelheiten bekannt, die nur der Täter wissen konnte. Die Beweislage war eindeutig.
Hochstimmung herrschte im Sicherheitsbüro, geradezu euphorisch reagierte die Sonderkommission. Hofrat Putner war allerdings leicht schockiert, als ihm der Chefinspektor die Klärung des Falles meldete und ihm schilderte, auf welche Art diese zustande gekommen war.
»An die Strafprozeßordnung habt ihr euch nicht gerade gehalten«, nörgelte er. »Hoffentlich gibt es bei der Gerichtsverhandlung keine Schwierigkeiten.«
Der Hofrat wäre noch wesentlich schockierter gewesen, hätte er wirklich alle Einzelheiten gewußt. Aber der Alte hütete sich, ins Detail zu gehen. Vor allem verschwieg er seine tagelange Zermürbungstaktik vor und auch nach der Verhaftung. Er kannte ja seinen Hofrat, der hätte vor lauter juristischen Bedenken nicht schlafen können und von »seelischer Grausamkeit« gesprochen. So aber rannte Hofrat Putner von einer Pressekonferenz zur anderen.
In der Öffentlichkeit war die »Verhaftung der Bestie vom Bisamberg« natürlich eine Sensation, und die Zeitungen waren voll des Lobes für die tüchtige Polizei und die ministerielle Sonderkommission. Chefinspektor Fichtl grinste in sich hinein, und in der Kantine sagte er zu Freunden, was ihm in solchen Fällen immer einfiel: »Der Erfolg hat viele Väter, nur der Mißerfolg ist ein Waisenkind.«
Natürlich wollten die Presseleute möglichst viele Einzelheiten wissen, und Hofrat Putner als Pressesprecher der Behörde verschanzte sich hinter dem Wortlaut der amtlichen Aussagen. Der Fall hatte nach seinen Worten durch »unermüdliche Ausdauer, besonderen Fleiß und kluge Kombinationsgabe der Kriminalpolizei« geklärt werden können, und so stand es denn auch in den Zeitungen. Der alte Chefinspektor brüllte vor Lachen, als er das las, und ging wohlgemut in die Kantine.
Leopold Kucharsky war dem Gericht überstellt worden. Der gerichtsmedizinische Befund über Blutgruppe und Bißwunde war positiv und wurde zusammen mit der Anzeige dem Untersuchungsrichter übersandt.
»Dann wäre der Fall also für uns abgeschlossen«, meinte Peter Brucker erfreut.
Er mußte sich vom Chefinspektor jedoch sogleich belehren lassen. »Merk dir das eine, junger Freund«, sagte Fichtl ernst. »Jeder Kriminalfall ist für uns erst dann abgeschlossen, wenn das Gerichtsurteil gefällt und rechtskräftig ist.«
Peter hielt das für übertriebene Genauigkeit. Erst nach Wochen mußte er wieder daran denken und wunderte sich, wie recht sein Chef doch manchmal hatte. Auch Birgit Herzog mußte sich oft fachliche Belehrungen des Alten anhören. Bei den Vernehmungen des Kucharsky hatte sie nicht teilgenommen, denn das wollte der Chefinspektor nicht. Er und Brucker waren die einzigen, die den Häftling verhörten und die Niederschriften unterschrieben. Natürlich erfuhr Biggi aber, in welcher Atmosphäre die Verhöre geführt worden waren. Auch las sie ja die Protokolle, mit deren Formulierung sie überhaupt nicht einverstanden war.
»Ihr seid viel zu freundlich zu dem Saukerl«, sagte sie empört. »Nur weil er ständig in Tränen aufgelöst ist, aus Selbstmitleid! Dieses perverse Muttersöhnchen! Denkt doch an die Weber Marie! Tut er euch etwa leid?! Dem gehört doch ein Tritt in den Hintern verpaßt!«
»Ganz recht hast du, Biggi«, lächelte der Chefinspektor.
»Und warum, Chef, warum behandelst du ihn dann wie ein Vater seinen vertrottelten Sohn?!« Biggis Stimme überschlug sich. Ihre Emotionen waren schließlich verständlich.
»Weil ich will, daß er den Frack kriegt«, sagte Fichtl ernst. »Frack« in diesem Zusammenhang kommt eigentlich aus der Gaunersprache und ist eine polizeiinterne Bezeichnung für die Höchststrafe, also für lebenslänglich.
Jetzt verstand die Kriminalbeamtin überhaupt nichts mehr, und der Alte erklärte: »Schau, Biggi, es ist uns gelungen, ihn psychisch fertigzumachen. Aber du weißt doch, wie das bei Gericht ist. Wir müssen ihm ja jede Einzelheit nachweisen. Wenn ich den wilden Mann spiele, und er wird dadurch verstockt und redet nichts mehr, fällt die halbe Anklage ins Wasser. Glaub mir, Biggi, mir ist es sehr schwer gefallen, freundlich zu sein und Mitgefühl zu markieren. Aber wenn es hätte sein müssen, hätte ich sogar mit ihm geheult! Nur damit er weiter auspackt und wir die nötigen Beweise kriegen.« Der Chefinspektor war jetzt ernst. »Auch das gehört zu unserem Beruf«, sagte er abschließend.
Die Kriminalbeamtin wurde sehr nachdenklich.
»Vielleicht hast du recht, Chef«, meinte sie. »Ich hoffe, er kriegt den Frack.«
Ins Sicherheitsbüro war also wieder der Alltag eingekehrt. Der graue Alltag, die tägliche Routine. Zumindest war dies die Ansicht von Hofrat Putner. Für den Chefinspektor und den anderen älteren Kriminalbeamten war immer »Alltag«, auch ohn »Bisambergbestie.« Diesen Alten war es völlig gleichgültig, ob sie an einem spektakulären Gewaltverbrechen oder an Ladendiebstählen arbeiten mußten. Arbeit bleibt Arbeit, und »außergewöhnlich« bedeutete für diese abgebrühten Männer höchstens die Erhöhung einer Dienstzulage oder wenn es freitags einmal in der Kantine keine »Gummiadler« gegeben hätte. Gummiadler war die hausinterne Bezeichnung für gebratene Hähnchen. Niemand glaubte aber ernsthaft an das Eintreten solch außergewöhnlicher Ereignisse. Weder hinsichtlich erhöhter Dienstzulagen noch bezüglich der freitäglichen Gummiadler. Der Alltag im praktischen Kriminaldienst bleibt eben grau.
Chefinspektor Fichtl und sein Team hatten sich jetzt mit einer Serie von ungeklärten Juwelenraubfällen herumzuärgern. Vor zwei Wochen hatte bereits der fünfte Überfall stattgefunden, immer nach demselben »Modus operandi«.
In Uhren- oder Juweliergeschäften in den Stadtrandbezirken tauchte kurz vor Ladenschluß plötzlich ein Mann auf, mit über das Gesicht gezogener Kapuze, und bedrohte den Juwelier mit einer Pistole. Er nahm nur wenig Geld mit, aber dafür viel Preziosen. Es gab keine Spuren, keine Hinweise, mit Ausnahme der Vermutung, daß es sich immer um ein und denselben Täter handeln dürfte. Aber darauf wäre wohl auch ein Probegendarm gekommen. Auch war die Täterbeschreibung immer gleich: männlich, mittelgroß, schlank, dunkle Hose, dunkle Jacke, dunkle Maske.
Bei der Übernahme des Falles war Fichtl recht zuversichtlich, weil er ziemlich sicher war, daß der Täter die geraubten Schmuckstücke irgendwo verscheuern würde. Fichtl hatte gute Beziehungen zu Hehlern und Zuhältern und war mit Brucker nächtelang bei diesen Typen unterwegs. Langsam wurde es aber fad. Kein einziges Schmuckstück tauchte auf, Fichtl stieß wieder seine ordinärsten Flüche aus.
Es war ein Freitag in der Mittagspause. Brucker und Biggi saßen im Büro und nicht wie üblich in der Kantine, eben wegen der Gummiadler. Das Telefon klingelte. Biggi hob ab. »Für dich«, sagte sie dann. Peter nahm den Hörer.
Am Apparat war die schöne Erika, von der er seit dem berühmten Abend nichts mehr gehört hatte. Seit damals, als er ihr den Vorschlag gemacht hatte, für die »Bisambergbestie« den Lockvogel zu spielen.
Sie war sehr freundlich, die schöne Erika, sagte, sie müsse ihn unbedingt sprechen. In einer sehr wichtigen Sache, sagte sie. Sie verabredeten sich für 20 Uhr im Café Korb in der Wiener Innenstadt.
»Eine neue Freundin?« fragte Biggi neugierig, als er aufgelegt hatte.
»Nein, meine Verflossene«, antwortete Peter wahrheitsgetreu. Und er erzählte ihr, weshalb ihre Beziehung auseinandergegangen war. Er hatte sie damals als Köder für die »Bisambergbestie« gewinnen wollen.
»Was redest du …?« unterbrach ihn Biggi. »Das hast du mir doch damals erzählt.«
»Bin ehrlich neugierig, was sie jetzt von mir will«, wunderte sich Peter.
Das »Körberl«, wie dieses Kaffeehaus von den Wienern liebevoll genannt wird, war schwach besetzt, als Peter ein wenig verspätet hereinkam. Erika saß in einer Ecke bei einem Campari-Soda und lächeltc ihm freundlich entgegen. »Dieses Weib wird immer hübscher«, dachte er, als er sie wiedersah.
Ein wenig gehemmt machten sie höfliche Konversation. Erika hatte in den Zeitungen von der Verhaftung der »Bisambergbestie« gelesen, auch Peters Namen in lobend erwähntem Zusammenhang bemerkt. »Bist ja jetzt ein berühmter Kiberer geworden«, sagte sie schmeichelnd.
»Es hält sich in Grenzen«, antwortete er.
In dieser Tonart ging es weiter bis zum dritten Campari, dann verlor er die Geduld. »Also, was ist, Herzchen?« fragte er. »Was willst du von mir, was kann ich für dich tun?«
»Ich habe einen neuen Freund«, sagte sie ernst. Ob er sich das vorstellen könne?
Er konnte sich das gut vorstellen.
Sie kramte in ihrer Handtasche, legte ihm schließlich einen ganzen Pack Urlaubsfotos vor. Auf Rhodos, auf Zypern und in Tunesien waren sie zusammen gewesen. »Das ist er«, sagte sie immer wieder und sah Peter dabei erwartungsvoll an.
»Aha«, meinte er nur, ziemlich desinteressiert.
»Kennst du ihn?« fragte sie unerwartet.
»Wieso soll ich ihn kennen?« antwortete er verständnislos.
»Ich meine beruflich«, sagte sie wieder.
Jetzt fiel bei ihm der Groschen, und er lachte herzlich. »Du Dummchen«, grinste er, »Strolche gibt es mehr als Bürgermeister. Ich kann doch nicht jeden in der Stadt kennen. Hat er was ausgefressen?«
Das glaube sie zwar nicht, meinte sie zögernd, aber er mache halt immer so ein Geheimnis um seine Person, aus seinem Beruf und woher er das viele Geld habe. Und da habe sie sich eben gedacht …
Er unterdrückte seine Heiterkeit und zwang sich zu einer ernsten Miene, was ihm ganz gut gelang. »Du hast dir gedacht«, sagte er streng, »ich könnte im Büro einmal nachsehen, ob etwas gegen ihn vorliegt.«
»Ja«, sagte sie schüchtern. Sie gab ihm einen Zettel. »Anton Fellinger«, las er und darunter die Geburtsdaten.
»Das hab’ ich aus seinem Paß abgeschrieben«, sagte Erika.
Mit gespielter Entrüstung setzte er sich gerade hin. »Aber das ist ganz streng verboten«, sagte er. »Das wäre ja ein glatter Amtsmißbrauch. Und ein Verstoß gegen das Datenschutzgesetz. Was du da gemacht hast, erfüllt eindeutig den Tatbestand des Versuchs zur Verleitung zum Mißbrauch der Amtsgewalt. Es tut mir leid, aber ich muß darüber Anzeige erstatten.«
Sie sah ihn zweifelnd an. Als sie aber das Zittern um seine Mundwinkel bemerkte, als er dann vor Lachen losprustete, war sie ehrlich erleichtert. »Du Schalk«, sagte sie zärtlich, »eine Sekunde lang hab’ ich geglaubt, du meinst das ernst.«