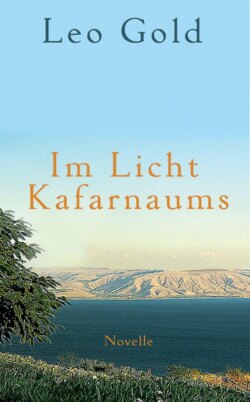Читать книгу Im Licht Kafarnaums - Leo Gold - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Auf dem Weg
ОглавлениеHotelfrühstück – Begrüßung durch den Reiseführer – Altstadtbesichtigung in Jaffa – Caesarea – Mittagessen in Akko – Abendstimmung in Haifa – Kibbuz am See Genezareth
Stefan und Max wachten so früh auf, dass sie vor Beginn des Frühstücks erneut zum Strand von Tel Aviv spazierten. Da sie die letzte Nacht ihrer Rundreise in Jerusalem verbringen und von dort direkt zum Flughafen gefahren werden würden, war es für sie die letzte Möglichkeit, unabhängig von der Reisegruppe in Tel Aviv unterwegs zu sein. Die ersten Sonnenstrahlen erhellten den Horizont.
Gegen 7 Uhr betraten die beiden den Speisesaal, in dem sich einige der bekannten Gesichter vom Vortag in einer Schlange vor dem Kaffeeautomaten drängten. Normalerweise standen zwei Kaffeeautomaten zur Verfügung. Da einer davon defekt war und der andere wegen Überlastung auch nur noch in verminderter Geschwindigkeit die vier verschiedenen Kaffeevariationen brühte, wurde die Reihe vor ihm länger und länger. Max und Stefan entschieden sich, sich antizyklisch zu verhalten. Sie gingen zu dem Tisch, auf dem unterschiedliche Müslisorten, Kuh-, Hafer- und Sojamilch, Joghurt, Kefir, getrocknete Früchte und Nüsse standen. Schnell noch einen Esslöffel genommen und beide näherten sich einem der runden Gruppentische, an dem ein Ehepaar Platz genommen hatte, das aus Münster stammte.
Andreas und Inge, wie sich die beiden mit Vornamen vorstellten, erzählten offen von sich und hielten auch nicht hinterm Berg damit, welche ersten gesundheitlichen Befindlichkeiten das ungewohnte Klima und Essen bei ihnen bewirkten. Stefan freute sich, dass Max zwischen ihm und Andreas saß. So brauchte er sich nicht aktiv am Gespräch zu beteiligen und konnte Personen beobachten, die er zunächst interessanter fand.
Stefan waren zwei Frauen aufgefallen. Vom Alter und Aussehen zu schließen, vermutete er, es seien Mutter und Tochter. Die Mutter, sie hieß Maria, hatte lockiges, kinnlanges Haar, dessen Pony durch einen schwarzen Haarreif im Haupthaar verschwand, und ein ebenmäßiges Gesicht. Die blonden Haare der Tochter – Mathilde – waren, wie es zu dieser Zeit Mode war, in einem Dutt, der direkt auf der Oberseite des Kopfes mit einem Haargummi befestigt war, zusammengebunden. Offen reichten sie ungefähr bis zur Mitte ihrer Wirbelsäule. Das ebenmäßige Gesicht hatte sie von ihrer Mutter geerbt. Aufgrund ihrer Jugend – Stefan glaubte, sie sei um die 30 Jahre alt – fielen noch mehr Blicke auf sie. Aus der Fülle an Reizen, die sich vervielfachte, als sich Mathilde und Stefan kurz in die Augen schauten, hob sich unter anderem die glatte und leicht gebräunte Haut Mathildes ab.
Stefan beobachtete, wie sich Mathilde ans Ende der Reihe vor dem Kaffeeautomaten anstellte. Eine der beiden Frauen, die kurz darauf hinter ihr warteten, verband die zwei losen Bänder in der Mitte des Schlitzes des Rückenteils von Mathildes ärmelloser, lindgrüner Bluse – der zuvor ungewollt eine große, freie, ovale Fläche ihres Rückens offengelegt hatte – wieder zu einer Schlaufe zusammen.
Mathilde drehte sich irritiert um, als sie bemerkte, dass jemand sich an den Bändern am Rückenteil ihrer Bluse zu schaffen machte. Sie blickte erleichtert, als sie sah, dass es eine Frau war, die sich darum sorgte, dass alles seine Ordnung hatte.
Maria, die ihren 57. Geburtstag in drei Monaten feiern sollte, leitete seit dem Ende ihres Musikstudiums die Musikschule einer Kleinstadt in der Nähe von Paderborn, beinahe 33 Jahre lang. Ihre Persönlichkeit passte zu diesem Posten. Sie war kämpferisch und konnte dadurch den Etat der Musikschule, der größtenteils von der Stadtverwaltung getragen wurde, schrittweise erhöhen. Und auch die Zahl der Musikschüler wuchs, bis auf eine kurze Phase ihrer Tätigkeit, kontinuierlich. Sie begann mit 300 Schülern, inzwischen waren es über 700 geworden. Die Kehrseite ihres extrovertierten Charakters, genauer, die Kehrseiten, bekam ihr Mann Richard zu spüren.
Es ist ja das Besondere, dass manche Frauen, die in allen anderen verwandtschaftlichen Bezügen, Freund- und Bekanntschaften, großherzig, verständnis- und liebevoll, nicht nachtragend und geduldig sein können, ihren Ehemann oder Partner auf Herz und Nieren prüfen und achtgeben, dass sie ihm nur dosiert Annehmlichkeiten schenken. Am Anfang prüfen sie ihn, weil sie wissen möchten, ob er stressresistent genug ist, um ein treuer Gefährte, ein guter Ernährer und Familienvater zu sein. In der Mitte der Ehe prüfen sie ihn, weil sie sich vergewissern möchten, ob er treu und loyal zu ihnen und ihren Kindern steht. Und am Ende der Ehe prüfen sie ihn, um zu erfahren, ob sie während der Ehe nicht doch etwas übersehen haben.
Richard, ebenfalls Pianist wie Maria, liebte sie seit dem Studium. Ihre Beziehung war von Höhen und Tälern bestimmt. In den Tälern dachte Maria zunehmend an Scheidung. Als sie eines morgens neben Richard aufwachte, ihn ansah, wollte sie sich scheiden lassen. Doch etwas hielt sie von diesem Schritt zurück. Stattdessen zog sie für einige Jahre in ein anderes Haus, ehe sie wieder zu Richard zurückkehrte.
Diese Trennungszeit belastete Mathilde. Sie ließ es sich nicht anmerken, überspielte es. Mathilde fühlte sich zu ihrem Vater hingezogener, obgleich sie die Zuverlässigkeit ihrer Mutter schätzte, was keine ausgesprochene Fähigkeit ihres Vaters war. Sie besuchte Richard zu allen sich ergebenden Gelegenheiten. Bei ihm zuhause stand ihre Harfe. So war es ein Einfaches, ihren Vater täglich zu besuchen. Sie musste ja Harfe üben. Beim Harfespielen vergaß sie ihre Traurigkeit, dass ihre Mutter und ihr Vater nicht mehr zusammenwohnten. Als das ältere Geschwister fühlte sie sich verpflichtet, alles dafür zu tun, dass Maria wieder zu Richard zog. Da es ihr vorerst nicht gelang, konzentrierte sie sich aufs Harfenspiel. Als Maria wieder zu Richard gezogen war, hörte Mathildes übermäßiger Einsatz für die Musik nicht auf. Denn ihre Sorge, die Eltern würden sich erneut trennen, wurde nicht still.
Nach ihrem Abitur erhielt Mathilde einen Studienplatz an der ‚Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin‘. Im Anschluss daran spielte sie in verschiedenen Orchestern als Honorarkraft, bis sie sich gegenüber 130 Mitbewerberinnen durchsetzte und Soloharfenistin der Berliner Philharmoniker wurde. Nach dem Probejahr, das vor zwei Monaten geendet hatte, erlitt sie einen Zusammenbruch. Die vielen Jahre der Anspannung, in denen ihr Körper durchgehalten hatte, ballten sich in einem gutartigen Tumor an der Niere. Er konnte komplett entfernt werden. Doch der Schreck saß tief, wenn auch nicht so tief wie die Sorge um eine mögliche, erneute Trennung, ja vielleicht sogar Scheidung ihrer Eltern. Diese Sorge war aktiv und beeinflusste Tag um Tag ihr Leben, ihre Entscheidungen, ihre Freuden und ihre Traurigkeiten. Diese seelische Geschwulst war bösartig, streute ihr Gift in sämtliche, gesunde Bereiche, sich immer weiter ausdehnend, so dass es immer schwieriger wurde, sich mit der Musik zu beruhigen.
Wie Stefan und Max waren Maria und Mathilde noch nie allein miteinander verreist. Da Maria die Gabe hatte, spontan zu sein, und das Gefühl und später den Gedanken nicht verlor, sie habe etwas mit Mathildes Zusammenbruch zu tun, lud sie Mathilde auf diese Israelreise ein. Mathilde wunderte sich, weshalb das Reiseziel ‚Israel‘ sein solle. Sie waren zwar beide katholisch getauft, ansonsten hatten sie mit der Kirche und dem Glauben nicht viel am Hut. Weshalb also ‚Israel‘? Auf Mathildes Frage, warum es ‚Israel‘ sein solle, Mallorca, Tunesien, Griechenland oder Italien seien doch auch schön und schneller zu erreichen, hob Maria die Schultern und sagte: „Keine Ahnung. Als ich vorgestern Morgen aufwachte und aus dem Fenster schaute, war mir klar, wir zwei müssen nach Israel reisen.“
Mathilde wusste nicht, wie ihr geschah. Aber sie war offen, nach ihrem Zusammenbruch noch offener, weil auch sie mutmaßte, dass sie nicht von ungefähr krank geworden war. Zudem war sie neugierig, wie es sein würde, allein mit ihrer Mutter zu verreisen.
Stefan blickte von Mathilde zu Max, der immer noch mit seinen Tischnachbarn Andreas und Inge sprach. Stefan hörte, wie Andreas zu Max sagte: „Wir müssen noch unsere Koffer packen. Aber wir sehen uns ja gleich wieder in der Lobby.“
Da die Schlange vor dem Kaffeeautomaten auf zwei Personen zusammengeschrumpft war, stellte sich nun Stefan an und holte für Max und sich zwei Café, die sie tranken, ehe sie ihre gepackten Koffer aus dem Hotelzimmer holten und mit dem Aufzug in die Hotellobby fuhren.
Dort hatte sich schon ein Pulk von etwa zwanzig Leuten um einen jungen Mann geschart, der sie, gemessen an der Gelöstheit und an dem Lachen, bestens unterhielt und der Reiseführer sein musste. Max und Stefan gesellten sich dazu und hörten, wie er gerade begann, die Vornamen auf seiner Liste laut vorzulesen. Kam eine Antwort, machte er einen Haken hinter dem Namen. Als er am Ende seiner Liste angelangt war, fehlten noch zwei Haken, damit die Gruppe komplett war. Noch einmal fragte er laut: „Maria und Mathilde?“ Keine Reaktion. Stefan schaute in die Gruppe und bedauerte, dass die beiden Frauen, die er zuvor im Speisesaal gesehen hatte, offensichtlich nicht zu ihrer Reisegruppe gehörten. Dass sie Maria und Mathilde hießen, schien ihm unwahrscheinlich. Eher hätte er gedacht, die Tochter würde z.B. Yvonne, Vanessa, Lena, Juliane oder Katharina heißen. Und bei der Mutter dachte er an Namen wie Renate, Gabriele, Sabine, Gisela oder Eva.
„Lasst uns auf die beiden noch einen Moment warten“, sagte Ben, der Reiseführer, der schon seit zehn Jahren Touristen das Heilige Land zeigte. „Für die, die es noch nicht gehört haben: Mein Name ist Ben Schneider. Ich bin für die nächste Woche ihr Reiseguide und freue mich auf die Tage mit ihnen. Wie sie in ihrem Programm lesen konnten, werden wir heute zunächst mit dem Bus – unser Busfahrer, das ist der Tobias – an den Strand von Tel Aviv fahren und von dort nach Jaffa laufen, wo wir uns die Altstadt anschauen. Anschließend holt uns Tobias ab und fährt uns durch Tel Aviv in Richtung Caesarea, eine der bedeutendsten antiken Städte in Palästina. Von dort geht es nach Akko, eine alte Hafenstadt, an der viele der Kreuzfahrer an Land gegangen sind. Hier können alle, die es wollen, mit mir in einem kleinen Restaurant zu Mittag essen. Am Nachmittag fahren wir nach Haifa weiter und werden von dort zum See Genezareth aufbrechen. An dessen Ufer liegt das Kibbuz, in dem wir die kommenden zwei Nächte übernachten. – Ah, die beiden Damen, die gerade aus dem Aufzug kommen, das könnten, wenn wir Glück haben, Maria und Mathilde sein.“
Stefan drehte sich um und lächelte.
„Entschuldigung, wir haben unsere Pässe nicht mehr gefunden. Jetzt sind sie aber wieder aufgetaucht. Alles im grünen Bereich“, sagte Maria, während Mathilde neben ihrer Mutter lief.
Wie bereits im Speisesaal ließen Stefan und Max den anderen den Vortritt und verließen als eine der letzten mit ihren Koffern die Lobby des Hotels. Ihr Busfahrer Tobias, untersetzt, wuscheliges graues Haar und auffällig dienstfertig, nahm ihnen die Koffer ab und verstaute sie. Als Max und Stefan als erste in den Bus einstiegen, hatten sie freie Platzwahl. Insgesamt waren sie nur 21 Personen, so dass der große Bus, der für über 50 Personen ausgerichtet war, viel Freiheit bot. Max wählte die zweite Sitzreihe auf der rechten Seite. Er setzte sich ans Fenster, Stefan neben ihn. Vor ihnen saß das Ehepaar, das gestern mit ihnen die Rückbank des kleinen Buses teilte, mit dem sie vom Flughafen abgeholt wurden. Neben ihnen machten es sich Andreas und Inge gemütlich und zwei Reihen hinter ihnen richteten sich Maria und Mathilde ein. Die Reihe direkt hinter ihnen blieb unbesetzt.
Ben trug weit geschnittene Jeans und ein kurzärmliges Hemd, das über die Hose hing. Er war braun gebrannt, hatte schwarzes kurzes Haar, das schon begonnen hatte, vom Scheitel bis ungefähr zur Mitte des Kopfes zurückzuweichen. Dagegen hatte er einen starken Bartwuchs. Obwohl er sich erst vor drei Stunden rasiert hatte, sah man bereits die schwarzen Stoppeln. Er hatte einen grünen Militärrucksack dabei, der seine Kleidung, seinen Kulturbeutel und Bücher enthielt. Ließ er diesen im Kofferraum des Buses verstauen, behielt er einen zweiten, kleineren, schwarzen Rucksack bei sich, in dem er alles bei sich hatte, was er tagsüber benötigte.
„Ben kommt sicher aus Bayern“, sagte Max zu Stefan. „Bist du dir da sicher?“, fragte Stefan zurück, „ich kann bei ihm keinen bayerischen Dialekt raushören.“ Daraufhin fragte Max Ben: „Bist du in Bayern aufgewachsen?“ Ben blickte irritiert, weil ihn die direkte Frage überraschte und weil er verdutzt war, dass allein die Sprachmelodie, in der er Deutsch sprach, verriet, dass er aus Bayern stammte. „Du hast Recht. Ich bin in der Nähe von Rosenheim aufgewachsen.“
Tobias fuhr den Bus dieselbe Straße entlang, an der Stefan und Max zum Strand gelaufen waren. Sobald das Mittelmeer in Sichtweite war, fuhr Tobias rechts ran und ließ die Reisegruppe aussteigen, nachdem Ben daran erinnert hatte, dass für Mitteleuropäer mit der israelischen Sonne selbst im Oktober nicht zu spaßen sei.
Ben fragte, ob jemand die Aufgabe übernehmen würde, am Ende der Gruppe zu laufen, damit niemand verloren ginge. Max und Stefan erklärten sich dazu bereit. Das habe unter anderem den Vorteil, dachte Stefan, dass er sich in Ruhe anschauen könne, wer zusammen mit ihnen Israel kennenlernte. Die Sonne zeigte bereits jetzt – gegen halb neun Uhr vormittags –, welche Energie sie besaß. So mussten Stefan und Max nicht lange überlegen, ob sie ihre Leinenhüte im Bus lassen oder aufsetzen sollten. Da die Hüte beide beige mit einer schwarzen Krempe waren, wirkten die beiden, wie sie am Ende der Gruppe liefen, wie zwei langgezogene Schlusslichter.
Max war überrascht, dass es nicht lange dauerte, bis sie die ersten bitten mussten, sich der Gruppe wieder anzuschließen. Diese hatten ihre Kameras ausgepackt, machten Fotos und waren damit so beschäftigt, dass sie nicht mehr daran dachten oder es ihnen nicht sonderlich wichtig war, Teil einer Gruppe zu sein, die sich langsam von ihnen absetzte. Sie mussten immer wieder daran erinnern, die anderen nicht aus dem Blick zu verlieren, bis ein nonverbales Zeichen ausreichte, die Gruppe zusammenzuhalten.
Von dieser Aufgabe entlastet konnte sich Ben darauf konzentrieren, die Geschichte von Jaffa zu erzählen. Er war ein begnadeter Reiseführer. Ben glich dem verstorbenen Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki. Wie dieser ohne Punkt und Komma und mit Begeisterung über Literatur gesprochen hatte, so erzählte Ben mit Verve und Farbe von Jaffa. War Jaffa lange Zeit mehrheitlich von Arabern bewohnt, verdrängten sie die Gentrifizierung und die Touristen zunehmend. In dem Maß, wie der Hafen von Jaffa unbedeutender wurde, entstanden hippe Restaurants am Kai, deren Preise für die einheimischen Araber unerschwinglich waren.
Am Rande der verwinkelten Altstadt von Jaffa mit den anmutigen Gassen wies Ben seine Gruppe auf den Laden eines Geldwechslers hin. Wer noch Euro in Schekel umtauschen wolle, würde hier einen guten Kurs bekommen.
Als Stefan den kleinen Laden betreten wollte, sah er im Augenwinkel, dass ihm Mathilde gefolgt war. Geistesgegenwärtig hielt er ihr die Tür auf. Sie lächelte. „Ich brauch‘ auch noch ein paar Schekel. Ich hab‘ ganz vergessen, in Berlin noch zur Bank zu gehen“, sagte sie. Überrascht, zum ersten Mal Mathildes Stimme gehört zu haben, antwortete er: „So ging’s mir auch. Allerdings habe ich in Frankfurt ganz vergessen, noch zur Bank zu gehen.“
Stefan war froh, nach dem Spaziergang durch die Altstadt von Jaffa wieder in den klimatisierten Bus einzusteigen. Hier machte Ben Werbung für die gekühlten Getränke, die bei Tobias gekauft werden konnten. Dann fuhren sie los. Ben nahm das Mikrofon mit der rechten Hand und hielt sich mit der linken Hand an der Lehne seines Platzes fest. Diese Position eingenommen war kein Halten mehr für seinen Redefluss. Er erklärte die Gebäude der Innenstadt von Tel Aviv, wies auf die Bauhaus-Architektur hin, flocht Anekdoten aus der jüngeren Vergangenheit Israels und der älteren Geschichte von ihm selbst ein und fühlte sich von den interessierten Zuhörern – Andreas, Inge, Max, Stefan, Maria und Mathilde –, ermuntert, ins Detail zu gehen.
Als sie Tel Aviv auf dem Highway 2 in Richtung Caesarea verließen, zeigte Ben auf ein Gebäude, in dem angeblich ein Teil des israelischen Geheimdienstes untergebracht war. Wenig später, ebenfalls auf der linken Seite, erstreckte sich ein hügeliges Gelände mit vielen Sträuchern, auf dem Ben – so sagte er, ohne das Mikrofon zu verwenden, damit es nicht alle hören konnten – einen Ausbildungsabschnitt zu Beginn seiner Militärzeit absolviert habe.
Stefan sagte zu Ben: „Ich hab‘ in einer Dokumentation gesehen, dass viele Israelis, die ihren Militärdienst beendet haben, anschließend durch Indien reisen, um dort wieder zu sich zu kommen.“ Damit traf Stefan ins Schwarze. Auch Ben reiste nach seiner Militärzeit nach Indien, um die Erlebnisse zu verarbeiten. Unglücklicherweise hatte er innerhalb der Zweiten Intifada für sein Land kämpfen müssen.
„Wie heißt du?“, fragte Ben. „Stefan.“ Dann hielt Ben das Mikrofon vor seinen Mund und sagte zu allen im Bus: „Hier vorne, das ist Stefan. Er hat erzählt, dass er in einer Dokumentation erfahren hat, dass viele Israelis nach ihrer Militärzeit …“. Und so erzählte Ben bis kurz vor ihrer Ankunft in Caesarea über die Bedeutung des Militärs für Israel. Besonders eindrücklich erschienen Max zwei von Bens Aussagen: (1) „Würde das israelische Militär einen Tag nicht in Alarmbereitschaft sein, würden die Nachbarn sofort einmarschieren und der Staat Israel, wie er nach dem zweiten Weltkrieg gegründet worden sei, wäre Geschichte.“ (2) „Die meisten Israelis hören oder schauen alle halbe Stunde Nachrichten, um sich zu vergewissern, ob es neue Angriffe gegen Israel gibt.“
Von der antiken Stadt Caesarea waren viele Überreste erhalten geblieben, was sie zu einem Mekka für Altertumsforscher, für Latein- und Geschichtslehrer und für die Touristengruppen machte, die mehr von Israel mitbekommen wollten als das, was ihnen in ihren Heimatländern zugetragen wurde.
Zunächst führte Ben die Reisegruppe zum römischen Theater von Caesarea. Da das Gelände mit den Relikten der Stadt überschaubar war, bestand keine Notwendigkeit, dass Max und Stefan als Schlusslichter das Ende der Gruppe markierten. Jetzt nahmen sie Ben in ihre Mitte und liefen mit ihm vornweg. Mit wenig Abstand folgten Maria und Mathilde. Andreas und Inge ließen sich ans Ende zurückfallen.
Als ihnen Ben Einzelheiten zu Caesarea und dessen römischem Theater erläuterte, erinnerte sich Stefan an den Geschichtsunterricht bei Frau Allekotte. Bei deren historischen Ausführungen über die verschiedenen Epochen von der Antike bis ins 20. Jahrhundert konnte er seine Gedanken schweifen lassen. Sein Herz und Kopf waren frei, um Laetitia, die in der ersten Reihe im Klassenzimmer vor ihm saß, zu bewundern und sich auszumalen, wie es sein würde, mit ihr zusammen ins Kino zu gehen. Jetzt im römischen Theater von Caesarea mit der restlichen Reisegruppe im Halbkreis um Ben stehend, tagträumte Stefan, während er Mathildes Profil bestaunte, wie es wäre, würde er mit ihr allein durchs Heilige Land reisen.
„Jetzt habt ihr das Wesentliche über die Stadt Caesarea gehört“, sagte Ben abschließend, was Stefan aus seinem Tagtraum aufweckte, und fuhr fort: „Lauft doch nun eigenständig durch die antike Stadt und überlegt euch, was für ein Leben vor 2500, vor 2000 Jahren hier geherrscht hat, wie die Menschen aussahen, welchen Tätigkeiten sie nachgingen, welche religiösen Vorstellungen sie hatten, wie sie Schiffe an ihrem Hafen empfingen und verabschiedeten und so weiter. Viel Spaß! Wir treffen uns gegen elf Uhr wieder am Bus. Wie gesagt, wenn ihr ein kaltes Getränk kaufen möchtet, Tobias hat genügend Vorräte dabei.“
Stefan und Max marschierten los, besichtigten den Stein, in dem der Name von „Pontius Pilatus“ eingemeißelt war, erkundeten das Ergebnis der technischen Finesse, mit der die Bewohner einen Aquädukt gebaut hatten – Vorläufer der Wissenschaftler und Bauern, die mit der Tröpfchenmethode die Bewässerung in Israel revolutionierten – und schlenderten auf dem Platz, auf dem früher Pferde- und Wagenrennen veranstaltet wurden. Am Rande des Hippodroms, zur Landseite hin, kletterten Stefan und Max auf Steinen, die Stefan an das Felsenmeer im Lautertal im Odenwald erinnerte. Einen Moment nicht aufgepasst und Stefan rutschte ab, konnte sich mit der rechten Hand glücklicherweise noch abfangen, aber da das Körpergewicht mit einem Mal auf der Hand lastete, gab ihre Haut am Hauptbelastungspunkt nach und öffnete sich. Blut floss. Mit einem Tempotaschentuch, das Stefan auf die Wunde drückte, konnte die Blutung gestoppt werden. Der kleine Ausrutscher machte ihm klar, trotz der Schönheiten Israels und der angenehmen Reisegruppe nicht zu vergessen, dass Israel – wie jedes andere Land – von kleinen bis großen Gefahren alles zu bieten hatte.
Den Highway 2 nach Norden nehmend steuerte Tobias die Reisegruppe bis Haifa, wo es durch einen langen Tunnel hindurchging, bis er auf die Route 4 bog und auf ihr zur Kreuzritterstadt Akko weiterfuhr.
Da Ben damit beschäftigt war, letzte Vereinbarungen per Telefon für die nächsten Stationen ihrer Tagestour bis zu deren Ende im Kibbuz am See Genezareth zu treffen, Max ein Nickerchen machte, Andreas und Inge ihren Lieben zu Hause in Münster erste Fotos sandten und das Karmelgebirge, das sie passierten, wenig aufregend war, hatte Stefan Zeit, zwei Reihen nach hinten zu hören, was sich Maria und Mathilde zu sagen hatten.
Die Wortfetzen, die er aufschnappte, reichten nicht aus, um sie zu einem sinnvollen Ganzen zusammenzufügen. Sie ließen aber den Schluss zu, dass der Gegenstand, über den sie sich gerade unterhielten, nicht konfliktfrei war. Das wunderte Stefan. Jetzt waren sie erst den zweiten Tag in Israel und schon kam es auf diesem heiligen Boden zwischen Maria und Mathilde zu Unstimmigkeiten. Doch vielleicht schuf gerade die friedliche Umgebung dieser Landschaft Raum, dass Dinge zur Sprache kommen konnten, die ansonsten ungesagt oder zu wenig gründlich gesagt blieben. Gefördert wurde es durch den künstlichen Umstand, dass sich die Gruppenreisenden in dieser einen Woche wie Kinder fühlen konnten. Denn Ben und Tobias kümmerten sich wie Eltern um die Sicherheit, das leibliche wie seelische Wohl sowie das Reiseprogramm. Sie gingen auf die individuellen Ansprüche ein, die sich aber im Rahmen hielten, da alle Teilnehmer, so unterschiedlich sie auch waren, Anteil an der Schnittmenge gesunden Menschenverstands besaßen.
Wie eine unbekümmerte äußere Atmosphäre es begünstigt, Innerem den Weg zu ebnen, sich auszudrücken, hatte Stefan bei Schweigeexerzitien in einem Kloster am Bodensee erlebt. Bereits am zweiten Tag stand das präsent auf der Bühne, was im Alltag hinter den Kulissen spielte.
Dass etwas, was angeschaut werden will, gerade dabei war, die gemeinsame Bühne von Maria und Mathilde zu betreten, verstand Stefan, auch wenn er die Worte nicht hörte. Es schien, als müsse Maria mit Druck jedes einzelne Wort nach draußen schieben. Die Worte flossen nicht, sie wurden gepresst. Stefan fragte sich, was es war, das die Worte und Gefühle von Maria so blockierte. Mathilde war der passivere Part in der Unterhaltung. Ihre wenigen Worte genügten allerdings, dem Gespräch eine Richtung zu geben, die Maria in die Enge trieb, mehr Kraft und Lautstärke aufwenden zu müssen, um sich Gehör zu verschaffen.
Mitten in Akko konnte Tobias den Bus abstellen und die Gruppe aussteigen lassen. Die meisten nahmen Bens Angebot an und folgten ihm zu dem wenige Gehminuten entfernten Restaurant, in dem bereits fünf Tische zu einer großen Tafel zusammengeschoben waren. Um ihn herum fanden alle 15 Personen Platz. 1-Liter-Plastikflaschen und Gläser mit einer Zitronenscheibe waren für die Gäste auf einem rot-weiß-karierten Tischtuch bereitgestellt. Zu einem Pauschalpreis von 80 Schekel wurden typische Speisen der palästinensischen Küche serviert: Verschiedene gekochte und ungekochte Salate, Pasta-Fingerfood, Auberginen-Paste, Fladenbrot, in das wahlweise Lammfleisch oder Falafel gefüllt werden konnte, und zum Dessert Wassermelone, Pflaumen und Pfirsiche.
Stefan wurde überrascht, wie ihn dieses gemeinsame Essen zu rühren begann. Das letzte Mal, als er an einer so großen Tafel mit anderen gegessen hatte, war bei seiner Hochzeit im Schwarzen Stern am Frankfurter Römer vor knapp zehn Jahren.
Erst heute Morgen hatte er erfahren, dass die anderen, die hier zusammen am Tisch saßen, mit ihm durchs Heilige Land reisen würden. Bis auf seinen Bruder waren ihm alle fremd. Und schon jetzt, vorbereitet durch die Besichtigungen in Jaffa, Tel Aviv und Caesarea und die gemeinsame Busfahrt, spürte er eine Zusammengehörigkeit.
Wenn die Teilnehmer einer Gruppenreise nicht zusammenpassen, kann dasselbe Mittagessen in Akko zu einer lästigen Pflicht werden. Doch obgleich niemand auf die Zusammensetzung der Reisegruppe Einfluss genommen hatte, verband sie etwas, dass sie gut miteinander reisen ließ.
Gegenüber von Max und Stefan saß eine Familie aus Kaiserslautern. Die Eltern, Hendrik und Maike, waren eine Idee älter als Max und Stefan. Deren Sohn Lennard hatte im vergangenen März seinen 15. Geburtstag gefeiert. Wie sich bei der Unterhaltung während des Mittagessens herausstellte, arbeitete Hendrik in der Entwicklungsabteilung eines Automobilzulieferers und Maike, die Englisch und Französisch studiert hatte, war bei einem Dolmetscherbüro angestellt. Lennard ging in die neunte Klasse. Hendrik und Maike hatten ihm zu seiner Konfirmation im Mai diese Reise geschenkt.
Es fiel den meisten schwer, von dieser überdachten Terrasse, die im Schatten eines alten Steinhauses lag, in das grelle Mittagslicht aufzubrechen. Der Zeitplan ließ aber wenig Spiel. Sie mussten gehen, auch wenn Ben dieses ‚Muss‘ annehmbar verkleidete: „Wir werden gleich einen ‚verzauberten Garten‘ besuchen, den Eingangsbereich zur Festung der Rittersäle und anschließend können wir auf dem Markt von Akko den besten Kaffee an der israelischen Mittelmeerküste trinken!“
Die Atmosphäre des ‚verzauberten Gartens‘ stand in Kontrast zur dunklen Festung der Rittersäle, die einem das düstere Mittelalter der Kreuzzüge und Judenverfolgungen erfahrbar machte. Gott sei Dank leb‘ ich in diesem Jahrhundert, dachte Stefan, indem er die dunklen Räume mit den martialischen Bildern, Fahnen und Waffen durchquerte. Das war nicht seine Welt. Froh blickte er am Ende des Rundgangs in den weiten Himmel über Akko, der vor 1000 Jahren ähnlich ausgesehen haben musste.
Nicht nur Stefan, sondern auch Max und einigen anderen war die Düsternis der Festung aufs Gemüt geschlagen. Der Kaffee, der von Ben als der beste der israelischen Mittelmeerküste versprochen wurde, war Geschmackssache. Liebte man einen starken, fast sauren Kaffee, konnte man Ben Recht geben. Andernfalls hielt man ihn für einen Hochstapler. Auf jeden Fall vertrieben der Kaffee und das süße Gebäck, das es umsonst dazu gab, die letzten Geister des Mittelalters. Nur Mathilde litt mit einem Mal unter einer Übelkeit, die ihr den Rest dieses Tages und auch den nächsten beschwerte, den sie in ihrem Zimmer im Kibbuz verbrachte.
Als Tobias mit allen an Bord den Busparkplatz verließ und Kurs auf Haifa nahm, fielen mehreren der Gruppe die Augen zu. Die vielen Eindrücke seit ihrem Aufbruch vom Hotel in Tel Aviv ermüdeten sie. Auch Max, der schon auf dem Weg nach Akko im Bus eingeschlafen war, ließ den Kopf nach wenigen Minuten Fahrt auf die Seite sacken.
Sein Leben war in den letzten Jahren kein Zuckerschlecken gewesen. Die Scheidung von seiner Frau, sie nagte an seinem Urvertrauen. Außer der Scheidung kosteten ihn auch die Arbeit und die Erziehung der beiden Söhne Kraft. Hier im Reisebus in Israel konnte er Schlaf nachholen.
Das Licht über Haifa wurde schwächer. In Serpentinen fuhr Tobias den Reisebus in eine schwindelerregende Höhe. Fast am Scheitelpunkt des Gipfels angekommen parkte er am obersten Zipfel der sich den Berg hinaufziehenden Gartenanlage der „Hängenden Gärten der Bahai“. Nachdem die Gruppe ausgestiegen war und einen freien Blick auf die Gärten sowie über die Bucht von Haifa teilte, erklärte Ben die Bedeutung und Geschichte einiger Gebäude. Aus der Ferne konnten die U-Boote im Hafen ausgemacht werden, die das israelische Militär von Deutschland gekauft hatte.
Die Religion der Bahá`i kannten Max und Stefan durch einen gemeinsamen Freund, der Bahá`i war. Nicht weit von Frankfurt entfernt auf einer Anhöhe des Taunus stand der europäische Bahá`i-Tempel. Er bestach durch eine schlichte, europäische, am Bauhaus orientierte Architektur. Diese konnte mit der Pracht des von den paradiesischen Gärten umgebenen Totenschrein des Bab – dem Wegbereiter der Bahá`i-Religion – hier in Haifa nicht verglichen werden.
Die Bahá`i sind die jüngste der Weltreligionen. Auf dem Gelände in Haifa befand sich neben dem Grabmal des Bab die weltweit wirkende Verwaltungszentrale der Bahá`i. Ihre zentralen Grundsätze hießen: „Die ganze Menschheit ist als Einheit zu betrachten. Die Religion muss die Ursache der Einigkeit und Eintracht unter den Menschen sein. Mann und Frau haben gleiche Rechte. Beide Geschlechter müssen die beste geistige und sittliche Bildung und Erziehung erfahren.“
Gerne hätten Stefan, Maria und noch ein paar andere der Gruppe die Bahá`i Gärten besichtigt, aber die Wärter waren dabei, das obere Tor zur Gartenanlage zu schließen.
Auf der anderen Seite des Berges, den Tobias zuvor den Bus nach oben gesteuert hatte, musste er ihn und die Insassen heil nach unten bringen, was schwieriger war. Nicht nur das Gefälle, sondern auch die Enge der einspurigen Straße erforderte Tobias‘ und Bens Aufmerksamkeit. Ben hatte im Blick, dass die rechte Seite des Buses an nichts stieß.
Nach der Hälfte der Strecke des mit Wohnhäusern dicht bebauten Berges versperrte ein Lieferwagen die Straße. Zwar hatte dessen Fahrer die Warnblinkanlage angestellt, so dass der Wagen bei der Dämmerung von Weitem gut sichtbar war. Doch die Lichter halfen nicht dabei, an ihm vorbeizukommen. Ben stieg aus, während Tobias von innen den linken Außenspiegel einklappte. Aber diese Verminderung der Busbreite reichte nicht, das Hindernis zu umfahren. Also begann Tobias zu hupen und Ben klingelte bei dem Haus, vor dem der Lieferwagen stand. Kurz darauf kam ein Mann aus dem Haus gelaufen. Er entschuldigte sich bei Ben und Tobias, er habe eine Waschmaschine liefern müssen. Alles war geklärt. Er hob dankend die Hand, ehe er in seinen Wagen stieg und vor der Reisegruppe die zweite Hälfte des Berges hinunterfuhr.
Jetzt gab es kein Halten mehr. Tobias fuhr auf dem Highway 6 ostwärts zum See Genezareth. Die leicht hügelige, trockene Landschaft, auf der wahllos ein paar Häusersiedlungen, Sträucher, manchmal Ansammlungen von Olivenbäumen und hin und wieder eine Schafherde zu sehen waren, bildete eine Kopie der Landschaftsaufnahmen, die Max zum ersten Mal in dem Bildband betrachtete, den Dieter Elli von seiner Israelreise mitgebracht hatte. Dass sich seine Vorstellung, seine Phantasie, nahezu deckungsgleich zur Wirklichkeit verhielt, verwunderte ihn. Bei allen anderen Reisen zuvor gab es einen Unterschied, mal stärker, mal schwächer zwischen den Bildern in den Reiseführern, die Max‘ Phantasie anregten, und der Realität, die sich während der Reise offenbarte.
Das Zugangstor zum Kibbuz war bereits verschlossen, als sie im Dunkeln ankamen. Ein Anruf von Ben und ein Wachmann öffnete das Tor, so dass sie ins Innere des Kibbuzes hineinfahren konnten. Die hohe Luftfeuchtigkeit hier am Ufer des See Genezareth erinnerte Stefan an einen Urlaub auf Hawaii. Als er dort aus dem Flugzeug ausgestiegen und zum Terminal gelaufen war, fühlte er sich wie in weiche, angefeuchtete Watte gehüllt. Dasselbe Gefühl erfüllte ihn hier, als er aus dem Bus ausstieg, seinen Koffer aus dem Gepäckraum holte und, nachdem sie von Ben einen Schlüssel bekommen hatten, neben Max zu ihrem kleinen Ferienbungalow ging. Dabei kamen sie dem See Genezareth näher, konnten ihn sehen, bevor sie auf einem der schmalen Wege links abbogen, wo sie ihre Unterkunft, Haus Nr. 33, aufschlossen.
Auch die gepflegte Grünanlage sowie die weiß getünchten Bungalows, die aus stabilen Holzelementen zusammengebaut und denen kleine Veranden vor der Eingangstür vorgelagert waren, glichen den Häusern der Appartementanlage auf Hawaii. Die moderne Einrichtung, die einem schwarz-weißen Farbkonzept folgte, bildete einen Kontrast, den sich die US-amerikanischen Innenarchitekten in der hawaiianischen Appartementanlage nicht zu setzen getraut hatten.
Nachdem sie sich eingerichtet und erholt hatten, liefen sie in Richtung des zentral gelegenen Gebäudes, in dem sich der Speisesaal befand. Dessen lange Tischreihen führten zu einer breiten Fensterfront mit Seeblick. Der Saal bot Platz für 250 Personen. Da nicht ersichtlich war, welcher der Tische für Stefans und Max‘ Reisegruppe gedacht war, platzierten sie sich mit ihren Tellern, auf denen Kostproben der verschiedenen Salate, des Fisch- und Lammgerichts sowie des Kartoffelgratins lagen, an dem Tisch, der vor der linken Wand des Saals stand. An diesem saß noch niemand.
Das Paar, das sich Max und Stefan gegenübersetzte, war wie Maria und Mathilde ein Mutter-Tochter-Gespann, das um eine Generation nachhinten verschoben war.
Die Mutter, Hannelore, wohnte in Dortmund und war jenseits der achtzig. Deren Tochter, Martina, war Mitte fünfzig und lebte in Berlin. Unvermittelt begannen sie das Gespräch. Es sei ihre letzte Reise, sagte Hannelore. Martina habe sie nochmal überredet. Eigentlich wolle sie nicht mehr verreisen. Aber Israel, da sei sie noch nie gewesen. Darum habe sie sich einen Ruck gegeben und sich entschlossen, mit ihrer Tochter Martina auf ihre letzte Reise zu gehen. Hannelore war ein Sonnenschein. Ehe Martina von sich erzählen konnte, was ihr ein Anliegen war, redete Hannelore über ihren Sohn Markus, dem älteren Bruder von Martina.
Markus sei durch den Tod seines Vaters schmerzhaft bewusst geworden, dass die Zeit endlich sei. Denselben Fehler seines Vaters, zu oft die Pflicht dem Vergnügen vorzuziehen, habe er nicht begehen wollen. Deshalb habe er angefangen, die Welt zu bereisen. Das mache er inzwischen zehn Jahre lang. Er habe ein funktionierendes System entwickelt, wie er sich seine Reisen finanziere. Er arbeite als Briefträger für die Post, kaufe und verkaufe alte Musikinstru-mente und halte Vorträge über seine Reisen, hauptsächlich in Stadtbibliotheken. Auf diese Weise könne er mehr als sechs Monate pro Jahr die Welt sehen. Sein Lieblingsgebiet sei Südamerika, vor allem Kolumbien habe es ihm angetan, einer alten Liebe wegen, die zwar inzwischen einen Kolumbianer geheiratet habe, sich aber trotzdem immer die Zeit nehme, sei Markus vor Ort, sich auf einen Kaffee mit ihm zu treffen und über gemeinsame Erfahrungen zu plaudern.
Je länger Hannelore von ihrem Sohn Markus erzählte, wurde Martina unruhiger. Es gab vermutlich ein Konkurrenzverhältnis zwischen den Geschwistern, dachte Stefan. Um den Redefluss von Hannelore zu stoppen, fragte sie Max und Stefan, woher sie kämen, was sie beruflich machten und was sie veranlasste, die Reise nach Israel zu unternehmen. Während Max und Stefan antworteten, vergrößerte sich Martinas Lust, endlich auch von sich zu erzählen. Als Stefan berichtete, er habe, bevor er in einer Stiftung zu arbeiten begonnen habe, an einer Schule Deutschunterricht gegeben, war das Stichwort für sie gefallen, sagen zu können, wer sie sei, wo sie wohne, was sie gerade beschäftige etc. Das, was sie erzählte, bestätigte Stefans Eindruck, dass etwas bei ihr im Argen lag. Und da er in seiner missglückten Ehe gelernt hatte, dass die Probleme seines Gegenübers nicht seine Probleme waren, stieg er innerlich bereits aus der Unterhaltung aus und dachte an ein Zitat von Antoine de Saint-Exupéry: „Viele Probleme lösen sich von selbst, wenn man nichts tut.“
Mathilde ging es immer noch schlecht, so dass sie auf ihrem Zimmer geblieben war. Maria, die sich gern unterhielt, schien es zu genießen, während dieses Abendessens nicht Mutter, sondern einfach Frau sein zu können. Max fiel auf, dass sie – ohne Mathilde – weniger pädagogisch, weniger angespannt war. Jetzt förderte Maria das Gespräch ihrer Tischnachbarn. Sie konnte die Unterhaltung einer Gruppe gut moderieren. Spielerisch nahm sie unterschied-liche Positionen ein. Mal dominant, mal zurückhaltend, mal kaum hörbar, mal anschwellend sich einmischend, mal den einen verteidigend oder die andere motivierend. Es war schön, zuschauen zu dürfen, wie Maria aufblühte, als Mathilde krank im Ferienbungalow mit ihrer besten Freundin in Paderborn telefonierte.