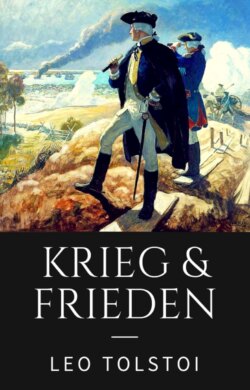Читать книгу Krieg und Frieden - Leo Tolstoi - Страница 34
На сайте Литреса книга снята с продажи.
XXVIII
ОглавлениеAm folgenden Tag abends wollte Fürst Andrei abreisen. Der alte Fürst war, ohne von seiner Tagesordnung abzuweichen, nach dem Mittagessen auf sein Zimmer gegangen. Die kleine Fürstin befand sich bei ihrer Schwägerin. Fürst Andrei, in einem Reiserock ohne Epauletten, beschäftigte sich in den ihm angewiesenen Zimmern unter Beihilfe seines Kammerdieners mit Packen, besichtigte dann persönlich die Kalesche, revidierte, ob die Koffer ordentlich aufgeladen waren, und befahl anzuspannen. Im Zimmer waren nur noch diejenigen Sachen zurückgeblieben, die Fürst Andrei immer bei sich führte: eine Schatulle, ein großes, silbernes Reisenecessaire, zwei türkische Pistolen und ein türkischer Säbel, ein Geschenk seines Vaters, der diese Waffen als Beutestücke von der Erstürmung von Otschakow mitgebracht hatte. Alle diese Reiseutensilien hielt Fürst Andrei gut in Ordnung: alles war sauber, wie neu, und steckte in Tuchfutteralen, die sorgsam mit Bändern zugebunden waren.
Im Augenblick einer Abreise, mit der eine Veränderung der Lebensgestaltung verbunden ist, überkommt alle Menschen, die ihre Handlungen zu überdenken fähig sind, gewöhnlich eine ernste Stimmung; sie pflegen in einem solchen Augenblick einen prüfenden Rückblick auf die Vergangenheit zu werfen und Pläne für die Zukunft zu machen. Fürst Andreis Miene war sehr nachdenklich und mild. Die Hände auf den Rücken gelegt, ging er im Zimmer schnell von einer Ecke nach der andern, blickte gerade vor sich hin und wiegte tief in Gedanken den Kopf. War ihm bange davor, in den Krieg zu gehen? Schmerzte ihn die Trennung von seiner Frau? Vielleicht sowohl das eine wie das andere; aber da er anscheinend nicht wünschte, von jemand in dieser Stimmung gesehen zu werden, nahm er, sowie er Schritte auf dem Flurhörte, eilig die Arme vom Rücken, blieb beim Tisch stehen, als ob er damit beschäftigt sei, den Überzug der Schatulle zuzubinden, und gab seinem Gesicht den gewöhnlichen, ruhigen, undurchdringlichen Ausdruck. Es waren die schweren Schritte der Prinzessin Marja.
»Man sagt mir, daß du Befehl zum Anspannen gegeben hast«, begann sie ganz außer Atem (sie war offenbar rasch gelaufen), »und ich wollte so gern noch mit dir ein paar Worte unter vier Augen sprechen. Gott weiß, auf wie lange Zeit wir uns wieder trennen. Du bist mir doch nicht böse, daß ich hergekommen bin? Du hast dich sehr verändert, Andruscha1«, fügte sie wie zur Erklärung dieser Frage hinzu.
Sie lächelte, als sie das Wort Andruscha aussprach. Augenscheinlich war es ihr selbst ein sonderbarer Gedanke, daß dieser ernste, schöne Mann jener selbe Andruscha sein sollte, jener magere, ausgelassene Knabe, der Gespiele ihrer Kindheit.
»Wo ist denn Lisa?« fragte er, indem er auf ihre Frage nur mit einem Lächeln antwortete.
»Sie war so müde, daß sie in meinem Zimmer auf dem Sofa eingeschlafen ist. Ach, Andrei! Welch einen Schatz besitzt du an dieser Frau«, sagte sie und setzte sich ihrem Bruder gegenüber auf das Sofa. »Sie ist noch vollständig ein Kind, und ein so liebenswürdiges, heiteres Kind. Ich habe sie sehr liebgewonnen.«
Fürst Andrei schwieg; aber die Prinzessin bemerkte den ironischen, geringschätzigen Ausdruck, den sein Gesicht angenommen hatte.
»Aber mit ihren kleinen Schwächen muß man Nachsicht haben; wer hätte keine Schwächen, Andrei! Vergiß nicht, daß sie mitten im Getriebe des gesellschaftlichen Lebens aufgewachsen und erzogen ist. Und dann ist auch ihre Lage jetzt keine rosige. Man muß sich in die Lage eines jeden hineinversetzen. ›Alles verstehen heißt alles verzeihen.‹ Bedenke nur, wie schwer es der Ärmsten nach dem Leben, das sie gewohnt war, werden muß, sich von ihrem Mann zu trennen und so allein auf dem Land zu bleiben, und noch dazu in ihrem Zustand. Das ist eine sehr schwere Aufgabe.«
Fürst Andrei lächelte, während er seine Schwester ansah, so wie man zu lächeln pflegt, wenn man Menschen reden hört, die man bis auf den Grund ihrer Seele zu kennen glaubt.
»Du lebst ja doch auch auf dem Land und findest dieses Leben nicht so schrecklich«, sagte er.
»Mit mir ist das eine andere Sache. Von mir ist da weiter nicht zu reden. Ich wünsche mir kein anderes Leben und kann es mir auch gar nicht wünschen, weil ich ein anderes Leben eben nicht kenne. Aber bedenke, Andrei, was das für eine junge Frau, die am gesellschaftlichen Leben ihre Freude gehabt hat, besagen will, wenn sie sich in den besten Jahren des Lebens auf dem Land vergraben soll. Und allerdings wird sie sich hier sehr einsam fühlen; denn Papa ist immer beschäftigt, und ich –: du kennst mich, wie wenig ich einer Frau zu bieten vermag, die an bessere Gesellschaft gewöhnt ist. Nur Mademoiselle Bourienne ...«
»Sie mißfällt mir recht sehr, eure Mademoiselle Bourienne«, sagte Fürst Andrei.
»O nicht doch! Sie ist sehr lieb und gut, und was die Hauptsache ist, sie ist ein bedauernswertes Mädchen. Sie hat so gar niemand, keinen Menschen. Die Wahrheit zu sagen, ich habe gar nicht das Bedürfnis, sie um mich zu haben; es ist mir sogar oft peinlich. Ich bin, wie du weißt, immer etwas menschenscheu gewesen und bin es jetzt in noch höherem Grad als früher. Ich fühle mich am wohlsten, wenn ich allein bin. Aber unser Vater hat sie gern. Sie und Michail Iwanowitsch, das sind die beiden Menschen, gegen die er immer freundlich und gütig ist, weil er ihnen beiden Wohltaten erwiesen hat; denn wie Sterne sagt: ›Wir lieben die Menschen nicht sowohl um des Guten willen, das sie uns getan haben, als um des Guten willen, das wir ihnen getan haben.‹ Unser Vater hat sie als vaterlose Waise geradezu von der Straße in sein Haus genommen, und sie ist ein sehr gutes Wesen. Und dem Vater sagt ihre Art vorzulesen zu. Sie liest ihm abends vor. Sie liest ausgezeichnet.«
»Nun meinetwegen; aber sage einmal offen, Marja, ich meine, es muß dir bei dem Charakter des Vaters doch manchmal schwer werden, mit ihm auszukommen?« fragte Fürst Andrei unvermittelt.
Prinzessin Marja war zunächst erstaunt, dann aber ganz erschrocken über diese Frage.
»Mir ...? Mir ...? Mir sollte es schwer werden?« erwiderte sie.
»Er war ja immer rauh und schroff; aber jetzt ist es, wie mir scheint, besonders schwer, mit ihm zu verkehren«, sagte Fürst Andrei; er sprach, wie es schien, absichtlich in so leichtfertiger Art über den Vater, um seine Schwester in Erstaunen zu versetzen oder sie auf die Probe zu stellen.
»Du bist sonst in jeder Hinsicht ein so guter Mensch, Andrei; aber du bist zu stolz auf deinen Verstand«, erwiderte die Prinzessin, die mehr ihrem eigenen Gedankengang als dem Gang des Gesprächs folgte, »und das ist eine große Sünde. Darf man denn überhaupt über den eigenen Vater sich ein Urteil erlauben? Und wenn man es dürfte, wie könnte ein solcher Mann wie unser Vater ein anderes Gefühl erwecken als Ehrfurcht? Und ich bin so zufrieden, so glücklich in dem Zusammenleben mit ihm. Ich möchte nur wünschen, daß ihr alle euch ebenso glücklich fühltet, wie ich es tue.«
Der Bruder schüttelte ungläubig den Kopf.
»Es ist nur eines, was mir das Herz bedrückt (ich will es dir offen sagen, Andrei): das ist des Vaters Denkungsart in religiösen Dingen. Ich begreife nicht, wie es möglich ist, daß ein Mann mit einem so enormen Verstand das nicht sieht, was doch sonnenklar ist, und wie er in solche Irrtümer hineingeraten kann. Siehst du, das ist mein einziges Leid. Aber auch auf diesem Gebiet scheint sich in der letzten Zeit eine leise Besserung anzubahnen. In der letzten Zeit sind seine Spötteleien nicht mehr so scharf und beißend gewesen wie früher, und er hat sogar den Besuch eines Mönches empfangen und lange mit ihm geredet.«
»Liebe Marja, ich fürchte, daß du und der Mönch euer Pulver unnütz vergeudet«, erwiderte Fürst Andrei spöttisch, aber freundlich.
»Ach, lieber Bruder, ich bete zu Gott und hoffe, daß Er mich erhören wird ... Andrei«, fügte sie schüchtern nach kurzem Stillschweigen hinzu, »ich habe eine große Bitte an dich.«
»Was denn, meine Gute?«
»Nein, versprich mir erst, daß du es mir nicht abschlagen wirst. Es wird dir keinerlei Mühe machen, und es liegt nichts darin, was deiner unwürdig wäre. Aber du wirst mir damit eine Beruhigung verschaffen. Versprich es mir, Andruscha«, bat sie, indem sie die Hand in ihren Ridikül steckte und etwas darin erfaßte, was sie aber noch nicht zeigte, wie wenn das, was sie in der Hand hielt, den Gegenstand der Bitte bildete und sie dieses Ding nicht aus dem Ridikül herausholen dürfte, ehe sie nicht das Versprechen empfangen hätte, daß ihre Bitte werde erfüllt werden.
Sie blickte ihren Bruder schüchtern mit flehenden Augen an.
»Selbst wenn es mir große Mühe machen sollte ...«, antwortete Fürst Andrei, der wohl schon erraten mochte, um was es sich handelte.
»Du kannst ja darüber denken, wie du willst! Ich weiß, du bist darin ebenso wie unser Vater. Denke darüber, wie du willst; aber tu es mir zuliebe. Bitte, tu es! Schon der Vater unseres Vaters, unser Großvater, hat es in allen Kriegen getragen ...« (Sie zog den Gegenstand, den sie in der Hand hatte, immer noch nicht aus dem Ridikül hervor.) »Also du versprichst es mir?«
»Gewiß. Um was handelt es sich denn also?«
»Andrei, ich möchte dich mit einem Heiligenbild segnen, und du mußt mir versprechen, daß du es niemals ablegen wirst. Versprichst du es mir?«
»Wenn es nicht zwei Pud schwer ist und mir den Hals nicht herunterzieht ... Um dir eine Freude zu machen ...«, sagte Fürst Andrei; aber im selben Augenblick tat es ihm auch schon leid, so geantwortet zu haben, da er an dem Gesicht seiner Schwester sah, daß dieser Scherz sie verletzt hatte. »Sehr gern werde ich es tun, wirklich sehr gern, liebe Marja«, fügte er hinzu.
»Auch wenn du nicht daran glaubst, wird der Heiland dich erretten und Sich deiner erbarmen und dich zu Sich zurückführen; denn in Ihm allein ist Wahrheit und Friede«, sagte sie mit einer vor innerer Erregung zitternden Stimme und hielt mit feierlicher Gebärde in beiden Händen ein ovales, altertümliches Christusbildchen, mit schwarz gewordenem Gesicht, in silbernem Rahmen, an einem fein gearbeiteten silbernen Kettchen, dem Bruder entgegen.
Sie bekreuzte sich, küßte das Bildchen und reichte es dem Fürsten Andrei hin.
»Bitte, Andrei, mir zuliebe ...«
Ihre großen, guten, schüchternen Augen strahlten ein schönes helles Licht aus. Diese Augen verklärten das ganze kränkliche, magere Gesicht und machten es schön. Der Bruder wollte das Heiligenbild hinnehmen, aber sie hielt ihn zurück. Andrei verstand sie, bekreuzte sich und küßte das Bild. Sein Gesicht zeigte gleichzeitig zärtliche Rührung und leisen Spott.
»Ich danke dir, lieber Bruder!«
Sie küßte ihn auf die Stirn und setzte sich wieder auf das Sofa. Beide schwiegen.
»Um was ich dich schon gebeten habe, Andrei«, begann dann die Prinzessin: »sei gut und großherzig, wie du es immer gewesen bist, und sei nicht zu streng gegen Lisa. Sie ist so lieb und gut und befindet sich jetzt in einer sehr schweren Lage.«
»Ich habe doch wohl nichts zu dir gesagt, Marja, als ob ich meiner Frau irgendeinen Vorwurf zu machen hätte oder mit ihr unzufrieden wäre. Warum sagst du mir also das alles?«
Auf dem Gesicht der Prinzessin Marja erschienen rote Flecke, und sie schwieg, wie wenn sie sich schuldig fühlte.
»Ich habe dir nichts gesagt, und doch ist dir schon etwas gesagt worden. Und das betrübt mich.«
Die roten Flecke traten auf der Stirn, dem Hals und den Wangen der Prinzessin Marja noch stärker her vor. Sie wollte etwas sagen, war aber nicht imstande, es herauszubringen. Aber der Bruder erriet den Hergang: die kleine Fürstin hatte nach dem Mittagessen geweint, hatte gesagt, sie ahne eine unglückliche Entbindung und fürchte sich davor, und hatte sich über ihr Schicksal, über ihren Schwiegervater und über ihren Mann beklagt; nachdem sie sich ausgeweint hatte, war sie dann eingeschlafen. Dem Fürsten Andrei tat seine Schwester leid.
»Eines kann ich dir versichern, Marja: ich kann meiner Frau keinen Vorwurf machen, habe ihr nie einen Vorwurf gemacht und werde niemals in die Lage kommen, es zu tun; auch mir selbst habe ich mit Bezug auf sie nichts vorzuwerfen; und das wird stets so bleiben, in welcher Lage auch immer ich mich befinden mag. Aber wenn du die Wahrheit wissen willst ... wenn du wissen willst, ob ich glücklich bin: nein! Ob sie glücklich ist: nein! Und woher das kommt: ich weiß es nicht ...«
Nach diesen Worten stand er auf, trat zu seiner Schwester, beugte sich nieder und küßte sie auf die Stirn. Aus seinen schönen Augen leuchteten Verstand und Herzensgüte in ungewöhnlichem Glanz; aber er blickte nicht die Schwester an, sondern über ihren Kopf hinweg in das Dunkel der offenstehenden Tür.
»Wir wollen zu ihr gehen; ich muß Abschied nehmen. Oder geh du allein und wecke sie; ich komme sofort nach ... Peter!« rief er dem Kammerdiener zu, »komm her und nimm die Sachen. Dies hier kommt unter den Sitz, und dies auf die rechte Seite.«
Prinzessin Marja stand auf und ging nach der Tür hin; aber sie blieb noch einmal stehen.
»Andrei, wenn du gläubig wärest, dann hättest du dich im Gebet an Gott gewendet, daß Er dir die Liebe verleihen möge, die du in deinem Herzen nicht empfindest, und dein Gebet wäre erhört worden.«
»Ja, das mag sein!« erwiderte Fürst Andrei. »Geh, Marja, ich komme auch gleich.«
Auf dem Weg nach dem Zimmer seiner Schwester, in der Galerie, die die beiden Teile des Hauses miteinander verband, stieß Fürst Andrei auf die freundlich lächelnde Mademoiselle Bourienne, die ihm schon zum drittenmal an diesem Tag mit ihrem schwärmerischen, kindlich-naiven Lächeln in einsamen Gängen begegnete.
»Ah, ich glaubte, Sie wären in Ihrem Zimmer«, rief sie, wobei sie ohne erkennbaren Grund errötete und die Augen niederschlug.
Fürst Andrei warf ihr einen strengen Blick zu und machte ein zorniges Gesicht. Er sagte kein Wort zu ihr, sondern blickte, ohne ihr in die Augen zu sehen, nur nach ihrer Stirn und ihrem Haar mit einem so verächtlichen Ausdruck, daß die Französin errötete und sich schweigend entfernte. Als er zu dem Zimmer seiner Schwester kam, war die Fürstin schon aufgewacht, und er vernahm durch die offenstehende Tür ihr vergnügtes, mit großer Geschwindigkeit plauderndes Stimmchen. Sie redete und redete, als ob sie nach langer Enthaltung die verlorene Zeit wieder einbringen wolle.
»Nein, stelle dir das nur einmal vor: die alte Gräfin Subowa mit falschen Locken und den Mund voll falscher Zähne, als ob sie sich ihren Jahren zum Trotz jung machen wollte. Hahaha, liebste Marja!«
Genau dieselbe Äußerung über die Gräfin Subowa und dasselbe Lachen hatte Fürst Andrei schon fünfmal in Gegenwart anderer von seiner Frau zu hören bekommen. Er trat leise in das Zimmer. Die Fürstin, mit ihrer vollen Gestalt und den roten Wangen, eine Handarbeit in den Händen, saß in einem Lehnstuhl und redete ohne Unterbrechung, indem sie Petersburger Erinnerungen und sogar Petersburger Phrasen auskramte. Fürst Andrei trat zu ihr, strich ihr mit der Hand über den Kopf und fragte sie, ob sie sich nun von der Reise erholt habe. Sie antwortete ihm und fuhr dann in demselben Gespräch fort.
Die mit sechs Pferden bespannte Kalesche stand vor dem Portal. Es war eine dunkle Herbstnacht; der Kutscher konnte nicht einmal die Deichsel des Wagens sehen. Beim Portal waren Leute mit Laternen in eifriger Tätigkeit. Die großen Fenster des kolossalen Gebäudes waren hell erleuchtet. Im Vorzimmer drängte sich die Dienerschaft, die dem jungen Fürsten Lebewohl sagen wollte; im Saal standen alle Hausgenossen: Michail Iwanowitsch, Mademoiselle Bourienne, Prinzessin Marja und die Fürstin. Fürst Andrei war zu seinem Vater in dessen Arbeitszimmer gerufen worden; denn dieser wollte allein von ihm Abschied nehmen. Alle warteten darauf, daß die beiden in den Saal kommen würden.
Als Fürst Andrei in das Arbeitszimmer kam, saß der alte Fürst am Tisch und schrieb; er hatte seine altväterische Brille aufgesetzt und war in seinem weißen Schlafrock, in dem er niemand empfing als seinen Sohn. Als er ihn eintreten hörte, drehte er sich zu ihm um.
»Fährst du jetzt?« fragte er und schrieb dann wieder weiter.
»Ich bin gekommen, um von Ihnen Abschied zu nehmen.«
»Küsse mich dahin«, er zeigte auf seine Backe. »Ich danke dir, ich danke dir!«
»Wofür danken Sie mir?«
»Dafür, daß du nicht zögerst, in den Krieg zu gehen, dich nicht an einen Weiberrock hängst. Der Dienst muß allem vorgehen. Ich danke dir, ich danke dir!« Er schrieb wieder weiter, und mit solchem Eifer, daß Tintenspritzer von der kreischenden Feder flogen. »Wenn du etwas zu sagen hast, so sprich nur. Ich kann diese beiden Sachen zugleich erledigen«, fügte er hinzu.
»Über meine Frau möchte ich ein Wort sagen ... Es ist mir peinlich, daß ich sie Ihnen zur Last fallen lasse ...«
»Unsinn! Sage einfach, was du wünschst.«
»Wenn die Entbindung meiner Frau herankommt, dann lassen Sie, bitte, einen Arzt aus Moskau kommen ... Ich möchte, daß ein Arzt dabei ist.«
Der alte Fürst hielt mit dem Schreiben inne und heftete, als ob er nicht verstanden hätte, seine strengblickenden Augen auf den Sohn.
»Ich weiß, daß niemand helfen kann, wenn die Natur sich nicht selbst hilft«, fuhr Fürst Andrei, sichtlich verlegen, fort. »Ich gebe zu, daß unter einer Million von Fällen nur einer unglücklich abläuft; aber das ist nun einmal so eine fixe Idee bei ihr und bei mir. Man hat ihr etwas eingeredet, und sie hat etwas geträumt; nun fürchtet sie sich.«
»Hm ... hm«, murmelte der alte Fürst weiterschreibend vor sich hin. »Ich werde es tun.«
Er setzte mit raschem Zug seinen Namen unter das Geschriebene, wendete sich schnell zu dem Sohn um und lachte auf.
»Ein schlimm Ding, he?«
»Was ist schlimm, lieber Vater?«
»Die Frau!« erwiderte der alte Fürst kurz und nachdrücklich.
»Ich verstehe Sie nicht«, antwortete Fürst Andrei.
»Ja, da ist weiter nichts zu machen, lieber Freund«, sagte der Alte. »Sie sind alle von derselben Sorte; sich scheiden lassen kann man nicht. Sei unbesorgt, ich sage es niemandem; und du selbst weißt ja, wie es steht.«
Er ergriff mit seiner knochigen, kleinen Hand die des Sohnes, schüttelte sie, blickte ihm mit seinen lebhaften Augen, die einen Menschen durch und durch zu sehen schienen, gerade ins Gesicht und lachte wieder in seiner kalten Manier.
Der Sohn seufzte und gestand mit diesem Seufzer, daß der Vater seine Lage richtig beurteilt hatte. Der Alte war jetzt damit beschäftigt, seinen Brief zu falten und zu siegeln: mit seiner gewöhnlichen Raschheit ergriff er nach Erfordernis das eine oder andere Stück, Papier, Siegellack, Petschaft, und warf es wieder hin.
»Was ist zu machen? Schön ist sie ja! Ich werde alles ausführen. Du kannst beruhigt sein«, sagte er in abgerissenen Sätzen während des Siegelns.
Andrei schwieg. Es war ihm lieb und auch wieder unlieb, daß der Vater seine Lage durchschaut hatte. Der Alte stand auf und gab dem Sohn den Brief.
»Höre«, sagte er, »um deine Frau mach dir keine Sorgen; was getan werden kann, wird getan werden. Nun höre: diesen Brief gib an Michail Ilarionowitsch Kutusow ab. Ich habe ihm geschrieben, er soll dich für ordentliche Aufgaben verwenden und dich nicht zu lange als Adjutanten behalten; das ist eine garstige Stellung. Sag ihm, daß ich ihn in gutem Andenken habe und ihm zugetan bin. Und schreibe mir, wie er dich aufnimmt. Wenn er sich gut und freundlich gegen dich benimmt, dann diene ihm. Aber um in Gunst zu kommen, darf der Sohn des Fürsten Nikolai Andrejewitsch Bolkonski niemandem dienen. Nun, jetzt komm hierher.«
Er redete mit solcher Schnelligkeit, daß er nicht die Hälfte der Worte vollständig aussprach; aber der Sohn war schon daran gewöhnt, ihn trotzdem zu verstehen. Er führte den Sohn an den Schreibtisch, schlug den Deckel zurück, zog einen Kasten auf und nahm ein Heft heraus, das mit seinen kräftigen, langen, engstehenden Buchstaben vollgeschrieben war.
»Wahrscheinlich werde ich vor dir sterben. Also sieh: da sind meine Memoiren, die übergib nach meinem Tod dem Kaiser. Und nun hier: ein Wertpapier und ein Brief; das ist ein Preis, den ich für denjenigen aussetze, der eine Geschichte der Feldzüge Suworows schreiben wird; das übersende der Akademie. Hier sind gelegentliche Bemerkungen, die ich aufgezeichnet habe; wenn ich tot bin, so lies sie still für dich; du wirst davon Vorteil haben.«
Andrei sagte seinem Vater nicht, daß er doch gewiß noch lange leben werde. Er wußte, daß er dergleichen nicht sagen durfte.
»Ich werde alles ausführen, lieber Vater«, erwiderte er.
»Nun, also dann leb wohl!« Er reichte dem Sohn die Hand zum Kuß und umarmte ihn. »Das eine halte dir gegenwärtig, Fürst Andrei: wenn du im Krieg fällst, so wird das für mich alten Mann ein Schmerz sein ...« Hier schwieg er unerwartet und fuhr dann plötzlich mit schreiender Stimme fort: »Aber wenn ich erfahren sollte, daß du dich nicht so geführt hast, wie es sich für den Sohn Nikolai Bolkonskis geziemt, dann wird das für mich eine Schmach sein!« Die letzten Worte kamen kreischend heraus.
»Das hatten Sie nicht nötig mir zu sagen, lieber Vater«, erwiderte der Sohn lächelnd.
Der Alte schwieg.
»Ich habe an Sie noch eine Bitte«, fuhr Fürst Andrei fort. »Wenn ich fallen sollte und wenn mir ein Sohn geboren wird, dann lassen Sie ihn, bitte, nicht aus Ihrer Hut, wie ich Sie schon gestern bat, damit er bei Ihnen hier aufwächst. Darum bitte ich Sie.«
»Deiner Frau soll er also nicht überlassen werden?« sagte der Alte und lachte.
Schweigend standen sie einander gegenüber. Die lebendigen Augen des alten Fürsten waren gerade auf die Augen des Sohnes gerichtet. Da ging ein Zucken über den unteren Teil des Gesichtes des Vaters.
»Nun haben wir voneinander Abschied genommen ... nun geh!« sagte er plötzlich. »Geh!« schrie er mit lauter, zorniger Stimme und öffnete die Tür des Arbeitszimmers.
»Was ist denn? Was gibt es?« fragten die Fürstin und die Prinzessin, als sie den Fürsten Andrei und die für einen Augenblick zum Vorschein kommende Gestalt des laut und zornig schreienden alten Mannes, im weißen Schlafrock, ohne Perücke und mit der altväterischen Brille, erblickten.
Fürst Andrei seufzte und gab keine Antwort.
»Nun«, sagte er zu seiner Frau gewendet.
Dieses »nun« klang wie kalter Spott, als ob er sagen wollte: »Jetzt mache du deine törichten Mätzchen!«
»Andrei, schon?« sagte die kleine Fürstin, die ganz blaß wurde und voll Angst ihren Mann anblickte.
Er umarmte sie. Sie schrie auf und sank bewußtlos gegen seine Schulter.
Vorsichtig zog er die Schulter, an der sie lag, weg, sah ihr ins Gesicht und setzte sie behutsam auf einen Lehnstuhl.
»Adieu, Marja«, sagte er leise zu seiner Schwester; sie küßten sich, einander gleichzeitig die Hand drückend, und er ging mit schnellen Schritten aus dem Zimmer.
Die Fürstin lag auf dem Lehnstuhl, Mademoiselle Bourienne rieb ihr die Schläfen. Prinzessin Marja stützte ihre Schwägerin, blickte mit den schönen, verweinten Augen immer noch nach der Tür, durch die Fürst Andrei hinausgegangen war, und machte das Zeichen des Kreuzes hinter ihm her. Aus dem Arbeitszimmer hörte man, wie der alte Herr sich mehrmals grimmig und sehr laut schneuzte; es klang fast wie wiederholte Pistolenschüsse. Sobald Fürst Andrei hinausgegangen war, wurde die Tür des Arbeitszimmers schnell geöffnet, und es erschien die Gestalt des strengblickenden Alten im weißen Schlafrock.
»Ist er abgefahren? Nun, dann ist's gut!« sagte er, warf einen ärgerlichen Blick auf die ohnmächtig daliegende kleine Fürstin, schüttelte unzufrieden den Kopf und schlug die Tür wieder zu.