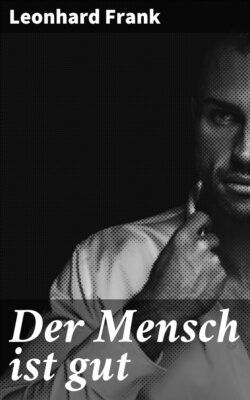Читать книгу Der Mensch ist gut - Leonhard Frank - Страница 4
II.
Die Kriegswitwe
ОглавлениеIhr Mann war Versicherungsagent gewesen, war gefallen, gestorben. Kopfschuß.
„Die Kugel hätte ihn auch in die Brust treffen können, ins Herz, in die Lunge. Die Kugel hätte ebensogut . . . den Magen meines Mannes zerfetzen oder die Wirbelsäule zersplittern können. Der eine stirbt so, der andere so. Das ist ganz gleich. Tot ist tot . . . Oder ein Bajonettstich in seinen Unterleib, daß mein Mann seine Gedärme, die er nie gesehen hatte, noch ein paar Minuten lang hätte betrachten können.“
Unwillkürlich legte die Frau schützend die Hand auf ihren hohen Unterleib: das Kind des toten Vaters bewegte sich.
„Versicherungsagent . . . Er hätte ebensogut irgend ein Handwerker, Kaufmann, Arbeiter, Beamter, Gelehrter sein können, ganz gleich was, die Kugel hätte ihn doch getroffen . . . Sauste auf meinen Mann zu und machte keinen Bogen um ihn herum, machte natürlich keinen Bogen um den armen Versicherungsagenten herum. Die Kugel wählt ja nicht aus. Trifft jeden . . . Ich, eine Versicherungsagentenwitwe, könnte ebensogut eine Beamten- oder Arbeiterwitwe sein. Zwischen mir und allen anderen gibts keinen Unterschied. Ich bin eine Kriegswitwe. Wie alle. Eine Kriegswitwe . . . Und wenn meinen Mann eine Granate so zerfetzt und in die Luft gesprengt hätte, daß nicht ein Teilchen seines Körpers mehr zu finden gewesen wäre? Ganz gleichgiltig! Tot ist tot . . . Mein Schicksal ist das Schicksal von Millionen Frauen. Einen Unterschied gibts gar nicht zwischen mir und allen anderen Frauen . . ., zwischen mir und der Nachbarin, die an der Ecke wohnt und seit drei Wochen auch keinen Mann mehr hat, zwischen mir und den . . . Ja wieviel Frauen sinds denn? Zwei Millionen vielleicht, die in ihrem Zimmer sitzen und, wie ich, an ihren toten Mann denken? Zum Fenster hinaussehen und an ihren toten Mann denken, Staub wischen, Kinder warten, Strümpfe stricken, kochen, auf die Arbeit gehen und an ihren toten Mann denken, an ihren toten Mann denken, toten Mann denken. Sich abends ins Bett legen und an ihren toten Mann denken. Zwei Millionen vielleicht? Zwischen all denen und mir gibt es keinen Unterschied. Unsere Männer sind tot . . . Der Nachbarin ihr Mann ist in einem Lazarett gestorben. Meiner durch Kopfschuß. War sofort tot. Ganz gleichgiltig . . . Kopfschuß! In die Stirn? Vielleicht bei der Nasenwurzel hinein? Oder durchs Auge hinein? Durch sein Auge? Ja aber, was geschah mit seinem Auge? Mit seinem lieben Auge. Mit dem Auge meines lieben Mannes . . . Ist ja ganz gleichgiltig; es ist ganz gleichgiltig, ob das Auge, die Brust, die Lunge, das Gehirn, der Unterleib zerfetzt wird. Tot ist tot . . . Millionen Kriegswitwen sitzen wie ich da und stellen sich vor, wie der Mann eigentlich gestorben sein mag. Es ist aber ganz gleich, wie er den Tod fand. Fand? Sucht man denn den Tod? . . . Und ob er jetzt Schlosser oder Student, Fabrikarbeiter oder Bauer, Gelehrter oder Beamter gewesen wäre, ganz gleich. Das ist ganz gleich . . . Es geht Millionen Frauen so wie mir. Gott sei Dank.“
‚Wieso denn Gott sei Dank?‘
Sie stand schwerfällig auf; die Hand blieb auf die Tischkante gestützt. „Das lindert.“ ‚. . . Was lindert?‘ „. . . Doch, das lindert. Es ist doch ein Unterschied, daß es nicht mir allein, sondern Millionen Frauen so geht. Ein bedeutender Unterschied. Der Unterschied ist sehr groß. Und es lindert. Ich würde es einfach nicht ertragen, wenn es mir allein so ginge. Sich das nur vorzustellen! Könnte ich es denn ertragen? Ich ganz allein! Das wäre unmöglich . . . Es geht Millionen Frauen so wie mir.“
Schon eine Weile hatte sie gedankenversunken in den Spiegel gesehen; jetzt erst bemerkte sie die Miene befriedigter Rachgier in ihrem Gesicht. Und sah ganz plötzlich Millionen Frauengesichter, schmerzbehangen.
„Das läßt einen das Unglück leichter ertragen, ertragen . . . Es geht eben allen so wie mir. Wir müssens ertragen, wir Frauen.“
„Und wenn du einen Menschen leiden siehst, so verdopple sich dein eigener Schmerz“, heißts, glaube ich, in der Bibel. Ganz im Gegenteil. Das lindert. Entweder lügt die Bibel oder wir Kriegswitwen lügen. Alles ist auch nicht wahr, was in der Bibel steht. Wir Kriegswitwen lügen nicht. Wer behauptet, daß wir Kriegswitwen lügen! Wir haben unsere Männer dem Vaterlande geopfert. Auf dem Altare des Vaterlandes geopfert. „Al . . . tar des Vater . . . landes“, schmeckte sie mit der Zunge, sah fernhin, versuchte, sich den Altar des Vaterlandes vorzustellen. Das gelang ihr nicht.
Immer wieder sah sie den Altar, vor dem sie als Mädchen das erste Abendmahl genommen hatte, sah Kerzen und das Christusbild. „Aber Altar des Vaterlandes? Gibts denn das überhaupt?“
Da machte ihr Wesen einen blitzschnellen Sprung zurück zu dem Glauben: „Ich habe meinen Mann auf dem Altare des Vaterlandes geopfert . . ., wie alle andern Kriegswitwen auch.“
„Der Altar steht allerdings nicht in einer Kirche, sondern ist ein mit Elektrizität geladener Stacheldrahtzaun, in dem dein Mann hängen geblieben ist“, versuchte der Schmerz zu flüstern, „also müßte man eigentlich sagen: geopfert im Stacheldrahte des Vaterlandes.“
Es gelang ihr, den noch ganz undurchlittenen Schmerz um den toten Mann wegzuhalten mit den Worten: „Er starb den Heldentod fürs Vaterland.“
Stolz glitt mit diesem Worte in ihr armes Herz hinein.
„Die Befriedigung, daß es Millionen Frauen so geht, und die Worte: ‚Geopfert auf dem Altare des Vaterlandes, Er starb für eine heilige Sache, Er starb für den Sieg unserer Waffen‘, sind Betäubungsmittel gegen den Schmerz um deinen geliebten Mann; aber nicht immer kannst du Betäubungsmittel nehmen; einmal wirken sie nicht mehr“, flüsterte der Schmerz, der empfunden sein wollte und so fest in Worte eingepackt war, daß seine Stimme von der Kriegswitwe nicht gehört wurde.
Die Abzementierung des Gefühls, des Schmerzes war undurchdringlich; so undurchdringlich war die einzementierte Wortplatte — von den noch im dunkelsten Geiste alter Jahrhunderte Stehenden einzementiert in das empfängliche, gedankenlos-gläubige Gehirn des Volkes —, daß der noch undurchlittene Schmerz nicht eine Sekunde lang in ihr Herz vordringen konnte.
Der Gesichtsausdruck der Witwe wurde, da Gefühl und Schmerz nicht fließen konnten, von Tag zu Tag steinerner. Die Tränen wurden nicht vom Herzen geschickt; sie liefen von oben weg.
Und der immer steifer werdende Haß gegen den Feind machte sie im Traume zur Mörderin.
Ein verspäteter Brief des toten Mannes kam an. Der Schmerz setzte sich in den Brief hinein, wollte mit jedem Worte, das die Frau las, ihr ins Herz springen.
Das war abzementiert.
Er erzählte vom Schützengraben, vom Feuer des Feindes, vom Essen. „Ich rauche jetzt viel, das tut gut“, schrieb der tote Mann. „Und wann werde ich dich wiedersehen? Sende mir eine wollene Unterjacke; es ist kalt geworden. Und bleib mir treu.“
Die einzementierte Platte rückte; Schmerz schoß heiß auf. Ganz kurz. Dann saß die Platte wieder fest. Das eine Sekunde lang ungeheuer verändert gewesene Witwengesicht wurde wieder steinern.
In ihrem Kopfe war verwirrender Nebel zurückgeblieben, von dem sich vage der Gedanke loslöste: „Zwei solche wollene Unterleibchen müssen doch noch da sein, Trikotleibchen. Da könnte er immer das eine waschen, wenn er das andere anhat . . . Müssen doch noch da sein.“
Der Schrank öffnete sich. Das Unterleibchen wurde bei den zwei Ärmelenden gefaßt, untersucht. „Nur den Knopf, muß ich annähen.“
Der Schmerz hatte sich im Unterleibchen versteckt; sein Sprung ins Witwenherz wurde vom Nebel in ihrem Gehirn verhindert.
Während sie den Knopf annähte, packte sie in Gedanken das Unterleibchen schon ein, trugs zur Post: es rollte an die Front, wurde vom toten Mann ausgepackt, angezogen.
Da verschwand der Nebel. Und ihr ganzes Wesen flüchtete hinein in das Wort: „Ich habe meinen Mann auf dem Altare des Vaterlandes geopfert, für eine heilige Sache . . ., wie alle andern Frauen auch, wie viele Frauen, wie zwei Millionen Frauen. . . . Es geht mir nicht allein so.“
Sie trug das Leibchen in den Schrank zurück. Da hing eine alte Hose. Bei den Knien war die Hose etwas heller und herausgedrückt, als seien die Kniee des Mannes noch in der Hose.
Sie tippte mit dem Zeigefinger gegen das herausgedrückte Hosenknie, in dem der Schmerz saß, lauernd, sprungbereit.
Und flüchtete, den Blick auf die schaukelnde Hose gerichtet, in die kleine Befriedigung hinein: „Die hätte er doch nicht mehr lange tragen können.“
Automatisch ging sie fort, um Einkäufe zu machen für den Haushalt. „Lange hätte er die nicht mehr tragen können . . . Wenn er zu den Leuten geht, um sie zu überreden, sich versichern zu lassen, und ist nicht gut angezogen, wer läßt sich da von ihm in die Versicherung aufnehmen . . ., wenn er schlecht angezogen ist. Die Leute sind ja gleich so mißtrauisch.“
Sie hatte ein schwarzes Kleid an. Ihr Gesicht war leblos, weiß, das Auge leblos: nicht starr, nicht ruhig, nicht glänzend; es sah tot aus. Die Witwe sah tot aus. Wie ein Gipsabguß. Mechanisch bewegte sich ihr Körper vorwärts, in den Kolonialwarenladen hinein.
„Aber wenn er abends heim kam, und es waren ihm ein paar Abschlüsse gelungen. Wie schön! Die Prozente! . . . Da sind ein paar ganz Hartnäckige. Gott, wie oft war er schon bei denen! Die sind sehr reich; die Versicherung wäre sehr hoch; und wenn ihm der Abschluß gelingt . . . Die Prozente! Wenn er vielleicht jetzt noch einmal hinginge, wer weiß? . . . Er soll doch noch einmal hingehen.“
Der alte, nach Petroleum riechende Kolonialwarenhändler bediente die Kriegswitwe mit besonderer und bedeutsamer Zartheit.
Und ihr stieg schmerzhaft schnell die unabänderliche Tatsache wieder ins Bewußtsein, daß ihr Mann zu den paar Hartnäckigen, die so reich waren, gar nicht mehr gehen konnte, weil er ja nicht mehr lebte.
Ihr Gesichtsausdruck veränderte sich; und der Kolonialwarenhändler, von ihrer Miene zum stärkeren Bezeugen seines Mitleids aufgefordert, zeigte deutlicher, daß er wohl wisse, was es für eine Frau bedeute, den Mann verloren zu haben. Seine gespannte Bereitwilligkeit, wie er ihre Bestellungen entgegennahm, tat ihr wohl. Mit einem leisen Druck legte er die gefüllte Düte vor sie hin, sah ihr, Oberkörper vorgebeugt, ins Auge.
Und die Hausfrau in ihr versuchte, das Zartgefühl des Kolonialwarenhändlers zu benützen: ob sie den Kaffee noch einmal zum alten Preis bekommen könne.
Da hob er die Schultern: das täte ihm leid.
Sofort verschloß sich ihr Gesicht. Und wie ein Grammophon ‚Die Wacht am Rhein‘, spielte ihr wundes Gehirn automatisch: ‚Ich habe meinen Mann auf dem Altare des Vaterlandes geopfert, für die Verteidigung des Vaterlandes, des heimatlichen Herdes hingegeben; er ist auf dem Felde der Ehre gefallen, damit dieser schmutzige Krämer weiter sorglos seine Kaffee verkaufen kann, und mir gibt er ihn nicht zum alten Preis.‘
Der Kolonialwarenhändler hob das Klappbrett des Ladentisches, schlüpfte vor, öffnete höflich die Tür: „Die enormen Einkaufspreise jetzt. Nicht zu sagen.“ Es täte ihm ja wirklich sehr leid, aber da sei nichts zu machen.
Tief beleidigt und scharfen Haß in den Augen, verließ sie den Laden.
Ein Schaufensterspiegel zeigte ihr, daß sie gebeugter ging, als es ihr momentaner Seelenzustand verlangt hätte. Bewußt brachte sie den Gesichtsausdruck in Übereinstimmung mit ihrer Körperhaltung und ging gebeugt und langsam weiter,
vorüber an einem spielenden Kinde, das, seinen mit Ahnung gefüllten Blick zu ihr emporgerichtet, im Halbkreise auswich und ihr nachsah.
Daß sie eine Kriegswitwe war, konnte jeder sehen. Auch die Leute im Trambahnwagen fühlten das sofort, schlossen jedoch die Augen. Denn da war nichts zu machen. Krieg ist Krieg. Und dabei fallen Männer. Alles Mitleid nützt nichts. Mitleid ist hier Schwäche. Außerdem gehts vielen so. Die Kriegswitwe stierte wie ein Mensch, der in seinem Blute liegt. Und alle gehen vorüber. Sie steckten die Gesichter in die noch feuchten Zeitungen, lasen die neueste Siegesnachricht: wieviel Feinde gefangen, wieviel gefallen waren, freuten sich und nahmen sich konzentriert vor: ‚Mich solls nicht packen . . . Aber denen werden wirs zeigen!‘
„Siebentausend!“ las laut ein gutmütig aussehender alter Mann und sah die Kriegswitwe an. „Siebentausend Gefangene! Ungeheuer blutige Verluste! Berge von feindlichen Leichen!“
Gesichter glänzten. Freudenworte sprangen durch den Wagen. Hände flatterten. Befriedigter Haß saß auf den Bänken.
Die bisher tot und blau gewesenen Augen der Agentenwitwe waren schwarz geworden vor befriedigter Rachgier. „Was steht da? Berge von feindlichen Leichen? Berge?“
Da trat, gleich einem Fremden, der unerwartet und unerwünscht in eine geschlossene Gesellschaft eindringt, von der Plattform aus der Kellner in den Türrahmen: „Über was freut ihr euch denn so? Über was? . . . Weil jetzt wieder einige tausend Euresgleichen auf dem Felde der . . . Ehre liegen? Blutig und zerfetzt! Noch atmend oder schon tot! . . . Vielleicht ist auch Ihr Sohn unter den zerstampften Opfern. Und liegt seit der gestrigen Schlacht ohne Hilfe schwer verwundet zwischen Toten und glotzt zu seinem Beine hin, das zwei Meter von ihm entfernt liegt. Glauben Sie denn, daß Ihr Sohn den wahren Grund gekannt hat, der ihn veranlaßte, zum Mörder zu werden, bevor er selbst ermordet wurde?“ fragte er, mühsam seine Erregung bändigend, den gutmütig aussehenden alten Mann,
in dessen Gesicht die Siegesfreude fassungslosem Staunen wich.
Der Zwanzigjährige, der seit dem Tage, da der Kellner in seiner Heimatstadt die Herzen für die Liebe aufgerissen hatte, mit durch das Land und durch die Städte fuhr und, scheinbar ganz unbeteiligt, auf der Plattform stand, machte plötzlich einen schnellen Schritt in den Wagen hinein, auf den Offizier zu, der abweisende Glasaugen bekam: „Steht auf gegen den Krieg. Protestiert! Alle! Alle!“
„Sie sind ruhig jetzt! Hier wird nicht so gesprochen“, sagte der Schaffner.
„Bleibt nicht sitzen in eurer Freude darüber, daß Ochsen und Kälber humaner als Menschen, humaner als eure Männer und Söhne geschlachtet werden.“
Sekundenlang stand das Schreckgespenst der Wahrheit im Wagen.
„Wenn man’s richtig überlegt, sind das natürlich auch Menschen . . . die Feinde“, sagte jemand und wunderte sich, daß er diese Worte gesprochen hatte.
Da wurden alle erlöst vom gutmütigen alten Manne, der sich schon wieder beruhigt hatte: „Ja, Menschen! Warum haben sie uns dann überfallen? . . . Hätten wir uns nicht verteidigen sollen?“
Das Leben kehrte zurück: Köpfe nickten. Augen blickten glänzend und hart. Die Agentenwitwe richtete sich straff auf.
Der Kellner blickte hilflos wie ein Toter.
Der gutmütige Alte stieß mit dem Zeigefinger auf seine Zeitung und rief, hassend und frohlockend: „Unsere Verluste sind ja ganz gering. Hier steht’s ja.“
„Immer heißt es: ‚Unsere Verluste sind gering‘. Wie steht’s dann damit, daß wir bis jetzt schon mehr als zwei Millionen Tote haben? Und wie viele sind, so wie ich, für das ganze Leben ruiniert?“ fragte ein invalider Soldat, in einem Tonfalle, der aus einer anderen Haßquelle kam, und starrte unbekümmert dem Offizier ins Gesicht.
„Berge von feindlichen Leichen!“ wiederholte der Alte und faltete die Zeitung zusammen.
Der Schmerz um den toten Mann war von einem Leichenhaufen zugedeckt. Erregt vom befriedigten Hasse, schritt die Agentenwitwe aus dem Wagen hinaus, die Mundwinkel in die Wangen zurückgezogen, daß die Lippen verschwunden waren und ihr mit Rachgier gefülltes Gesicht voller erschien.
Die Zeit ging hin. Mit Hilfe des Glaubens, daß ihr Mann für eine heilige Sache, für den endlichen Sieg gestorben sei, auf dem Felde der Ehre, und mit der lindernden Tatsache, daß es Millionen Frauen so ging wie ihr, hielt sie den Schmerz auch noch während der nächsten Wochen von sich weg.
Gläubiger schickten Rechnungen, dann Mahnungen, dann Drohbriefe, in denen noch der Satz stand: die Zeiten seien schlecht, jetzt brauche jeder sein Geld; dann kurze Mitteilungen, in denen die Pfändung unverschleiert angekündigt wurde.
Das hatte die Kriegswitwe, deren Mann doch auf dem Felde der Ehre gefallen war, nicht für möglich gehalten. Diese Rücksichtslosigkeit und Ungerechtigkeit übertraf alles, was ihr bisher widerfahren war, übertraf, wenn sie genau überlegte, sogar die Ungerechtigkeit, daß ihr Mann, gerade ihr Mann, der arme Versicherungsagent, der doch, weiß der liebe Gott, schon vor dem Kriege in Not und Krieg gestanden war, in den Krieg hatte ziehen und fallen müssen.
Monatelang trug sie noch das Gefühl und das gepeinigte Gesicht eines unschuldig verfolgten Menschen herum, bis sie, täglich und durch verschiedenerlei Erlebnisse immer wieder daraufgestoßen, einsehen mußte, daß das Leben keine Rücksicht auf ihr Schicksal nahm, das ja schließlich das Schicksal von Millionen Kriegswitwen war, sondern offenbar kraß weiterschritt, ganz unverändert, was die Geld- und Selbstsucht anlangte.
Dieser bitteren Erkenntnis setzte sie anfangs soviel Härte und dunkle Wut entgegen, wie in einem Menschenkörper Platz hat.
Aber das Leben war noch härter und mürbte täglich und mit mörderischer Monotonie weiter, bis die Witwe dieser aussichtslosen Wut müde wurde.
Der noch undurchlittene Schmerz hatte Zeit, konnte warten, bis die Schutzwehren — der Altar des Vaterlandes, das Feld der Ehre und die lindernde Tatsache, daß es zwei Millionen Frauen so erging — ins Nichts zurückstürzten und das Herz der Kriegswitwe bloßgelegt war für den Sprung des Schmerzes, hinein ins Witwenherz.
Und was dem Tage nicht ganz gelang, vollbrachten die Träume. Dem Tage, da ein Bekannter es sich wohl sein ließ bei der Bemerkung: „Liebe Frau, die Zeit lindert jedes Leid“, folgte die Traumnacht, in der der Schmerz erstaunlich deutlich erklärte: „Aber den noch undurchlittenen Schmerz kann die Zeit nicht lindern. Kann Liebe vergehen, bevor sie da war und empfunden worden ist? . . . Erst muß der wahnsinnig singende, mörderische Schmerz empfunden worden sein, ehe die Zeit ihn lindern kann.“
In derselben Nacht träumte die Witwe: der Mann kommt zu spät nach Hause. Sie liegt schon lange im Bett. Sie ist böse, schimpft: „Wo bleibst du denn!“ „Je, je, ich kann mich doch auch einmal ein bißchen unterhalten.“ „So! Und ich?“
Er zieht sich aus (jede seiner Bewegungen ist ihr genau bekannt), legt sich neben sie ins Ehebett. Sie beobachtet alles durch die Wimpern, hört seinen Erleichterungsseufzer und wartet auf des Mannes verlangende Hand, hüstelt, um ihm die Annäherung zu erleichtern, bewegt den Körper, lockt, bis der Mann zu ihr schlüpft.
Alles könnte schön sein, wenn sie nicht plötzlich merkte, daß nicht ihr Mann, sondern ein Fremder sie umfangen will.
„Es erfährts ja niemand“, sagt der Fremde. Und sie denkt: das ist wahr, es erfährts ja niemand. Ist bereit. Und alles wäre in Ordnung, wenn nicht im Rebenzimmer ein Mensch herumginge, der jeden Moment ins Schlafzimmer kommen konnte. Dieser Mensch ist der Schmerz um den toten Mann, hat eine feldgraue Uniform an, das Gewehr quer über dem Rücken.
Jetzt steht er unterm Türrahmen, ist aber nicht mehr der Schmerz in Uniform, sondern der Fremde, während bei ihr im Bett der Schmerz liegt, der zugleich ihr Mann ist.
Sie will ihren Mann zu sich nehmen und kann nicht, weil der im Türrahmen stehende Fremde nicht wegsieht. Und wie der Fremde endlich geht, die Tür hinter sich zuschlägt und die Treppe hinunterpoltert, kann der Mann seine Uniform nicht ausziehen. Und immer ist das Gewehr zwischen ihm und der Frau.
„Das Gewehr könnte losgehen“, sagt sie, „nimm das Gewehr weg.“ Sie will ihm helfen.
Und erwacht. Ruft nach ihrem Manne, horcht. Und tastet das Ehebett ab. „So eine Gemeinheit! Jetzt ist er noch nicht heimgekommen.“ Sie schimpft: „Dieser Lump!“
Der Mann lacht: „Schon seit zwei Stunden liege ich neben dir, und, du hast es nicht bemerkt.“
Sie ist froh, lacht auch. Er zieht sich aus, kommt zu ihr. Und wieder liegt das Gewehr, in dessen Rohrlauf ein Blumenstrauß steckt, hindernd zwischen ihnen. „Nimms doch weg . . . Warte, ich drehe das Licht an.“
Die Hand am Schalter, erwacht sie diesmal wirklich, dreht das Licht an, sucht neben sich im leeren Bett. „Der gemeine Kerl ist noch nicht da.“
Jetzt erst ergreift eine dunkle Faust das Herz. Und wie sie dem Schmerze entfliehen will aus den Worten: „Er ist den Heldentod gestorben“, preßt die Faust das Herz zusammen.
„Wie allen andern Frauen auch, geht es mir“, will sie flüstern. Und ihre Lippen formen diese Buchstaben nicht. Die Begriffe ‚Altar des Vaterlandes, Heldentod, Feld der Ehre‘ zerflattern, sinken ins Nichts zurück vor der entsetzlichen Wirklichkeit, daß der Mann niemals mehr zu ihr kommen kann.
Und wie ein Mensch, der ein auf seiner Handfläche liegendes Brettchen unter die Bohrmaschine hält, schmerzlos das monotone Wühlen des Bohrers fühlt, empfand sie, starren Auges, noch schmerzlos, das rapide, unabänderlich näherkommende Bohren, bis plötzlich der Schmerz das letzte Hindernis durchstoßen hatte und, wie der Bohrer in die Handflüche, hineinsauste ins Herz der noch schlaftrunkenen Kriegswitwe.
Sekündlich und mit der ganzen Kraft ihres Wesens versuchte sie, die Begriffe ‚Heilige Sache, Altar, Feld der Ehre, Heldentod‘ als Betäubungsmittel dem Schmerze wieder entgegenzustemmen.
Es gelang ihr nicht mehr, diese Begriffe wie bisher mit Glauben an sie, mit falscher Empfindung, mit irgend einer Bedeutung zu füllen. Da löste sich auch der Haß gegen den Feind in nichts auf.
Und der Schmerz um den toten Mann war, in den Zeitraum weniger Sekunden zusammengepreßt, ganz plötzlich so unmenschlich furchtbar, daß die Witwe, wollte sie nicht im Augenblick Besinnung und Verstand einbüßen, mit einem gewaltigen innerlichen Sprung von ihrem Leben der Lüge, Gedankenlosigkeit und Selbstsucht heraus — ins höhere Menschentum hineinspringen mußte. Sie hatte das tief entsetzliche Gefühl, die Kraft ihres Wesens reiche nicht aus zum Sprunge, umklammerte, aufrecht im Bette sitzend, mit beiden Händen den Hals, den Wahnsinnsschrei abzuwürgen, der gurgelnd hervorquirlte. Flog aus dem Bett in den Rock hinein. Und raste, halb angekleidet, durch die Straßen. Suchte sich eines Menschen zu entsinnen, der, vom gleichen Seelenschlag zertrümmert, ihren vom Wahnsinn schon bedrohten Zustand begreifen könnte. Und fand keinen in ihrer Welt. Alle trösteten sich selbst und wollten sie trösten mit dem Altare des Vaterlandes, mit dem Felde der Ehre.
Plötzlich sprang aus diesen trostlosen Worten der Kellner heraus und in den Türrahmen der Straßenbahn: ‚Steht auf! Auf! Protestiert! Alle! . . . Glaubt ihr denn, daß eure Söhne, eure Männer den wahren Grund kannten, der sie veranlaßte, Menschen zu morden, bevor sie selbst ermordet wurden? . . . Bleibt nicht sitzen in eurer Freude darüber, daß Ochsen und Kälber humaner als Menschen, humaner als eure Söhne und Männer geschlachtet werden.‘
Dunkel stieg der Protest in ihr auf.
Gegen Abend traf sie im Laden des Kolonialwarenhändlers mit der an der Ecke wohnenden jungen Arbeiterwitwe zusammen, deren Mann im Lazarett verendet war.
Die war in den wenigen Monaten eine alte Frau geworden; ihre Augen, durch das Weinen blutrot und um die Hälfte verkleinert, glichen nicht mehr Menschenaugen, sondern furchtbaren Wunden, die sich tief in die Höhlen hineingefressen hatten. Ihr Mann war erschlagen. Ihre Welt war erschlagen. Sie war erschlagen. Lebte nicht mehr.
Ihrem tödlichen Schicksale unterstellt, lehnte sie zermürbt und verbraucht am Ladentisch.
Und als der Kolonialwarenhändler den Tagesbericht vorlas: „Unsere todesmutigen Helden verteidigten mit bewunderungswürdiger Tapferkeit . . . jeden Handbreit Boden“, bat sie mit dünner Stimme, er möge ihr doch die drei Düten zusammen in eine Düte geben, so sei’s leichter zu tragen.
„Handbreit Boden! Handbreit!“ schrie die Agentenwitwe und erblickte, von Wut und Abscheu in die Vision hochgerissen, ein nur handgroßes Stück Erde, auf dem sich eine ungeheure Pyramide von hunderttausend zerfetzten Siegern und Besiegten erhob.
Der alte Kolonialwarenhändler erschrak, als seinem beifallslüsternen Patriotenblick ein von Mordwut verzerrtes, wildes Frauenantlitz entgegengestellt wurde. Instinktiv flüchtete er in das Wort hinein: „Sie sterben den Heldentod, auf dem Felde der Ehre.“
„Ja, Feld der Ehre! Ihr habt meinen Mann erschlagen. Mein Mann ist tot. Tot!“
„Aber Frau! Und die Heimaterde? Die muß doch schließlich verteidigt werden. Unsere heiligsten Güter stehen auf dem Spiele.“
Die Gedankenfetzen: ‚Güter, heilig . . . Güterschuppen steht auf dem Spiele, Heimat . . . Börsenspiel mit Heimaterde‘, passierten das Witwengehirn. Sie schleuderte die gefüllte Düte zurück. „A was! Heiligste Güter! Mein Mann war mein heiligstes Gut. Er lebte, hatte Augen, verstehen Sie — Augen! Hatte Arme, die er um mich herumlegen konnte, und hatte . . . hatte, hatte, hatte — war mein Mann. Ja, glotzen Sie mich nur an, ist mir gleichgiltig. Was sind denn eigentlich die heiligsten Güter? Wo denn? Ich hab sie nicht. Ich habe keine. Heiligste Güter! Heilig! Nichts als Lüge und Schwindel. Schwindel! Ah . . . ihr Hunde!“
„Aber Frau! Sie machen sich ja unglücklich, werden eingesperrt. Sie werden eingesperrt, das prophezeie ich Ihnen, wenn Sie so über . . . unsere heiligsten Güter sprechen.“
„Ich, eingesperrt?“
Unvermittelt fühlte der Kaufmann die Macht der Kriegswitwe, legte einen geradeliegenden Notizblock gerade.
Alter Schmerz hatte der anderen Kriegswitwe die Brauen hochgezogen, daß die Stirn nur noch aus drei dicken Querfalten bestand. Aus ihren Wunden liefen zwei Tränen heraus, glitten schnell in die Wangenlöcher, in den offenen Mund hinein. Ob sie noch etwas Malzkaffee dazu bekommen könne. Ihre langsame Hand schob das Geldstück hin.
„Wieviel Kaffeemalz? Ah so, es gibt keinen mehr.“
„Einsperren? Das wollen wir sehen, ob die mich auch noch einsperren.“
„Liebe Frau, hier dürfen Sie nicht so reden, hier bei mir . . . Sie müssen sich trösten, müssen sich trösten. Da hilft alles nichts. Vielen geht es so wie Ihnen. Ja, es geht Millionen so.“
„Dann halt adieu, wenn Sie keinen Malzkaffee haben“, sagte die andere Kriegswitwe. Das Tränenwasser lief in den gewohnten Bahnen herunter, schaukelte am Kinn. Die mit den drei kleinen Düten gefüllte große Düte in die konkave Brust hineingepreßt, ging sie langsam hinaus.
„Was gehen mich die andern an. Und wenn es zehn Millionen so geht. Das gibt mir meinen Mann nicht zurück.“ Der Schmerz hockte und hüpfte in ihrem zuckenden Gesicht. „Mein Mann ist fort, tot, weg, kommt nie mehr, nie mehr. Verstehen Sie: nie mehr!“
„Ist ja wahr, aber warum sagen Sie denn mir das alles? Habe ich den Krieg gemacht? Warum sagen Sie mir das alles?“
„Warum?“ fragte sie in ungeheuerem Erstaunen. „Warum kommen Sie mir mit Ihrem Felde der Ehre, mit Ihrem Heldentod, mit Ihren heiligsten Gütern daher? Sie . . . stehen da und verkaufen Ihr Zeug.“
„Wir werden siegen“, sagte der Mann einfach. „Dann ist der Krieg aus.“
Als hatte er ihr eine weißglühende Eisenstange wie eine Längsachse in den Körper gestoßen, bei der Schädeldecke hinein und beim Unterleib heraus, drehte sie sich einmal blitzschnell um sich selbst, herumgeschleudert vom höllischen Schmerze, der ihr Herz gesprengt hatte mit der Vorstellung: der Krieg ist aus, alle Menschen freuen sich grenzenlos . . ., und mein Mann ist tot, kommt nicht zurück. Kommt nie mehr! „Und was wird dann mit mir? He? Sie! He, was wird dann mit mir? He! He!“
„Sagen Sie mal, bin ich denn schuld daran? Sie tun ja gerade, als ob ich . . . Was kann ich dafür.“
Von einem Blitze der Intuition grellweiß erleuchtet, erkannte sie: „Ja, du bist schuld, du, du . . . ihr Hunde! Ihr alle seid schuld daran. Alle!“
Da konnte der Kaufmann nur die Schultern heben, wie er tat, wenn er eine Ware nicht billiger abgeben wollte.
Und als sie schon hinausgerast war auf die verkehrsreiche Straße, sprach er noch: „Sie werden todsicher eingesperrt. Sie sperrt man ja glatt ein.“ Sah die Banknote liegen. „Und ihr Geld vergißt sie auch noch. Die scheint endgiltig närrisch zu sein . . . Was wünschen Sie?“
Die Kundin wünschte Petroleum, stellte die Kanne auf den Ladentisch.
„Na, jetzt das ist mir aber eine“, begann er und erzählte der neuen Kundin die ganze Sache. „. . . Was sagen Sie dazu?“
„Recht hat sie“, erklärte die Frau mürrisch. „Was haben denn wir davon, wenn die Land erobern. Wir haben nichts davon.“
„Ist Ihr Mann auch im Krieg?“
„Schon tot ist er, wenn Sie’s wissen wollen.“
„Er starb für unsere gerechte Sache, Frau, müssen Sie sich sagen.“
„Ja, Sache“, sagte die Frau, dumpf wie ein Hund, der verhalten knurrt. Dann sagte sie noch, was sie jedem sagte: „Sie haben seinen Kopf nicht gefunden. Nur das Andere. Die Erkennungsmarke war weg; deshalb wollten sie mir erst keine Unterstützung geben.“
„Aber jetzt bekommen Sie doch, wie?“
„Meine zwei Söhne sind auch schon verreckt. Im Westen.“
„Jetzt bekommen Sie doch?“
„Ich pfeif darauf. Verdiene mir selbst mein Geld. Will nichts haben von diesen . . .“
Der vorsichtige Kolonialwarenhändler schnitt das Gespräch ab; denn neue Kunden waren eingetreten. „Nun, was sollst du holen?“
Das Kind streckte sich, legte das in Papier eingewickelte Geld auf den Ladentisch.
„Da vorne auf dem Platz ist eine Menschenansammlung. Jemand spricht gegen den Krieg“, erzählte ein grauer Alter, der Zigarren verlangte. „Und plötzlich kommt eine Frau gesprungen. Ganz außer sich. Die schreit und schimpft nicht schlecht . . . Was will der Schutzmann machen: — es ist eine Kriegswitwe.“
„So, schreit sie? Die wird natürlich eingelocht . . ., wenn sie solche Sachen daherredet.“
„Nun, so ohne weiteres kann man eine, die ihren Mann im Kriege verloren hat, auch nicht einsperren . . . Wenn sie doch ihren Mann verloren hat. Das ist keine Kleinigkeit.“
„Aber das Vaterland ist doch schließlich auch keine Kleinigkeit. Und . . . unsere Kultur, was?“
Während der Alte seine Zigarre anzündete: „Schon recht, gewiß . . . Vaterland . . . gewiß . . ., aber wenn eine ihren Mann . . .“
„Na ja, da haben Sie auch wieder recht.“
„. . . verloren hat, kann sie schon rabiat werden. Das ist zu verstehen . . . Es ist ein Riesenmenschenauflauf. Dreitausend Menschen, schätze ich. Können auch viertausend sein. Die Frauen schreien . . . Gerade als ob sie am Kreuz hingen, als ob jede an einem Kreuz hinge. Der Redner kann nicht mehr weitersprechen . . . Ich bin weggegangen. Will nichts zu tun haben mit so was. Bin ein alter Mann.“ Übrigens habe er sich schon lange gewundert, daß bis jetzt nicht mehr Kriegswitwen . . .
„Ja, es ist schon am besten, man kümmert sich nicht darum.“
Auch manche von den Männern, die um die schreiende Agentenwitwe, um den verstummten Kellner herumstanden, dachten das. Die Frauen dachten das nicht; es waren viele Kriegswitwen darunter und Mütter, die ihre Söhne verloren hatten.
Der Schutzmann sagte: „Schreien Sie jetzt nicht mehr.“
Die Agentenwitwe schrie: „Ich schreie!“
Ein Bürger dachte: man kann’s ihr nicht verdenken. Und ging nach Hause.
Die Trambahnwagen konnten nicht weiterfahren. Droschkenkutscher standen auf den Böcken, Fahrgäste streckten die Oberkörper, schief wie gotische Gestalten, aus den Wagenfenstern heraus. Die Menge vergrößerte sich rapid. Auch die Seitengassen, die zum Platze führten, waren schon schwarz von Menschen.
Der Schutzmann faßte die Kriegswitwe am Arme: „Gehen Sie jetzt heim.“
„Loslassen! Loslassen!“
„Heim? Habe ich denn ein Heim?“ Ihr Lachen war Tiergebrüll, riß Hohngelächter aus tausend Frauenmündern heraus. Sie hatte sich mit einem kurzen Ruck losgemacht von der Schutzmannsfaust.
Ein Frauengesicht, höhnisch und gefährlich, schoß dem Schutzmann vor die Augen: „Gehen Sie einmal nach Hause in ein Heim, in dem niemand mehr ist.“
„Auseinander jetzt!“ rief der Schutzmann. „Macht euch nicht unglücklich.“
Das war für alle Kriegswitwen zum Lachen.
„Bin schon unglücklich. Mehr kann ichs nicht werden“, schrie die Agentenwitwe, immer mit dem gleichen schmerzdurchtobten Tiergebrüll.
Dieselbe Gefühlswelle bewegte gleichzeitig alle Witwenleiber. Und alle Münder schrien dem Schutzmann und einander zu: „Wir sind schon unglücklich. Unglücklich!“
Die Macht der Frauen war sehr groß.
Der Schutzmann sah plötzlich wie ein hilfloses Kind aus.
Da krachte ein Schuß. Knapp neben dem Zwanzigjährigen.
Menschenohren horchten, daß es nachtstill wurde. Dann stieg der tausendfache, wilde und ganz wortlose Schrei. Das klang in der Ferne wie Kirchengesang.
Johlen. Gebrülle. Die Menge war ein einziger, langsam bewegter Riesenkörper geworden. Der Schuß hatte die Gemüter von Zwang und Ordnung entbunden und in anarchische Freiheit hineingestellt.
Der Schutzmann drückte sich, seitwärts gedreht, durch die drohend enge Menschengasse durch und verschwand.
Jetzt erst bemerkten der Zwanzigjährige und die Nächststehenden, daß nicht ein Schuß gefallen, sondern ein Automobilschlauch geplatzt war.
Die Agentenwitwe machte mit den Händen ganz kleine, gebundene Bewegungen, die mit den Zuckungen ihres Gesichtes korrespondierten, und bemühte sich, den andern zu erklären, wie qualvoll es sei, wenn ihr ein alter Anzug, ein Trikotleibchen, eine gebrauchte Hose des toten Mannes vor die Augen komme. „Ich sehe den Stuhl an, auf dem sonst mein Mann gesessen war, sehe den Stuhl an . . . Und wenn ich unsern Sekretär ansehe, vor dem oft mein Mann gestanden war, ist das gar kein Sekretär mehr . . .“
Alle sahen in der Zimmerecke den lackierten Muschel-Sekretär stehen, der die unabänderlich sich gleich bleibende Einsamkeit war und jede aufkeimende Hoffnung erschlug. Qualvolle Hilflosigkeit strich lautlos über die Menschengesichter und erzeugte bei allen den toten Blick.
Da griff der Kellner auf den Grund der Sehnsucht und rief: „Wir wollen Frieden machen!“
Sofort öffneten sich die Menschengesichter; eine Wolke heißen Gefühles ballte sich zusammen und platzte: das Wort ‚Friede‘ donnerte hoch, umdonnerte minutenlang den Kellner, der auf einem leeren Lastwagen stand und sich unter tiefer Qual den Entschluß abrang, in die plötzlich entstehende, offene, fruchtbare Stille die kalte Wahrheit hineinzustoßen:
„Aber wir können nur dann helfen, Frieden zu machen, wenn wir wissen und zugeben, daß auch wir den Krieg mitverschuldet haben.“
„Was sagt der? Was?“ Die Agentenwitwe war vor Empörung und Staunen gelähmt.
„Nur wer denkt und die Menschen liebt, kann ihnen den Frieden bringen . . . Wir denken nicht und lieben nur uns selbst.“
Die Gesichter veränderten, verschlossen sich; eine leere Fläche entstand zwischen der Menge und dem Kellner.
Der sagte: „Schon vor dem Kriege war die Liebe tot in uns. Wir waren gedankenlose, meinungslose Maschinen. Deshalb hat jeder Einzelne von uns den Krieg mitverschuldet.“
„Krieg mitverschuldet? Wir haben den Krieg nicht gewollt. Das Volk nicht! . . . Wir nicht!“ Eine Welle des Zornes bewegte die Menge.
„Laßt euch das sagen. Das müßt ihr euch sagen lassen. Wir müssen erst umkehren zur Wahrheit: wir hatten das Gute — die Liebe — vergessen; wir hatten uns gar nicht überlegt, was gut ist; wir haben überhaupt nichts überlegt, überhaupt nicht gedacht und Zeit unseres Lebens das Böse wachsen lassen, bis es uns zur Gewohnheit geworden war, und wir mit entsetzlicher Selbstverständlichkeit glaubten, daß das Böse — Egoismus, Gewalt, Macht, Erfolg, Geld und Autorität — das Erstrebenswerteste im menschlichen Dasein sei. Und dieses zur Selbstverständlichkeit gewordene, kalte, mörderische Prinzip jeden Europäers, den Mitmenschen übervorteilen zu wollen, mußte die Menschen dazu führen, daß sie am Ende einander erschlagen . . . Dann wird von Ehre, Heldenmut, Heldentod, von einem Felde der Ehre gesprochen.“
Da flog, die Zustimmungsrufe auseinanderschneidend, die Agentenwitwe durch die vor ihren geballten Händen entstehende Menschengasse durch, bis zum Wagen. Ihr Schmerz hatte sich gegen den ersten gedreht, der anderer Meinung war als sie. „Krieg mitverschuldet? Wir? Mein Mann? Mein Mann wollte nur leben“, schrie sie fassungslos. Kletterte hinauf. Wurde heruntergezogen. Kletterte wieder halb hinauf. Erleben, das keinen Widerstand mehr fand, durchströmte und befreite sie.
Noch bevor sie vom Wagen wieder losgerissen werden konnte, beugte sich der Kellner herab und berührte mit seiner Hand sanft ihren zerrauften Scheitel.
„Red du nicht so weiter“, drohte ein Arbeiter.
Johlende, halbwüchsige Burschen, zum Kriege noch nicht tauglich, klebten auf den Mauervorsprüngen.
„Wir alle haben rücksichtslos nach nichts anderem gestrebt, als so viel Erfolg wie nur möglich zu haben, unbekümmert, daß wir dadurch das Bild unserer Seele zerstörten, unbekümmert, ob dadurch ein Mitmensch ins Leid und in das Elend sank. Wie ich, habt auch ihr die erfolgreichsten Gewalttätigen, die am meisten Macht, Besitz und Autorität auf sich vereinigen, gedankenlos als Autoritäten anerkannt und bewundert . . . Wir alle waren stolz, wenn unsere schlecht beratenen Kinder patriotische Kampf- und Mordlieder sangen. Und als die mächtigen Autoritäten die Truppen marschieren ließen, jubelten wir und waren begeistert. Wir jubelten, als die ersten Siegesnachrichten einliefen. Wir jubelten. Und kümmerten uns nicht darum, daß beim Erstürmen einer Festung fünfzigtausend Menschen zerrissen werden. Zerrissen werden mußten, damit durch diesen ungeheuer verbrecherischen Gewaltakt die Erfolgreichsten noch mehr Macht, die Besitzenden noch mehr Besitz bekommen können. Wir kümmerten uns nicht darum, weil wir selbst nichts anderes als das Verlangen nach Erfolg, Besitz und Macht in uns trugen. Und dieses Verlangen logen wir um in Patriotismus. Wir müssen den Frieden bringen. Wir haben den Krieg mitverschuldet. Wir sind Mörder. Wir müssen uns entsündigen.“
Gefährliches Murren wuchs an, verdichtete sich zu einzelnen Zornrufen, die sich schnell aneinanderreihten, bis zuletzt ein einziger langer Schrei, so dick wie der Platz, zum Himmel stieg.