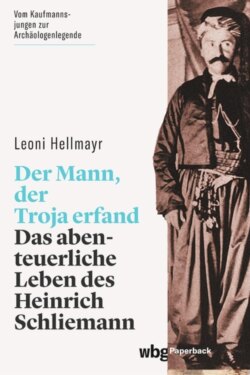Читать книгу Der Mann, der Troja erfand - Leoni Hellmayr - Страница 9
Metamorphose
ОглавлениеEs ist der 28. November 1841, als die Dorothea zu ihrer Jungfernfahrt vom Hamburger Hafen ablegt. Über der Stadt liegt die friedliche Stille und Finsternis des frühen Wintermorgens. Eigentlich hätte das Segelschiff zu diesem Zeitpunkt längst auf dem Atlantik in Richtung Venezuela fahren sollen, doch wegen des fehlenden Windes hatte sich die Abfahrt um mehrere Tage verzögert. Nun ist es so weit: Zur Freude des Kapitäns bläht bereits in der Nacht zuvor eine kräftige Brise die Segel der Brigg auf, sodass die Reise endlich beginnen kann. Als die Leinen losgemacht werden und die Dorothea sich zügig von der Hafenkante entfernt, hat sie dreizehn Besatzungsmitglieder sowie drei Passagiere an Bord. Zu Letzteren gehört ein junger Mann. Dass er in weniger als zwei Monaten bereits seinen zwanzigsten Geburtstag feiern würde, vermutet man auf den ersten Blick nicht – zu klein scheint er und von zu schmächtiger, fast kindhafter Statur. Seine Haut ist von einer kränklichen Blässe gezeichnet, als wäre auf sie viele Wochen lang kein Sonnenlicht mehr gefallen. Der junge Mann heißt Heinrich Schliemann, und mit der Dorothea will er in eine unbekannte Zukunft fernab der Heimat aufbrechen, von der er sich Abenteuer und Glück erhofft.
Das Gepäck des jungen Mannes ist übersichtlich. Es besteht aus nicht viel mehr als einer Seegrasmatratze, zwei Wolldecken und – das wohl Kostbarste – mehreren Empfehlungsschreiben, die ihm helfen sollen, in Südamerika eine Beschäftigung zu finden.
Bereits am zweiten Tag – die Brigg hat über die Elbe mittlerweile das offene Meer erreicht und fährt auf der Höhe von Helgoland – zieht ein Sturm auf. Das Wanken des Schiffes wird in den kommenden Stunden immer stärker und das dumpfe Aufschlagen der Wellen an den Schiffswänden immer durchdringender. Schliemann ist nicht der Einzige, der unter Seekrankheit leidet und seinen Schlafplatz am liebsten gar nicht mehr verlassen würde. Am zehnten Tag hat sich der Sturm zu einem Orkan entwickelt, dessen Kräfte eine gefährliche Dynamik im Meer erzeugen. Die Wellen reißen die Dorothea mal hoch in den Himmel, dann wieder tief in den Abgrund, wo das Wasser sie von allen Seiten endgültig zu verschlingen droht. Um Mitternacht ruft der Kapitän alle an Deck; dort müssen Schliemann und seine Mitreisenden von nun an ausharren. Irgendwann glaubt Schliemann, möglichst weit oben in den Masten am sichersten zu sein. Als er eben im Begriff ist, hinaufzuklettern, kann das Schiff dem Sturm nicht mehr standhalten – mit einem ohrenbetäubenden Krachen zerbricht es und sinkt. Schliemann verliert den Halt und fällt tief ins eisige Wasser. Mit den letzten Kräften schwimmt er zurück an die Oberfläche. Neben ihm schaukelt eine leere Tonne, die er nach mehreren Anläufen endlich zu fassen kriegt. Seine Hände klammern sich an dem nassen, rutschigen Holz fest. Von der Kälte völlig verkrampft lassen sie auch dann nicht die Tonne los, als ihn die Erschöpfung immer wieder besinnungslos werden lässt. Stundenlang treibt er auf dem Meer, bis er schließlich auf einer Sandbank liegen bleibt. Als Schliemann wieder zu sich kommt, glaubt er, entfernte Stimmen zu hören. Zaghaft öffnet er seine vom Salzwasser brennenden Augen und entdeckt tatsächlich Menschen, von hier aus gesehen kaum größer als Ameisen, die an einem Strand stehen und in seine Richtung zu gestikulieren scheinen. Die Bewohner der holländischen Insel Texel schicken ein Boot mit mehreren Männern hinaus zur Sandbank. Schliemann ist gerettet.
*
Der Schiffbruch und das wundersame Überleben eines äußerlich so unscheinbaren Passagiers – diese Erzählung soll der Auftakt zu Heinrich Schliemanns Lebensbeschreibung sein. Schliemanns Weg wirkt auf der einen Seite eigentümlich, denn bis zu seinem Lebensende fällte er viele Entscheidungen, die teils bizarr anmuten, und ertrug auch viele Schicksalsschläge, von denen manche uns unvorstellbar erscheinen. Auf der anderen Seite treffen wir in Schliemanns Leben ständig auf Bedingungen, Situationen und Wendepunkte, die wir in vielen Biografien seiner Zeitgenossen in ganz ähnlicher Form wiederentdecken und die somit – im großen Kontext betrachtet – an ihrer ursprünglichen Außergewöhnlichkeit deutlich verlieren.
Nur wenige Wochen nach dem traumatischen Ereignis auf See schreibt Schliemann einen vierundsechzigseitigen Brief an seine Schwestern, in dem er schildert, was ihm alles widerfahren ist, seit er seine Heimat Mecklenburg verlassen hat. Natürlich berichtet er ihnen auch von dem Schiffsunglück, alles der »reinsten Wahrheit gemäß«. Sein glückliches Überleben lässt ihn darauf schließen, »dass das Schicksal, was mich so wunderbar gerettet und nach Holland geführt, mir auch hier mein gutes Fortkommen schenken würde …«
Schliemann hat noch mehrmals in seinem Leben den Schiffbruch beschrieben, auch in seiner Selbstbiografie, die rund vierzig Jahre nach dem Ereignis erschien. Während sich hier wie auch bereits in dem Brief an seine Schwestern zeigt, mit welchem Talent er es schaffte, seine Darstellungen präzise, lebendig und eindrucksvoll zugleich zu schildern, nimmt er es mit den Details nicht ganz so genau, ob nun bei solch banalen Angaben wie der Anzahl der an Bord anwesenden Menschen oder der Art des Rettungsmittels. Je nachdem, in welchem Dokument man liest, wird aus der Tonne ein Boot und aus den drei Überlebenden werden vierzehn. Oder es kommen über die Jahrzehnte hinweg dramatische Zugaben hinzu, so zum Beispiel der kleine Koffer Schliemanns, der als einzige Habseligkeit der gesamten Schiffsfracht auf dem Meere schwimmend gefunden wurde und die so wichtigen Empfehlungsschreiben mit sich trug. Schliemann erkannte offenbar sehr früh die Kraft eines Mythos und dessen Tragweite. Die Legende aus seinen jungen Jahren weist auf die Anfänge einer widersinnigen Eigenheit Schliemanns, einer Art von Paradoxie. Denn während er im Laufe des Lebens seine Bestimmung darin fand, die Realität eines der weltbekanntesten Mythen aufzuspüren, ließ er zugleich sein eigenes Leben immer mehr hinter einer selbst geschaffenen Legende verschwinden. Denn wohl nichts wünschte sich Schliemann so sehr, wie seinem Leben von Kindheit an einen Sinn zu verleihen.
*
Am Strand von Texel wartet die kleine Menschengruppe neugierig auf das Boot, das mittlerweile den Gestrandeten von der Sandbank aufgelesen hat und sich auf dem Rückweg befindet. Schliemann verliert zwischendurch erneut das Bewusstsein. Weder bekommt er mit, wie die Strandgänger ihn weg von der Küste in ein nahe gelegenes Haus tragen, noch, wie sie ihn dort behutsam auf eine Sitzbank legen. Erst, als ihn der Wirt des Hauses ein wenig aus der Liegeposition aufrichtet und ihm heißen Kaffee einflößt, gibt Schliemann zum Schrecken aller Anwesenden einen plötzlichen, markerschütternden Schrei von sich. Mit aufgerissenen Augen tastet er vorsichtig seine Zähne ab. Zwei Vorderzähne sind abgebrochen. Stöhnend vor Schmerz betrachtet er nun seinen ganzen Körper. Er ist übersät von Prellungen und Schnitten, die Füße sind dick angeschwollen. Als sich Schliemann von diesem ernüchternden Anblick wieder erschöpft zurücklehnt, fängt der Wirt an, die Wunden zu versorgen. Schliemann tut in diesem Augenblick sogar das Denken weh, trotzdem reicht seine geistige Verfassung aus, um eines ganz sicher zu wissen: Die Reise ist nicht abgebrochen, nur unterbrochen. Lediglich das ursprünglich angestrebte Ziel sollte er noch einmal überdenken.
Einige Tage später ist Schliemann wieder so weit zu Kräften gekommen, um Texel verlassen zu können. Der Wirt hat ihn nicht nur gesund gepflegt und mit Essen aufgepäppelt, sondern ihm auch einen weiteren wertvollen Dienst erwiesen: Schliemann durfte ihm einen Brief an den Schiffsmakler Wendt aus Hamburg diktieren, der ihn überhaupt erst auf die Reise nach Südamerika gebracht hatte. In mehr als dürftiger Kleidung, mit wenigen Almosen in der Tasche und allein in der Hoffnung, von seinem einstigen Gönner bald zu hören und erneut Unterstützung zu erfahren, geht Schliemann an Bord eines Schiffes, das am 20. Dezember in Amsterdam anlegt.
Schliemann nimmt sich, als er das Festland betritt, für seinen ersten Eindruck von der Stadt kaum Zeit; zu eilig hat er es, vom Hafen wegzukommen. Mehrere Stiefelputzer, die die Passagiere des Schiffes in Empfang nehmen, lassen Schliemanns Schritte noch schneller werden: In der zerrissenen Jacke und den alten Klumpschuhen, die der Wirt ihm überlassen hatte, halten sie den heruntergekommenen Mann für einen Konkurrenten und pöbeln ihn von der Seite an. Auch wenn Schliemann ihre Sprache nicht versteht, kann er sich zusammenreimen, dass sie ihn alles andere als willkommen heißen. Eines seiner ersten Ziele ist ein imposantes Haus an der Amstel, in dem Herr Quack, der Konsul von Mecklenburg, lebt. Von diesem erhält er als Starthilfe zehn Gulden, die zusammen mit den Almosen von Texel zur Bezahlung seines ersten Quartiers, für ein paar gebrauchte Kleider und einige Mahlzeiten ausreichen. Die Folgen des Schiffbruchs, der kaum zwei Wochen zurückliegt, sitzen Schliemann tief in den Knochen. Von den wenigen Bewegungen am Tag fällt er am Abend völlig erschlagen ins Bett. Trotzdem findet er keinen tiefen Schlaf. Immer wieder wacht er auf, weiß vor lauter Verwirrung nicht mehr, wo er sich befindet. Fieber kommt hinzu, so stark, dass er wieder das Bewusstsein verliert. Eines Morgens wird er von dem Geruch ungewaschener Kleidung und quälenden Jammerlauten geweckt – die Wirtsleute haben ihn in ein Armenkrankenhaus bringen lassen, und nun liegt er hier, mit dröhnendem Kopf und starken Zahnschmerzen, in einem Zimmer voller kranker Menschen, deren Sprache er nicht spricht, deren Schreie er aber auch ohne Kommunikation versteht. Das also ist Schliemanns erstes Weihnachtsfest fern von Mecklenburg.
Im Pfarrhaus von Ankershagen verbrachte Heinrich Schliemann seine Kindheit.
*
»Heimat, ursprünglich der Ort, an welchem man sein Haus (Heim) hat, an
welchem man wohnt, entspricht also genau dem lateinischen domicilium.«
(Brockhaus, 1902)
Es ist sicherlich kein Zufall, dass ein Begriff erstmals richtig wahrgenommen wurde, als dieser seine jahrhundertealte Selbstverständlichkeit zu verlieren begann. So ist es mit allen Dingen, die den Raum eines Individuums füllen, ob materiell oder immateriell: die innige Beziehung zu einem Menschen, das schützende Dach, die tägliche warme Mahlzeit.
Als im 19. Jahrhundert Massen von Menschen – innerhalb von hundert Jahren werden es mehr als achtzig Millionen gewesen sein – begannen, freiwillig in die Ferne abzuwandern, fragte man sich also, was es eigentlich genau war, das sie für ihre Entscheidung zu opfern bereit waren. Sie ließen ihre Heimat zurück, den Ort, in den sie hineingeboren wurden, wo sie die ersten Kontakte zu anderen Menschen erfuhren, wo sie ihre Kindheit oder zumindest einen Teil davon verbracht hatten. Und die Erfahrungen der Kindheit, das wissen wir heute, können Identität, Charakter, Weltauffassungen entscheidend prägen.
*
Mit gerade einmal neunzehn Jahren fasste Schliemann den Entschluss, seine Heimat zu verlassen. Die Geschichten von den Schicksalen anderer Auswanderer dürften bei den Mecklenburgern bereits bekannt gewesen sein. Weil die Segelschiffe, eigentlich Frachtfahrzeuge, nicht für den Transport von Menschen konzipiert worden waren, lebten die Passagiere wochenlang dicht gedrängt in den stickigen, dunklen Zwischendecks. Sie mussten desaströse hygienische Zustände ertragen und genügend eigene Lebensmittel dabeihaben. Zu wenig Verpflegung wurde vor allem dann gefährlich, wenn die Überfahrt länger dauerte als erwartet. Eine Überseefahrt nach Amerika zu überleben, war alles andere als wahrscheinlich.
Schliemann wird das gewusst haben, als er in Hamburg von einem Schiffsmakler mit dem Angebot konfrontiert wurde, ihm bei einer Arbeitsstelle in Venezuela behilflich sein zu können. Trotzdem sagte er ohne Zögern zu. Statt sich die Gefahren auf offener See vorzustellen, spielten sich in seinem Kopf Schiffs- und Reisefantasien ab, wie er später seinen Schwestern schrieb. Anscheinend träumte er schon seit Jahren davon, woanders ein Leben zu beginnen. Die Abenteuerlust, vielleicht zu diesem Zeitpunkt noch aus einem jugendlichen Leichtsinn heraus geboren, war aber längst nicht der einzige Grund hierfür. Der Blick in Schliemanns Vergangenheit zeigt, dass er nicht viel zu verlieren hatte und deshalb die Flucht nach vorne wagte.
*
»In diesem Dorfe verbrachte ich die acht folgenden Jahre meines Lebens,
und die in meiner Natur begründete Neigung für alles Geheimnisvolle
und Wunderbare wurde durch die Wunder, welche jener Ort enthielt,
zu einer wahren Leidenschaft entflammt.«
(Schliemann, Aus dem Vorwort von Ilios)
Der Weg zu jenem wundersamen, kleinen Dorf namens Ankershagen führt vorbei an sanft geschwungenen Hügeln, Seen und Wiesen, auf denen Kraniche und Störche rasten, vorbei an endlosen Rapsfeldern, die je nach Jahreszeit die einfache Landschaft in sattes Gelb tauchen. Das Erste, worauf der Blick des Besuchers nach dem Ortseingang fällt, ist eine breite Feldsteinkirche, rund achthundert Jahre alt. In einer etwas größeren Siedlung oder umgeben von einer anderen Landschaft würde sie möglicherweise wenig auffallen. Doch dieses Dorf und die weite, stille Umgebung verleihen ihr einen sonderbaren, markanten Charakter. Als würde sie bereits einen Hinweis darauf geben, dass in Ankershagen die Vergangenheit die Gegenwart überwiegt.
Heinrich Schliemann war kaum ein Jahr alt, als sein Vater Ernst Schliemann die Pfarrstelle von Ankershagen übernahm. Der Pastor und seine Frau Luise zogen mit ihren Kindern von Neubukow in das Pfarrhaus direkt gegenüber der Feldsteinkirche.
Wenn Heinrich aus dem Fenster seines Kinderzimmers blickte, konnte er in den Pfarrgarten sehen, bis hinüber zu einem kleinen Teich, der unmittelbar hinter dem Grundstück lag. Schon bald kannte er die Legende vom »Silberschälchen«. Und so stellte er sich spät nachts, wenn er nicht schlafen konnte, gerne vor, wie draußen eine Jungfrau mit einer Silberschale in den Händen aus dem Wasser steigt. Mit seiner Freundin, einem gleichaltrigen Mädchen namens Minna Meincke, die im Nachbardorf lebte, unternahm er nach der Schule ausgiebige Erkundungen der Umgebung. Immer waren die beiden Kinder auf der Suche nach Orten, zu denen vor allem die älteren Dorfbewohner viele unheimliche Geschichten zu erzählen wussten. Dazu mussten sie nicht unbedingt weit laufen – bereits die Gräber auf dem Friedhof um die Feldsteinkirche und die Toten, die dort lagen, sorgten für Nervenkitzel. Besonders gruselten sich Heinrich und Minna vor dem begrabenen Raubritter, dessen Bein angeblich früher jede Nacht aus dem Grab gewachsen war. Der Totengräber, der in den beiden Kindern zwei aufmerksame und stets wiederkehrende Zuhörer gefunden hatte, beschwor, dass er in einer Nacht, als er selbst noch klein gewesen war, das Bein abgeschnitten und damit Birnen von einem Baum geschlagen hätte. Heinrich bat daraufhin seinen Vater immer wieder darum, das Grab öffnen zu lassen, um endlich die Ursache dafür zu finden, weshalb das Bein mittlerweile nicht mehr an die Oberfläche wachsen wollte.
Manchmal durchstreiften die Kinder die Ruinen der nahe gelegenen Burg, wo der Raubritter mit dem unsterblichen Bein einst gelebt haben soll. Sie kletterten auf den zwei Meter dicken Mauern oder suchten nach unterirdischen Geheimgängen. An anderen Tagen gingen sie zu einer prähistorischen Stätte in der Nähe des Dorfes, einem Hünengrab. Der Legende zufolge war darin ein Kind in einer Wiege aus Gold bestattet worden. Heinrich verstand nicht, warum sein Vater in finanziellen Notzeiten nicht einfach die Wiege aus dem Grab schaufelte, um seine Geldsorgen ein für alle Mal zu lösen.
Heinrich behielt diese Abenteuer bis ins hohe Alter in schöner, fast romantischer Erinnerung, und in Minna hatte er eine Freundin gefunden, die die Begeisterung für seine absonderlichen Freizeitaktivitäten teilte. Als sie in einem Winter gemeinsame Tanzstunden nahmen, machten die beiden Kinder im Anschluss oftmals noch einen Spaziergang über den Friedhof oder lasen in den Kirchenbüchern; am liebsten durchforsteten sie alte Geburts-, Ehe- und Todeslisten. Heinrich war nach solchen Nachmittagen ganz beseelt von Abenteuer und Nervenkitzel. Spätestens aber, wenn er für das Abendbrot mit flinken Schritten zu seiner Familie zurückkehrte, kräftig an der Türklinke des Pfarrhauses zog, in den dunklen Eingang trat und die Holzdielen unter seinen Schuhen zu knarzen begannen, schienen die wunderbaren Erlebnisse des Tages in weite Ferne gerückt zu sein. Wenn die schwere Holztür krachend hinter ihm ins Schloss fiel, holte Heinrich die Realität endgültig ein.
*
Es erfordert viel psychologisches Feingefühl, ein gesundes Maß an Empathie und ebenso viel professionelle Distanz für den Versuch, die Erlebnisse und Folgen der Kindheit einer fremden Person nachzuzeichnen. Die Kindheit ist, gerade weil der Mensch zu diesem Zeitpunkt noch kein selbstständiger Teil der Gesellschaft ist, eine Phase, die zu einem wesentlichen Teil hinter verschlossenen Türen stattfindet. Die Zeugen sind in der Mehrheit Menschen, die dem Kind sehr nahestehen, somit aber auch befangen sind; andere Quellen stehen kaum zur Verfügung. Es wird nicht einfacher, wenn es um die Kindheit eines Mannes geht, der in einem anderen Zeitalter lebte. Wir müssen allein mit seinen persönlichen Erzählungen arbeiten und hinnehmen, dass sich – wer kennt es nicht – die Erinnerungsfetzen an die früheste Kindheit über die Jahre hinweg verzerren können. Wenn der Betroffene an ihre Wahrheit glaubt, ist es vielleicht hinfällig, wie viel davon tatsächlich genauso stattfand.
*
Das, woran Heinrich Schliemann sich erinnert, verfolgte ihn sein Leben lang. In einer italienischen Sprachübung, die er dreißig Jahre später zu Papier bringen wird, zeichnet er die Situation zwischen seinen Eltern so eindrücklich nach, als wäre sie erst gestern geschehen: Sein Vater – Heinrich hält ihn für verabscheuenswürdig – ging regelmäßig fremd und misshandelte seine Mutter. Er schwängerte sie und ließ nicht mehr von ihr ab.
Die Konflikte zwischen Ernst und Luise Schliemann könnten sich in den ersten Jahren noch unbemerkt von den Dorfbewohnern in den eigenen vier Wänden zugetragen haben. Die Liebschaften des Pastors sprachen sich aber sicherlich bald herum, und spätestens seine Beziehung zum eigenen Dienstmädchen namens Sophie Schwarz wurde zu einem offenen Geheimnis. Als Luise Schliemann die Demütigungen nicht mehr aushielt und die Magd aus dem Haus warf, waren die Konflikte damit nicht beendet. Im Gegenteil: Heinrichs Vater wurde gegenüber seiner Frau noch aggressiver, die Hausangestellten erzählten im Dorf, dass er sie schlagen würde. Seine Geliebte brachte er in einem Zimmer im benachbarten Waren unter und besuchte sie dort, sooft er konnte. Seine Pflichten als Pastor vernachlässigte er ebenso wie seine Familie. Das Martyrium, das vor allem Heinrichs Mutter durchlebte, muss unvorstellbar gewesen sein. In einem ihrer letzten Briefe an Heinrichs ältere Schwester Elise, die wohl zur selben Zeit eine Ausbildung zur Wirtschafterin in Parchim machte, schien sich die Mutter innerlich bereits auf den nahenden Tod vorzubereiten: »Aber die Tage, die dann kommen, kannst Du jeden Augenblick denken, dass ich im Kampfe zwischen Leben oder Todt bin. Solltest Du von letzterem benachrichtigt werden, so gräme Dich nicht viel, sondern freue Dich vielmehr, dass ich ausgelitten habe auf dieser für mich so undankbaren Welt!«
Zwei Monate, nachdem sie ihr neuntes Kind, Heinrichs Bruder Paul, zur Welt gebracht hatte, starb Luise Schliemann mit sechsunddreißig Jahren an den Folgen eines Nervenfiebers – eine Krankheit, die durch psychischen Stress oder seelische Erschöpfungszustände ausgelöst werden kann. Wer diese verursacht haben könnte, wusste mittlerweile das gesamte Umfeld. Heinrich war damals neun Jahre alt.
Bereits einen Tag nach dem Tod der Frau ließ Ernst Schliemann einen Nachruf veröffentlichen. Der Pastor hatte innerhalb weniger Stunden einen ungewöhnlich langen, detaillierten Text verfasst, in dem es ihm mit schwülstigen Worten auf bemerkenswerte Weise gelang, weniger von seiner Frau, als vielmehr über sich selbst zu schreiben: Eigentlich ging es in der Todesanzeige um das Schicksal eines bemitleidenswerten Witwers und alleinerziehenden Vaters von sieben Kindern. Ernst Schliemann übernahm sowohl die Trauerrede in der Kirche als auch die Rede am offenen Grab. Seine Frau ließ er an einer Stelle auf dem Friedhof bestatten, die gut sichtbar vom Pfarrhaus lag. Er ließ dem Schein seiner unendlichen Trauer ungefähr ein halbes Jahr Zeit. Dann holte er Sophie Schwarz zu sich ins Haus zurück. Nun ging das Martyrium von Neuem los – diesmal für Heinrich und seine Geschwister.
Eine Woche nach dem Wiedereinzug der Dienstmagd, es war ein herbstlicher Sonntag, wurde das morgendliche Vogelgezwitscher um Ankershagen von einem Moment auf den anderen jäh unterbrochen: Ohrenbetäubendes Klirren und Scheppern hallte von den Häuserwänden über die Dorfstraße hinweg. Mehr als zweihundert Menschen hatten sich vor dem Pfarrhaus versammelt und schlugen mit Stöcken auf Töpfe ein. Dazu brüllten sie Spottgedichte. Von dem plötzlichen Lärm verängstigt versteckten sich Heinrich und seine Geschwister im Haus; trotz verschlossener Fenster hörten sie jedes der hasserfüllten Schimpfworte mit scharfer Deutlichkeit. Irgendwann hielt es Heinrich nicht mehr aus und wollte sehen, was sich auf dem Vorplatz abspielte. Er schob einen der zugezogenen Vorhänge vorsichtig beiseite und sah durch einen schmalen Spalt nach draußen: Nur wenige Meter vor ihm stand die aufgebrachte Gruppe und johlte in seine Richtung. Die meisten der zornerfüllten Gesichter kannte Heinrich gut, fast jeden von ihnen hatte er zumindest schon einmal gesehen. Das waren seine Nachbarn, die Bewohner von Ankershagen und den ringsum liegenden Dörfern. Als er bemerkte, wie sich ein Mann in der vordersten Reihe nach einem Stein auf dem Boden bückte, sprang er erschrocken vom Fenster weg und duckte sich. Eine Sekunde später klirrte es nebenan. Der Mann hatte offenbar mit dem Stein auf das Küchenfenster gezielt und es erfolgreich getroffen. Irgendwann beendete die Gruppe ihre Kesselmusik und ging wieder auseinander. Doch nicht für lange.
Ernst Schliemann, Heinrichs Vater
Den Skandal, den Ernst Schliemann mit seinem Verhalten verursacht hatte, wollte die Gemeinde Ankershagen nicht länger hinnehmen. Ihre Proteste wiederholten sie an den drei folgenden Sonntagen. Und mehr noch: Die Bewohner vermieden von nun an den Gottesdienst von Ernst Schliemann, und die Kirchengemeinde schickte eine Abordnung nach Waren, um sich über das Fehlverhalten ihres Pastors zu beschweren. Die Dorfbewohner wollten in erster Linie den Pastor treffen, aber mindestens so schwer trafen sie seine Kinder. Heinrichs Freunde tauchten nicht mehr bei ihm auf – ihre Eltern verbaten ihnen den Kontakt zu ihm. Auch Minna durfte nicht mehr mit Heinrich spielen; fortan musste er seine Streifzüge zu den geheimnisvollen Orten allein unternehmen. Solche Ausflüge machte er aber ohnehin kaum noch. Zu sehr spürte er die Blicke und das demonstrative Schweigen, wenn er im Dorf unterwegs war.
Als Großherzog Friedrich Franz I. persönlich eine Ermittlung gegen Ernst Schliemann einleitete, um den Vorwürfen zu dessen angeblich unmoralischem Verhalten und den übrigen Verfehlungen auf den Grund zu gehen, sah Heinrichs Vater den Zeitpunkt gekommen, seine Kinder von Ankershagen wegzuschicken. Nicht einmal ein Jahr nach dem Tod der Mutter brach die Familie auseinander und zerstreute sich in unterschiedliche Richtungen. Heinrichs Geschwister wurden bei verschiedenen Verwandten untergebracht. Er selbst zog bei der Familie seines Onkels in Kalkhorst ein und wurde in den folgenden eineinhalb Jahren von einem Privatlehrer auf den höheren Bildungsweg vorbereitet.
Im Herbst 1833 war es dann soweit: Der elfjährige Heinrich kam auf das Gymnasium Carolinum in Neustrelitz. Doch die Folgen des Skandals in Ankershagen wirkten immer noch nach. Heinrichs Vater war mittlerweile suspendiert worden und konnte das Schulgeld bald nicht mehr bezahlen. Heinrich musste nach drei Monaten das Gymnasium verlassen und auf die kostengünstigere Realschule wechseln. Die Enttäuschung über diesen aufgezwungenen Rückschritt bleibt ein Thema in Heinrichs Leben. Einen Versuch, dieses ungewollte Ereignis zu kompensieren, es metaphorisch in den Griff zu kriegen, könnte man aus seiner Selbstbiografie herauslesen, die er Jahrzehnte später niederschrieb. Dort formuliert Heinrich das Verlassen des Gymnasiums als eine Entscheidung, die er selbstständig getroffen hätte, um die wenigen Mittel des Vaters nicht überzustrapazieren.
Mit vierzehn Jahren begann Heinrich direkt nach dem Abschluss der Realschule eine Kaufmannslehre in einem Krämerladen in Fürstenberg. Die folgenden fünf Jahre arbeitete er von morgens um fünf Uhr bis nachts um elf Uhr. Er verkaufte Heringe, Butter, Kaffee, Talglichter und vieles mehr, mahlte zwischendurch Kartoffeln für die Brennerei oder fegte den Laden. Zur Weiterbildung blieb ihm keine Zeit, im Gegenteil: Das Wenige, was er zuvor gelernt hatte, vergaß er während der Lehrjahre ganz. Außerdem wohnte Heinrich zum ersten Mal weit entfernt von Familie und Verwandten. Zwar fand er in seinem Lehrherrn Hans Theodor Hückstädt einen aufgeklärten und verständnisvollen Mann, mit dem er noch viele Jahrzehnte brieflichen Kontakt pflegte. Dennoch behielt er seine Zeit in Fürstenberg in schlechter Erinnerung und stellte sie stets als einen der Tiefpunkte seines Lebens dar.
Nach fünf zähen Jahren voller anstrengender und eintöniger Arbeit folgte ein Jahr, das von wichtigen Entscheidungen und Begegnungen geradezu überhäuft war und letztendlich in dem Schiffsunglück vor Holland gipfeln sollte. Heinrichs Leben schien Fahrt aufzunehmen. Nachdem sein Arbeitsverhältnis in Fürstenberg beendet war, wollte er zunächst nach New York auswandern, landete dann aber in Rostock, von wo es ihn bald nach Hamburg zog. Nach vielen Jahren ohne Familie und Verwandtschaft traf er innerhalb weniger Monate wieder auf seinen Vater und dessen neue Ehefrau, sah seine beiden jüngsten Geschwister Louise und Paul und lernte zugleich seine neuen Halbgeschwister kennen, Karl und Ernst. Er ging nach Neubukow zum Grab seines älteren Bruders, der zwei Monate nach Heinrichs Geburt gestorben war. In Wismar traf er einen Teil seiner Verwandtschaft. Von dort gelangte er schließlich nach Hamburg.
Nach der Zeitreise durch die mecklenburgische Provinz lernte Heinrich zum ersten Mal in seinem Leben eine Stadt kennen, deren Anblick allein ihn so sprachlos machte, dass er in seiner Unterkunft eine Stunde lang nackt am Fenster stand, ohne es zu bemerken. Auf dem Weg durch die Stadt sog Heinrich das Treiben mit all seinen Sinnen auf: diese vielen Menschen, egal, wohin er blickte; wie sie liefen und rannten, wie sie Heinrich wegdrängten oder ihn vor sich herschoben. Das Dauerrauschen aus dem Geschrei der Händler, die ihre Ware feilboten, aus dem Dröhnen der vorbeifahrenden Pferdekutschen, die den zähen braunen Matsch auf den Straßen hochspritzen ließen, und aus dem mechanischen Klang der Glocken, die von den Kirchturmuhren hoch über den Gebäuden bis hinunter in die Straßenschluchten drangen.
In Hamburg kam es zu einer weiteren prägenden Begegnung. Heinrich suchte Sophie Schwarz auf, deren Affäre mit seinem Vater den Skandal in Ankershagen vor nunmehr zehn Jahren ausgelöst hatte. Sie arbeitete mittlerweile als Zimmermädchen in einem Hotel. Zwar war sie anders gekleidet, aber an ihrem plumpen Gesicht erkannte Heinrich sie trotzdem sofort. Obwohl er sie eigentlich verabscheute, berichtete Heinrich seinen Schwestern später in einem Brief von dem, was Sophie aus ihrer eigenen Perspektive über die schlimmen Ereignisse von damals zu sagen hatte. Ganz besonders ausführlich schilderte er dabei die Vorwürfe, die sie seinem Vater machte, die verlogenen Liebesversprechen eines geachteten Mannes, der das Wort des Höchsten verkündet. Er hatte sie in ihrer armseligen Lage als Dienstmagd ohne große Zukunftsaussichten geblendet. Heinrich brauchte nicht weniger als zehn Briefblätter, um die Anklage Sophies niederzuschreiben. Keine einzige ihrer Aussagen über Ernst Schliemann schien Heinrich seinen Schwestern vorenthalten zu wollen. Seine anfängliche Abscheu gegenüber Sophie schien einem anderen Gefühl gewichen zu sein – vielleicht dem Gefühl eines Leidensgenossen.
Arbeitslos, schwach auf der Lunge und mit Schmerzen in der Brust wurde die Situation in der großen fremden Stadt für Heinrich langsam brenzlig. Um seinen Körper zu kräftigen, ging er regelmäßig in eisig kaltem Wasser baden. Um seine finanziellen Engpässe überbrücken zu können, schrieb er einen Brief an seinen Onkel in Vipperow und bat ihn darum, ihm zehn Reichstaler zu leihen. Dieser schickte ihm zusammen mit dem Geld einen Brief, dessen Inhalt Heinrich tief verletzte. Der Stolz des Neunzehnjährigen muss bereits zu diesem Zeitpunkt groß gewesen sein. Er schwor sich daraufhin, nie wieder um die Hilfe eines Verwandten zu bitten, egal, wie schwer seine Not auch sein möge.
Heinrich war schon einige Zeit in Hamburg, doch es hatten sich bislang keine beruflichen Perspektiven für ihn ergeben. Da lernte er auf der Börse einen Schiffsmakler kennen, der ihn auf eine Idee brachte. Auf die Idee eines Neuanfangs in der Ferne.
*
Als Schliemann am ersten Weihnachtstag 1841 im Amsterdamer Armenkrankenhaus liegt, ist der Enthusiasmus, mit dem er nur wenige Wochen zuvor seine Reise angetreten hatte, auf ein Quäntchen zusammengeschrumpft. Schuld daran hat sein trostloses Umfeld: ein einziges Zimmer gefüllt mit mehr als hundert wimmernden Patienten, von denen jeden Tag drei bis vier als Leichen hinausgeschafft werden. Vor allem aber die unerträglichen Schmerzen in seinem Mund quälen ihn permanent. Einen Abend zuvor, kurz bevor das gedämpfte Glockenläuten der Christmette bis in die Räume des Krankenhauses vorgedrungen war, hatte ein Arzt ihm die Wurzeln seiner abgebrochenen Vorderzähne entfernt. Dieses Jahr, das so vielversprechend begonnen hatte, könnte eigentlich kaum schlimmer enden, stellt Schliemann mit geschwollenem Gaumen fest.
In dem Augenblick, als er sich endlich aus der stundenlangen Rückenlage befreit und in eine einigermaßen bequeme Seitenposition geschoben hat, um trotz der Pein etwas Schlaf zu finden, hört er, wie die Tür geöffnet wird und Schritte durch das Zimmer hallen. Direkt vor seinem Bett werden sie langsamer und klingen ab. Schliemann blickt nach oben und erkennt nach einigen Sekunden Herrn Quack wieder, den Konsul von Mecklenburg, den er am Tag seiner Ankunft in Amsterdam aufgesucht hatte. Nachdem er ihn mit einem Nicken begrüßt hat – auf das Reden verzichtet er lieber –, überreicht der Konsul ihm einen Brief. Es ist eine Antwort vom Schiffsmakler Wendt, den Schliemann von der Insel Texel aus um Hilfe gebeten hatte. Schliemann überfliegt hastig die Zeilen. Danach braucht er einige Augenblicke, um sein Glück zu begreifen. Wendt wird ihm nicht nur Geld senden, sondern will ihn darüber hinaus auch bei der Suche nach Arbeit unterstützen. Die Nachricht wirkt auf Schliemann wie Medizin. Bereits am nächsten Morgen verlässt er das Krankenhaus – allein die Pflaster im Gesicht erinnern ihn noch einige Zeit an das scheußlichste Weihnachtsfest seines Lebens.
Zwei Monate nach seiner Ankunft hat sich Schliemann in Amsterdam sein neues Leben eingerichtet. Die Stadt ist nicht sehr groß und wirtschaftlich längst nicht mehr so bedeutend wie Hamburg, aber sie gefällt ihm trotzdem, zumindest als eine Zwischenstation. Sein Plan steht bereits fest: Für einige Jahre will er hierbleiben, danach wird er sein Glück außerhalb Europas suchen.
Von dem Geld des Schiffsmaklers Wendt hat sich Schliemann neue Kleider gekauft und ein kleines Zimmer im fünften Stock eines Hauses gemietet. Und dank der Empfehlung Wendts hat Schliemann auch Arbeit gefunden, und zwar im Handelskontor Hoyack & Co. Als er seinen neuen Arbeitgebern während des Vorstellungsgesprächs ein Schriftstück innerhalb von fünfzehn Minuten in vier verschiedene Sprachen übersetzt, blicken sie sich überrascht an. Schliemann wird eingestellt.
Das Kontor liegt an der Keizersgracht, einer der Hauptgrachten, die den mittelalterlichen Stadtkern umschließen. In Hoyacks Haus laufen die Patrone und ihre rund zwanzig Mitarbeiter auf Marmorböden und -stufen. Das Hausinnere wird von Gaslampen hell erleuchtet –allein im großen Kontorsaal zählt Schliemann achtundvierzig davon. Einunddreißig Schiffe gehören zum Inventar; gehandelt wird unter anderem mit Getreide und Kolonialwaren. Während Schliemann noch vor einem Jahr auf den Regalen eines kleinen Krämerladens Staub wischte, macht er nun Botendienste für eines der größten Handelshäuser Amsterdams. Zugleich empfindet er seine Arbeitszeiten als deutlich entspannter. Vormittags beginnt das Geschäft nicht vor zehn Uhr. Nachmittags gegen drei Uhr bricht Schliemann zur Börse auf. Nach einer halbstündigen Pause arbeitet er nochmals bis acht Uhr im Kontor. Am Feierabend verabschiedet sich Schliemann vor der prächtigen Eingangstür des Kontors von seinen Kollegen, die sich in unterschiedliche Richtungen zerstreuen. Er will noch etwas frische Luft schnappen, bevor er nach Hause geht, und unternimmt einen Spaziergang. Überall beleuchten Gaslaternen den Weg durch die Gassen, spiegeln sich in den sanften Wellen des pechschwarzen Wassers der Kanäle und Grachten wider. Bei Nacht, in künstliches Licht getaucht und in friedlicher Stille, findet Schliemann Amsterdam noch viel eleganter und herrlicher – so stellt er sich eine Stadt von Welt vor.
Die vielen neuen Eindrücke auf seiner abenteuerlichen Reise und von seinem neuen Zuhause schwirren in seinem Kopf. Er möchte jemandem davon erzählen, am liebsten seinen Schwestern Wilhelmine und Doris. Als er alle Ereignisse der letzten Wochen endlich schriftlich festgehalten hat, von denen die Schwestern seiner Meinung nach wissen sollten – angefangen von den besonderen Begegnungen kurz vor der Abreise, seinem erstaunlichen Überleben des Schiffsbruchs bis hin zu seiner glücklichen Ankunft in Amsterdam, einer Stadt, von deren Pracht sich seine Schwestern in der Provinz ja keine Vorstellung machen können –, will er den Brief unterschreiben. Da hält er inne und überlegt eine Weile, wie sich der schicksalhafte Beginn seines neuen Lebens am besten vermitteln ließe. Schließlich setzt er den Stift auf das Papier und unterschreibt mit: Henry Schliemann. So wird es fortan unter all seinen Briefen stehen.
Die Abendspaziergänge bleiben Schliemanns einziges Freizeitvergnügen. Sein Verdienst reicht nicht aus, um die Schaubühnen oder eines der zahlreichen Kaffeehäuser zu besuchen, wo er vielleicht auch einem seiner Kollegen begegnen würde. Und es gibt noch einen weiteren Grund, weshalb er nach einem solchen Ausflug lieber rasch wieder in seine Dachkammer zurückkehrt. Dort angekommen, legt er seinen Rock beiseite, um zwei wollene Unterjacken anzuziehen und ein Katzenfell um seinen Bauch zu wickeln. Eine Heizung fehlt im Zimmer, und den Ofen aus Gusseisen, den er sich vom Schmied gegen eine monatliche Gebühr geliehen hat, wirft er im ersten Winter nur selten an – zu teuer sind die Steinkohlen. Er sitzt an einem kleinen Tisch und schlägt mit kalten Fingerspitzen das siebte Kapitel des Buches Ivanhoe auf. Dann fängt Schliemann, dessen Gesicht nur bis zur roten Nasenspitze aus seinem Wollschal ragt, mit lauter durchdringender Stimme an, den ersten Satz zu lesen: »The – con-dit-ion – of – the – Eng-lish – na-tion – was – at – this – time – suf-fi-cient-ly mi-se-ra-ble.« Jedes Wort, jede einzelne Silbe betont er in einer unbeirrt steten Geschwindigkeit. So fährt er lange Zeit fort, und die englischen Wörter durchschneiden im Stakkato wie Peitschenhiebe mechanisch die nächtliche Stille. Sie dringen durch die dünnen Wände bis hinunter zu den Bewohnern im dritten Stockwerk. Als irgendwann ein kräftiges Klopfen unter den Dielen seines Zimmers ertönt, blickt Schliemann auf die Uhr: Eine Stunde ist vorbei, seit er begonnen hat. Somit kann er die Sprachübung für heute guten Gewissens beenden und seine Nachbarn für den Rest der Nacht verschonen. Er legt das Buch beiseite und greift zu Stift und Papier. Nachdem er seine Hände kurz geknetet hat, um sie besser zu durchbluten, fängt er schweigend an, seine Gedanken auf Englisch niederzuschreiben. Es ist weit nach Mitternacht, als er sich zu Bett legt.
Englisch ist fortan seine neue, treue Begleitung: wenn er auf dem Weg zum Kontor ist, wenn er auf dem Weg nach Hause ist, wenn er in der Warteschlange vor dem Postamt steht, wenn er nachts nicht einschlafen kann. Er übt das Sprechen, er lernt seine selbst geschriebenen Sätze, aber auch ganze Romane auswendig, mal im Lauten, mal im Leisen. Er überwindet seine Abneigung gegen Gottesdienste und besucht regelmäßig eine englische Kirche, um während der Predigten sein Gehör für die Sprache zu trainieren. Als er ein halbes Jahr in Amsterdam lebt, sind seine Englischkenntnisse für seine Ansprüche bereits ausreichend. Schliemann räumt die alten Lernmaterialien beiseite, um Platz für neue Bücher zu schaffen. Inzwischen ist es Sommer geworden, und in seiner Kammer direkt unter dem Dach steigen die Temperaturen tagsüber in unerträgliche Höhen. Während er über den Büchern brütet, bilden sich auf seiner Stirn kleine Schweißperlen. Aber weder die Winterkälte noch die Sommerhitze halten ihn davon ab, seine Lektionen durchzuziehen. Statt mit Englisch quält Schliemann seine Nachbarn nun Abend für Abend mit den ersten stockenden Übungen im Französischen. Weitere Monate vergehen, und bald kann er sich neben Englisch und Französisch auch auf Holländisch, Spanisch und Portugiesisch unterhalten. Seine selbst erfundene Methode, bestehend aus lautem Lesen, Auswendiglernen und Korrigieren durch Lehrer, hat er in der Zwischenzeit so perfektioniert, dass ihm das Erlernen einer Sprache innerhalb von sechs Wochen gelingt. Sie erfordert viel Zeit und harte Disziplin, aber eines hat Schliemann seit seiner Abkehr von der Heimat begriffen: Die Ziele, die er sich gesteckt hat, wird er nie auf bequemen Wegen erreichen.
*
Es ist das späte Frühjahr 1844. Seit rund zwei Jahren lebt Schliemann in Amsterdam und wurde erst kürzlich im Handelshaus B.H. Schröder & Co. eingestellt. Schliemann geht gerne zu seinem neuen Arbeitsplatz. Statt unterfordernder Botengänge zum Postamt übernimmt er verantwortungsvolle Tätigkeiten als Korrespondent und Buchhalter des Kontors, mit einem deutlich besseren Gehalt. Herrn Schröder konnte er vor allem durch seine vielfältigen Sprachkenntnisse überzeugen. Schliemann spürt, dass dieser seine Talente schätzt und ihm etwas zutraut. Gleichzeitig schaut der Patron seinem neuesten Angestellten genau auf die Finger. Aber Schliemann kümmert das nicht weiter, im Gegenteil. Endlich wird er von jemandem gesehen.
Während seine Karriere bereits erfreuliche Fortschritte zeigt, verändert Schliemann an seinem Privatleben so gut wie gar nichts. Er unternimmt nicht viel mehr als seine Abendspaziergänge, lebt weiterhin in dem kleinen Dachzimmer, das zu jeglicher Jahreszeit die denkbar ungünstigste Temperatur hat. Und er ernährt sich noch immer von Schwarzbrot und Roggenmehlbrei. Das Geld, das er zusammenspart, sendet er seiner Familie nach Mecklenburg. Die einzigen Gäste, die er empfängt, sind seine Sprachlehrer. Aber selbst die kommen seit längerer Zeit nicht mehr vorbei. Denn für die neueste Sprache, die Schliemann unbedingt beherrschen will, findet er niemanden. Genau darin liegt der Reiz für ihn: Könnte er Russisch sprechen, wäre er damit wohl der Erste in Amsterdam.
Allein schon die Suche nach geeignetem Lernmaterial gestaltet sich schwierig. Von dem Moment an, als er sein neues Projekt vor Augen hat, nutzt Schliemann jede freie Minute, um in Antiquariaten nach russischen Büchern Ausschau zu halten. Es dauert Wochen, bis er das Nötigste erstanden hat: ein Lexikon, eine Grammatik und eine Übersetzung der Abenteuer des Telemach.
Die Suche nach einem Lehrer gibt Schliemann schließlich auf und beginnt mit dem allabendlichen Auswendiglernen und Schreiben. Doch er muss sich bald eingestehen, dass das laute Sprechen und das darauf folgende Schweigen der Zimmerwände einfach nicht befriedigend sind, genauso wenig wie das aggressive Klopfen unter den Dielen, das irgendwann folgt. Schliemann braucht einen willigen Zuhörer. Schließlich bezahlt er einen Mann, einen Juden aus armen Verhältnissen. Für vier Gulden pro Woche muss dieser sich jeden Abend einen russischen Monolog anhören, von dem er kein Wort versteht. Nach etwa zwei Stunden verabschiedet Schliemann mit heiserer Stimme seinen Gast, der etwas benommen auf den Treppenstufen wankt und mit einem leichten Dröhnen in den Ohren in die Nacht verschwindet. Sechs Wochen später entlässt er den Juden von seinen Pflichtbesuchen. Schliemann beherrscht nun genügend Russisch, um Geschäftsbriefe in dieser Sprache zu schreiben und mit russischen Kaufleuten Gespräche zu führen.
Im Kontor bemerkt niemand etwas von Schliemanns schlafraubender Freizeitaktivität. Er erfüllt seine Aufgaben gewissenhaft und nimmt die Ratschläge erfahrener Kollegen an. Wann immer Schröder an Schliemanns Schreibtisch vorbeiläuft oder von Weitem einen Blick zu ihm hinüberwirft, sieht er den jungen Mann, wie er sich konzentriert und mit gestrecktem Rücken über ein Buch oder eine ausländische Zeitung beugt. Letztere durchsucht er nach Artikeln, die für das Kontor in irgendeiner Form relevant sein könnten, liest sie durch und wertet sie hinterher aus. Zufrieden wendet sich Schröder von diesem Anblick ab und fühlt sich wieder einmal in seiner Entscheidung bestätigt, dem jungen Deutschen eine Chance gegeben zu haben. Zwar musste er schon nach wenigen Wochen in der ein oder anderen Situation leicht die Augenbraue heben, als bei seinem neuesten Angestellten völlig unerwartet ein erstaunliches, fast schon unverschämtes Maß an Selbstbewusstsein aufblitzte – doch darüber sieht Schröder bei solch fleißigem Gebaren gerne hinweg. Der Übermut, denkt er, ist sicherlich nur Schliemanns jugendlichem Alter zuzurechnen.
*
»In der Tat gehen uns Neuyork und Lima näher an als Kiew und Smolensk«, schreibt der preußische Historiker Leopold von Ranke (1795-1886) im Jahr 1827. Ranke spricht wohl den meisten Westeuropäern seiner Zeit aus dem Herzen. Das Russische Zarenreich, obwohl so viel näher gelegen als Amerika, scheint ihnen rätselhaft – und gefühlt in unerreichbarer Ferne gelegen. Dass Zar Alexander I. gerade einmal ein Vierteljahrhundert zuvor in den napoleonischen Kriegen als »Retter Europas« gefeiert worden war und Russland auch auf dem Wiener Kongress bei der Neuordnung des Kontinents eine bedeutende Rolle gespielt hatte, änderte daran auch nicht viel. Russland und seine Bewohner wirken auf die Europäer immer noch »barbarisch«, rückständig und fremdartig, wenngleich Letzteres nicht oberflächlich sichtbar sei. Napoleon soll einst gesagt haben, man müsse am Russen nur kratzen, um den Tataren zu finden. Dieses Bild spukt noch Jahrzehnte später in den Köpfen vieler, wenn sie an das Zarenreich denken.
*
Es ist ein später Nachmittag im Winter 1846, als Schliemann im offenen Schlitten über die Waldaihöhen durch das so fremdartige Land fährt. Die Sonne ist fast untergegangen, am tiefblauen Himmel leuchten bereits die ersten Sterne durch die wenigen Lücken, die der aufsteigende Nebel noch zulässt. Im schwachen Dämmerlicht tauchen zwischen den bewaldeten Hügeln pechschwarze Seen auf und verschwinden wieder. Gleichmäßig trampeln die Pferde über den verschneiten Pfad. Wohin der Schlitten fährt, scheint nur sein schweigsamer Fahrer zu wissen. Denn vor ihnen liegt Finsternis.
Schliemann hält es in diesem Moment für durchaus realistisch, noch nie zuvor einer solchen Kälte ausgesetzt gewesen zu sein. An der letzten Station, an der sie haltgemacht hatten, war das Quecksilber eingefroren. Mit steifen Händen versucht er, die Pelzmütze noch tiefer in den Nacken zu ziehen. In seinen Ohren pocht der Schmerz. Seit ungefähr zwanzig Stunden sitzt er in dem Schlitten, der ihn nach St. Petersburg zurückbringen soll. Vor einem knappen Jahr ist er von Amsterdam dorthin gezogen und bereits zum vierten Mal hat er die beschwerliche Fahrt ins siebenhundert Kilometer entfernte Moskau auf sich genommen. Nun liegen noch mehr als fünfundzwanzig Stunden vor ihm: eine ganze Nacht und ein weiterer Tag, bis er am Ziel ankommen wird. Aus Erfahrung weiß er, dass sich die letzten Kilometer besonders lang hinziehen werden. Erst, wenn am Horizont die Silhouette von St. Petersburg zu sehen ist, wird er Vorfreude und Erleichterung über die baldige Ankunft verspüren.
Schliemann muss immer wieder seine Augen reiben – der schneidende Wind lässt sie tränen, und die austretende Flüssigkeit fängt in der frostigen Kälte sofort an zu gefrieren. Allein schon das Luftholen ist eine Qual. Flach atmend und mit geschlossenen Augen drückt er sich tief in die Sitzbank und denkt an die letzten Tage zurück.
Seine Reisen nach Moskau waren bisher stets ein kleines Abenteuer gewesen, nicht nur der Weg dorthin, sondern auch der Aufenthalt selbst. Voller Nervenkitzel hoffte Schliemann, vor Ort neue spannende Kontakte in der Handelsbranche zu knüpfen und lukrative Geschäfte abzuwickeln. Seine Hoffnung hatte sich stets erfüllt, seine Erwartungen wurden zumeist sogar übertroffen. Auf den Rückfahrten nach St. Petersburg hatte er das zähe Tempo der Reise genutzt, um die guten Nachrichten an seine Auftraggeber in Europa gedanklich vorzuformulieren. Zu Hause angekommen, würde er dann die Briefe mit ausführlichen Details niederschreiben, nicht ohne den Adressaten das Lob für Schliemanns großartige Leistungen schon einmal vorwegzunehmen. Bereits zu diesem Zeitpunkt besitzt er einen reichen Wortschatz an Superlativen.
Nun ist alles anders gekommen. Im Schlitten frierend, zerbricht Schliemann sich den Kopf darüber, wie er in Worte fassen soll, was in Moskau passiert ist. Er hatte sich mit Wladimir Alexejew getroffen, einem Moskauer Kaufmann. Der Kontakt war, genau betrachtet, nicht rein beruflich, denn Schliemann war mit der Familie von Alexejew privat befreundet. Vielleicht, denkt er, hatte er deshalb eher voreilig und vertrauensvoll begonnen, sich auf Geschäfte mit dem jungen Kaufmann einzulassen. Bislang war er mit seinen spontanen Entscheidungen überwiegend gut gefahren. Doch diesmal war es ein Fehler gewesen. Das Treffen entwickelte sich zu einem Desaster, die Geschäftsverbindung ist grandios gescheitert – und Schliemann hat schon die finanziellen Verluste ausgerechnet, die sein Misserfolg nach sich ziehen wird. Schröder wird entsetzt sein.
Mittlerweile ist die Sonne wieder aufgegangen, aber die Temperaturen sind nur unmerklich gestiegen. Der Schlitten quietscht leicht, während er über den vereisten Boden gleitet. Schliemann zählt die Bauernhöfe, die er im Vorbeifahren entdeckt. Viele sind es nicht. Sie liegen weit entfernt voneinander und wirken verloren in der unendlichen Landschaft aus Wäldern, Hügeln und Seen. Die Bauern, die am Wegesrand unterwegs sind und vom Schlitten überholt werden, sind für die Jahreszeit eher notdürftig gekleidet. Auf dem Rücken tragen sie primitive Geräte zum Beackern der Felder oder ziehen sie auf Holzkarren hinter sich her. Die meisten von ihnen sind nach wie vor Leibeigene und leben in feudalen Verhältnissen, wie man sie in Westeuropa schon länger nicht mehr kennt. Schliemann kann beim Anblick der russischen Bauern kaum glauben, dass er sich in dem Land befindet, in dem zugleich so prächtige Städte wie St. Petersburg und Moskau stehen.
Irgendwann wird die Stille durch ein Hämmern und schrille Töne unterbrochen. Schliemann, der für einen Augenblick eingedöst war, richtet sich, von dem mechanischen Geräusch wach geworden, in seinem schweren Pelzmantel auf und sucht mit den Augen den Horizont ab. Tatsächlich, sie nähern sich den Arbeitern, die die Gleise für die neue Eisenbahnstrecke verlegen. Weit sind sie nicht gekommen, seit Schliemann auf dem Weg nach Moskau an ihnen vorbeigefahren war. Dabei hatte der Bau der geplanten Strecke zwischen St. Petersburg und Moskau schon 1842 begonnen – als Schliemann gerade einmal ein halbes Jahr in Amsterdam lebte. Vier Jahre ist das her, doch es kommt ihm vor wie eine Ewigkeit, die zwischen dem Botenjungen mit dem winzigen Dachzimmer und dem vielreisenden Handelsagenten liegt. Ernüchtert gibt er die Hoffnung auf, dass er schon in naher Zukunft in einem angenehm warmen Zugabteil nach Moskau fahren kann, während die Hügel und Seen nur noch wie dünne Fäden an seinem Fenster vorbeiziehen. Er tröstet sich damit, dass er in kaum einer Stunde in der Stadt ankommen wird.
Noch am selben Abend bringt er die unangenehme Aufgabe hinter sich und schreibt den Brief an Schröder. Die Antwort lässt nicht lange auf sich warten. Schliemann reißt das Kuvert auf und fängt an, die ersten Zeilen zu lesen. Schröder sehe
»mit Bedauern Ihre getäuschten Illusionen in betreff der Verbindung mit W Alexejeff, allein wundern tut es mich nicht im Entferntesten, vielmehr habe ich es längst erwartet, und zwar von vornherein, wie Sie auch bei Ihrer Anwesenheit hier bemerkten, die begründetsten Zweifel über alle Ihre hirnscheinigen Projecte gesagt. Sie haben durchaus keine Kenntnisse von Menschen und Welt, schwatzen und versprechen viel zu viel, schwärmen immerwährend für Hirngespinste, nur in Ihrer Einbildungskraft erreichbar, in der Wirklichkeit niemals.«
Seufzend überfliegt Schliemann die nächsten Zeilen, um abzuschätzen, inwieweit sich das Zetern fortsetzt. Mittlerweile kann er mit Schröders heftigen Reaktionen gut umgehen. Er liest die Seiten einmal durch, wertet sie nach relevanten Aussagen aus und lässt die unnötigen Kritikpunkte – diesmal wieder in der Mehrheit – auf sich beruhen, ohne noch einmal daran zu denken. Eine zeitsparende Methode, die er sich beim Lesen der ausländischen Zeitungen in Amsterdam angeeignet hatte.
Einige Tage später fasst er seine eigenen Überlegungen zu der missglückten Geschäftsverbindung in einem Brief an seinen Vater zusammen: »Obgleich ich in meinen Plänen mit Wladimir Alexejeff … Schiffbruch erlitt, so glaube ich wird die Verbindung mit diesem Freunde über kurz oder lang wieder zu Stande kommen … Wenn mir das Glück auf diese Weise wohl will, so werde ich als wahrer Diplomat die Bühne besteigen. … Jetzt heißt es ›eile mit Weile‹; aber daran bin ich nicht gewöhnt und kann kaum meinen brennenden Ehrgeiz in Zaum halten.« Zum Schluss ergänzt er den Brief noch um folgenden Satz: »Deine lieben Briefe an mich bitte wie folgt zu adressiren: Henry Schliemann St. Petersburg, einer weiteren Adresse bedarf es dazu nicht, da ich hier etablirt und genügsam bekannt bin.«
Die Kommunikation mit Schröder zeigt ihm letztendlich nur, dass die Entscheidung, nach Russland zu ziehen, die einzig richtige war. Unter Schröders Fittichen fühlte sich Schliemann eingeengt, in zweitausend Kilometern Entfernung kann er hingegen seine Persönlichkeit schon viel besser entfalten. Er findet, dass die Ergebnisse, die er im vergangenen Jahr erzielt hat, für sich sprechen:
Im Januar 1846 war Schliemann innerhalb von sechzehn Tagen auf dem Landweg von Amsterdam nach St. Petersburg gezogen. Aus der Perspektive eines Kaufmanns war er hier auf eine wahre Schatzgrube gestoßen. Was in Europa an Waren fehlte, gab es in Russland scheinbar im Überfluss; für die Güter, mit denen Europa wiederum das Zarenreich beliefern konnte, ließen sich in Russland große Gewinne erzielen. Innerhalb kurzer Zeit schloss er in St. Petersburg wichtige Kontakte mit russischen Händlern und reiste bereits nach sechs Tagen weiter nach Moskau, um dort dasselbe zu tun. Das Land, von dem er so viel Unheimliches gehört hatte, gefiel ihm mit jedem Tag besser. Schliemann, ein aufgeschlossener junger Ausländer, dem die gewiefte Art seiner älteren Kollegen noch zu fehlen schien und mit dem sie sich endlich einmal in der eigenen Landessprache auf einer persönlicheren Ebene unterhalten konnten, gefiel auch den Russen. Er gewann bald das Vertrauen der Reichsten von St. Petersburg und machte immer lukrativere Geschäfte.
Im Oktober 1846 reiste er zehn Wochen lang durch Westeuropa, um auch in anderen Ländern berufliche Beziehungen aufzubauen. Erneut stellte Schliemann fest: Seine Sprachgewandtheit räumt ihm gegenüber seinen Konkurrenten klare Vorteile ein. Als er mit dem Schiff von Danzig nach Westen fährt und die mecklenburgische Küste sieht, regt sich nichts in ihm. Als sie im Nebel verschwindet und die Entfernung zur einstigen Heimat wieder größer wird, wendet er sich zum Bug hin und blickt kein einziges Mal zurück.
*
Gleich muss es vorbei sein. Das Licht ist weg. Eben noch sah er es und hoffte, es erreichen zu können. Der schäumende Strudel hinderte ihn daran und zog ihn gnadenlos in die entgegengesetzte Richtung, in die Tiefe. Die Wasserwände vereinten sich über seinem Kopf zu einer einzigen Masse, und das Licht verschwand dahinter. Oben und unten existiert nicht mehr, es gibt nur noch eine Dimension. Er weiß nicht, wohin. Er traut sich nicht zu atmen, denn dann würde Wasser seine Lungen füllen und er würde ertrinken. Jetzt muss es wirklich gleich vorbei sein.
Da wacht Schliemann auf. Er liegt in seinem Bett und kann nur schemenhaft den Raum erkennen. Er horcht. Nichts. Selbst von draußen dringen keine Geräusche in die Wohnung, weder die klackernden Schritte von Fußgängern, noch das Hufgeklapper von Pferden auf den gepflasterten Straßen. Niemand ist unterwegs. Schliemann steht nach einigen Momenten auf und zieht sich einen Morgenrock über. Er weiß, dass es keinen Sinn mehr macht, liegen zu bleiben – das Einschlafen fällt ihm schwer, erst recht, wenn er von einem Albtraum wach geworden ist.
Am Schreibtisch geht er seine Pläne für den Tag durch. Die eingegangene Korrespondenz muss längst wieder in die Kopierbücher abgeschrieben werden, das wird ihn sicherlich den gesamten Vormittag kosten. Am Mittag will er sich mit dem Besitzer einer Baumwollspinnerei treffen, um eine Lieferung des Farbpulvers Indigo neu auszuhandeln. Am Nachmittag schaut er wie immer auf der Börse vorbei, und zum Dinner ist er mit Peter Alexejew verabredet, einem steinreichen St. Petersburger Großhändler. Dessen Vermögen umfasst wohl einhundert Millionen Rubel, sein Privatvermögen noch nicht einmal einberechnet. Schliemann ist überzeugt davon, dass Alexejew nach Rothschild der reichste Mann sein muss. Heute Abend will er sich mit ihm über Produkte auf dem Markt unterhalten, deren Potenzial Schliemann bereits zu riechen glaubt: Salpeter, zur Herstellung von Sprengstoff beispielsweise. Papier könnte ebenfalls bald sehr begehrt sein – davon ist er überzeugt, seit er von Russlands Plänen erfahren hat, ein neues Gesetzbuch herausgeben zu wollen. Er wird versuchen, das Essen mit Alexejew möglichst in die Länge zu ziehen, bevor er wieder in seine Wohnung zurückkehren wird, in der außer ihm nur ein Bediensteter lebt. Er hält die Stille momentan nur schwer aus, vor allem, seit er vor einigen Wochen einen Brief aus Mecklenburg erhalten hat – seit er weiß, dass Minna vergeben ist.
Zehn Jahre vor der niederschmetternden Nachricht hatte Schliemann sie das letzte Mal gesehen. Es kommt ihm vor, als wäre es gestern gewesen: das vierzehnjährige Mädchen, groß gewachsen, in einem schlichten schwarzen Kleid. Schliemann zählt die Begegnung zu einem dieser großen starken Momente des Lebens, wenn die Unendlichkeit in wenige Sekunden hineinpasst. Beide sahen sich, rangen vergeblich um Worte und gaben sich schließlich dem Zauber der Situation hin. Erst als ihre Eltern den Raum betraten, endete der Augenblick, der nur Heinrich und Minna gehört hatte.
Seit er sich in St. Petersburg erfolgreich etabliert hat, sehnt sich Schliemann nach jenem Gefühl zurück: in Zweisamkeit von der banalen Realität entrückt zu sein. Und inmitten der vielen positiven Veränderungen – Geld, abenteuerliche Reisen, Sprachen, Gönner und Bewunderer, Vierzimmerwohnung samt persönlichem Diener – spürt er eine Lücke in seinem Leben. Ihm fehlt eine treue Wegbegleiterin, und für diesen Platz konnte er nur Minna in Betracht ziehen. So sendete Schliemann über einen gemeinsamen Freund einen Heiratsantrag an seine Kindheitsfreundin. Doch es war zu spät: Minna hatte vor Kurzem einen zwanzig Jahre älteren Gutspächter geheiratet.
Seit er davon erfahren hat, muss er in jeder freien Minute daran denken. Ihm fallen fast vergessene Situationen aus seiner Kindheit in allen Details wieder ein, als ob sich ein schwerer verstaubter Vorhang von seiner Erinnerung gehoben hat. Da waren nicht nur die Abenteuer mit Minna, bei denen sie sich auf die Jagd nach Zeugnissen der Vergangenheit begaben, sondern auch die vielen Pläne, die sie für die Zukunft geschmiedet hatten: eine gemeinsame Zukunft. Einige Zeit macht ihn der Gedanke an die verpasste Gelegenheit unkonzentriert und krank. Dann fängt er an, die Stunden, in denen das Geschäft geschlossen ist, in denen die Handelspartner sich längst im Kreise ihrer Familien befinden und der Großstadtlärm endlich verebbt ist, mit noch mehr Ablenkungen zu füllen. Dazu gehört vor allem Korrespondenz. Allein im Jahr 1847, als er vergeblich um Minnas Hand angehalten hat, schreibt er mehr als sechshundert Briefe an Geschäftspartner, Freunde und Bekannte und an seine Verwandten in Mecklenburg. Während er den Schwestern schon kurz nach der Ankunft in Amsterdam geschrieben hatte, meldet er sich jetzt auch regelmäßig beim Vater sowie den beiden jüngeren Brüdern und erkundigt sich nach deren Ergehen. In St. Petersburg ist Schliemann über die Lebenssituation von nahezu allen Mitgliedern seines engsten Familienkreises informiert.
Seinen Schwestern Wilhelmine, Dorothea, Elise und Louise, allesamt noch unverheiratet und bei verschiedenen Verwandten untergekommen, sendet er bei Bedarf Geld. Seinem ein Jahr jüngeren Bruder Ludwig hat er zu einer Anstellung in Amsterdam verholfen, kurz bevor er selbst Amsterdam verließ und nach St. Petersburg zog. Ludwig geriet schon bald mit seinen Arbeitgebern in Streit über das Gehalt und fand durch Vermittlung von Schröder & Co. eine Anstellung in einem anderen Handelshaus. Ludwigs Briefe, in denen er es schafft, seinen älteren Bruder zu bitten, seine Beziehungen für Ludwigs Karriere spielen zu lassen, und ihm dabei gleichzeitig altkluge berufliche Ratschläge zu erteilen, empfindet Heinrich zwar als lästig, lässt sich davon aber nicht weiter beirren. Ludwig hat er noch nie viel zugetraut. Die berufliche Zukunft seines jüngeren Bruders Paul macht ihm hingegen tatsächlich Sorgen. Paul, der erst wenige Wochen alt war, als ihre leibliche Mutter starb, ist sechzehn Jahre alt und lebt beim Vater und dessen neuer Familie.
Der Weg, Pauls Schicksal zu beeinflussen, führt nur über Ernst Schliemann. Heinrich versucht zunächst, seinen Vater davon zu überzeugen, dass eine kaufmännische Lehre in Amsterdam eine gute Möglichkeit für Paul wäre. Er würde seinem kleinen Bruder den Aufenthalt finanzieren. Sein Vater reagiert erst zwei Monate später und nach mehrmaliger Aufforderung auf seinen Vorschlag: Paul habe eigenständig entschieden, dass er lieber in der Landwirtschaft tätig sein wolle – und er würde ihm da auch gar nicht reinreden wollen. Paul traue sich das Erlernen von Sprachen und das kaufmännische Rechnen eben nicht zu. Heinrich ist nicht weiter überrascht über die ablehnende Reaktion seines Vaters. Er kennt es schon aus anderen Situationen: Weder will der Vater Geld von Heinrich annehmen, noch die Zeitungen lesen, die Heinrich extra für ihn abonniert hat. Er schickt ihm trotzdem weiterhin Geld und bezahlt ihm Zeitungen. Ebensowenig lässt er von seinem Plan ab, Pauls Schicksal in eine vernünftige Richtung zu lenken – in möglichst großer Distanz zum Wohnort von Ernst Schliemann. Dessen zweite Frau, die zwischenzeitlich zu einem anderen Mann gezogen war, ist wieder zurückgekehrt. Laut dem Vater verhält sie sich unberechenbar und aggressiv, rennt durch das Haus und zerschlägt Gegenstände, droht überall mit Brandstiftung und Mord. Durch dieses unberechenbare und aggressive Verhalten könnte sie ihn, so befürchtet Ernst Schliemann, sogar in einen zweiten Skandal hineinziehen.
Heinrich will Paul so schnell wie möglich aus diesen Zuständen retten, auch seine Schwestern sind entsetzt. Dorothea fasst es in einem Brief so zusammen:
»Ach mein Heinrich warum sind unsere Verhältnisse auch so schrecklich – daß wir lieber das väterliche Haus meiden und unser Brod unter fremden Leuten essen und uns verdingen als zu Hause zu sein, wie gerne möchte ich bleiben wenn es möglich wäre, aber die Verhältnisse sind nun einmal so und nicht anders!«
Während sich Schliemann über die familiäre Situation in Mecklenburg und Amsterdam auf dem Laufenden hält, geht es für ihn selbst weiterhin aufwärts, zumindest beruflich. Er hat ein eigenes Handelshaus gegründet und macht seine Geschäfte für Schröder & Co. fortan auf eigene Rechnung. Zugleich kommt ihm die Idee, Paul gar nicht erst nach Amsterdam zu schicken, sondern lieber direkt zu sich nach St. Petersburg zu holen. Seine Pläne stoßen weiterhin auf wenig Enthusiasmus. Irgendwann erhält er von Paul persönlich eine Antwort: Er könne sich einfach nicht dazu entschließen, seine Tage »in dem rauhen, barbarischen Rußland« zu verbringen. Diese Formulierung möge er ihm bitte nicht übelnehmen.
Heinrich lässt einige Tage vergehen. Dann überkommt ihn die Stimmung, wieder einmal über sein eigenes Leben zu sinnieren und diese Gedanken seinem Vater mitzuteilen. Zufrieden sei er derzeit nicht, aber das Glück liege ja auch nicht in den sechstausend Talern, die er 1847 verdiente, oder in den zehntausend Talern, die er in diesem Jahr erwarte. Es liege auch nicht in seiner prächtigen Wohnung, in köstlichen Speisen oder im guten Wein. Eigentlich fühle er sich weit weniger glücklich, als damals hinter dem Tisch des Krämerladens in Fürstenberg. Über den Vater bedankt er sich indirekt bei seinem Bruder für die Zeilen, lässt aber auch sein Bedauern über Pauls unsinnige Vorurteile gegenüber Russland ausrichten – einem Land, das dem Ausland dreihundert Jahre voraus sei. Schliemann schätzt sich glücklich, mittlerweile russischer Staatsbürger zu sein: »Unser Kaiser liebt sein Volk wie seine Kinder.«
Heinrich überlegt zum Schluss, ob er auf des Vaters erneute Bitte im letzten Brief eingehen soll, nun doch endlich das Abonnement für verschiedene Hamburger Zeitungen abzubestellen. Er entschließt sich, es zu ignorieren. Was auch immer seinem Vater daran missfällt, von seinem Sohn unterstützt zu werden, es kümmert Schliemann nicht.
Während Heinrich sich über Pauls undankbare Zurückweisung aufregt, nervt ihn zugleich die Aufdringlichkeit seines anderen Bruders. Ludwig würde nur zu gerne zu ihm nach St. Petersburg kommen, da er schon wieder arbeitslos ist. Eine Begründung für die plötzliche Kündigung habe er von seinem Arbeitgeber nicht erhalten. Heinrich will ihn nicht zu sich holen, da er ihn für überheblich und selbstherrlich hält. Erst, wenn er Russisch beherrsche, könne er Heinrich nützlich sein, und das würde bei seinem geringen Talent ja wohl noch an die vier Jahre dauern. Was Ludwig aber wirklich verletzt, ist Heinrichs Angebot, ihm fünfhundert Taler vorzuschießen, wenn er nach Mecklenburg zurückkehren und dort ein Geschäft eröffnen würde. Beleidigt antwortet Ludwig, dass er nur gefesselt oder als Leiche nach Mecklenburg zurückgebracht werden könnte, und dass er künftig kein Geld mehr von dem älteren Bruder annehmen werde.
Im März 1848 erhält Heinrich einen ausführlichen Brief von seiner Schwester Wilhelmine. Sie schildert ihm darin ihre Gedanken über die anderen Familienmitglieder. Um Ludwig mache sie sich Sorgen. Dorothea, von Wilhelmine Dörtchen genannt, habe eine gute Stelle als Wirtschafterin in Sternberg in Aussicht. »Püpping«, ihre jüngste Schwester Louise, sei vom Winter noch etwas kränklich, und Elise, die sich um eine Tante in Vipperow kümmert, bemitleide sie um die anstrengende Arbeit. Paul habe keinen eigenen Willen und tue nur, was der Vater verlange; der wiederum wolle nicht vom jüngsten Sohn ablassen. Heinrich aber sei ein herzensguter Mensch, und sie alle hätten ihn zu Unrecht für kalt und keiner edlen Gesinnung fähig gehalten. Wilhelmine stellt fest: »Alle müssen wir so verlassen in der Welt umher irren und unser Brod verdienen – wenn ich so recht darüber nachdenke, werde ich immer sehr sehr traurig und blicke mit Zagen in die Zukunft!«
Ernst Schliemann beobachtet Ludwigs Verhalten eher mit Misstrauen als mit Sorge, seit dieser von ihm die Auszahlung seines mütterlichen Erbteils gefordert hat. Er informiert Heinrich darüber, dass er diesem unbesonnenen Menschen nichts davon aushändigen werde, damit er das Geld nicht genauso vergeude wie jenes, das ihm von seinem »guten Sohn« Heinrich und ihm selbst bereits geliehen wurde.
Selbst Paul erwähnt Ludwig in einem Brief, den er Heinrich im Mai 1848 sendet. Er glaubt, dass Ludwig sich in bitterster Not befände und durch Heinrichs Abreise aus Amsterdam seinen Halt verloren habe. Den Brief schließt er mit folgenden Worten: »Nun lieber, guter Heinrich, lebe mir wohl, recht wohl, wahrscheinlich die letzten Zeilen in diesem Erdenthal hienieden! – Bitte mitunter zu denken, Deines Dich liebenden Bruders Paul.«
Nur wenige Wochen später erhält Heinrich einen Brief von Ludwig, dessen Inhalt ihn überrascht: In wenigen Stunden werde Ludwig auf einem Schiff nach New York reisen. Er teilt ihm mit, dass er von Schröder Geld bekommen habe, das Heinrich in Rechnung gestellt würde – Ludwig würde es ihm zurückzahlen, sobald er könne. Versöhnlich schlägt er vor, an ihrem früheren guten Verhältnis wieder anzuknüpfen. Sein Brief endet mit dem Satz: »Vielleicht sehe ich Europa nicht wieder! – Ach ich habe noch so sehr viel zu arrangiren.«
*
Am 21. Mai 1850, zwei Jahre nach seiner Abreise aus Europa, stirbt Ludwig mit fünfundzwanzig Jahren an Typhus. Bis nach Sacramento City war er gekommen, und hatte dort in den letzten Monaten vor seinem Tod eine abenteuerliche Zeit verbracht. Ein ehemaliger Geschäftspartner Ludwigs sendet Heinrich die Todesanzeige aus einer Zeitung.
Wiederum zwei Jahre später, im Oktober 1852, wird sich Paul mit einundzwanzig Jahren das Leben nehmen. Bis zum Schluss weiß er nicht, wohin er will. Mal möchte er nach Amerika auswandern, mal in einer Gärtnerei sein berufliches Glück suchen. Einige Zeit arbeitet er als Aufseher auf einem gräflichen Gut, zuletzt bewirbt er sich um die Stelle eines Wirtschafters. Vom Vater zieht er niemals weg. Wenige Wochen vor seinem Tod verfasst Paul in einem Brief an Wilhelmine auch ein Gedicht, das seiner Hoffnungslosigkeit Ausdruck verleiht. Es trägt den Titel Betrachtungen der Einsamkeit.
Ernst Schliemann kann es kaum fassen, wie das Schicksal ihm mitspielt. »Er, der mir eine mächtige Stütze in meinem hohen Alter hätte seyn können, ist nun das Gegentheil geworden und hat gleichsam meine Grabstätte schnell bereitet!«, schreibt er über Pauls Tod.
Und über den Tod seines Sohnes Ludwig: »Oh Ludwig! – Wärst Du in Europa geblieben, so hättest Du jetzt meinen Gasthof übernehmen können!«
Mit dem Kauf des Grundstücks, auf dem die Gaststätte stand, hatte sich Ernst Schliemann in finanzielle Schwierigkeiten gebracht.
Heinrich ist der letzte Sohn, der aus der Ehe von Ernst und Luise Schliemann übrig geblieben war. Auf ihm ruhen nun die Hoffnungen der gesamten Familie.
*
Ein Segelschiff glitt über das Wasser. Fuhr es mitten im weiten Ozean oder auf einem schmalen Fluss? Bewegte es sich überhaupt? Von dichtem weißen Nebel eingehüllt, hätte es überall sein können, es hätte ankern oder dahingleiten können, backbord oder steuerbord. Ohne einen landschaftlichen Hintergrund, ohne jedweden Zusammenhang schien es in diesem Moment von allem losgelöst zu sein und einfach zu existieren. Auf Deck hatten sich alle Passagiere versammelt, keiner von ihnen hielt es noch länger in den engen Kabinen aus. Die lange Reise hatte ihre Spuren in den erschöpften Gesichtern hinterlassen, aber in den Augen der meisten sah man ein Funkeln, eine Vorfreude auf etwas, das hinter dem Nebel liegen musste. Der Augenblick würde gleich kommen, manche hofften, manche wussten es. Er musste gleich kommen. Schließlich hatte der Kapitän es gestern Abend angekündigt. Aber noch sahen sie nichts und hörten nichts – außer dem sanften Klatschen des Wassers an der Schiffswand.
Plötzlich schimmerte eine Stelle in der Nebeldecke. Tatsächlich, bei genauem Hinsehen erkannten immer mehr Passagiere Schemen und Kontraste von Hell und Dunkel. Zunächst sahen sie es nur durch angestrengtes Fokussieren, dann gelang es immer müheloser. Der Nebel verzog sich, schob sich wie ein Vorhang zu beiden Seiten weg. Für einige Minuten diente er noch wie die Umrahmung eines Bildes: ein Anblick, der bei vielen Passagieren ein erleichtertes Seufzen auslöste. Vor ihnen lag eine Küste, nicht allzu weit entfernt. Und da entdeckten sie andere Schiffe, manche von ihnen nur als Punkt am Horizont. Als säße ein unsichtbarer Riese an Land, der die Schiffe mit Bindfäden langsam zu sich zog, steuerten sie aus unterschiedlichen Seiten in die gleiche Richtung: in die Bucht von San Francisco. Alle Menschen kamen mit demselben Ziel. Gold soll es hier geben, war ihnen zu Ohren gekommen.
Kaum ein halbes Jahr zuvor war das Sensationelle geschehen: Ein Arbeiter hatte am American River rein zufällig ein Goldnugget gefunden. Trotz der Versuche, die Nachricht geheim zu halten, verbreitete sie sich rasant. Erst flüsterten es sich die Bewohner der Gegend zu. Sie ließen die angefangene Arbeit liegen und stürzten davon, vergaßen ihr Vieh, ihre Häuser, ihr Land, das sie wenige Jahre zuvor mit so großem Stolz zu ihrem Eigentum erklärt hatten. Der Wunsch, Gold zu finden, war größer. Am Fundort angekommen, mussten sie nur etwas Sand auf die Siebe streuen und es hin und her schütteln. Bald blieben kleine Goldstücke im Geflecht hängen, glitzerten verführerisch in den Händen des Finders. So einfach war es also: mit einigen Schwenkern zu Glück und Reichtum.
Die Nachricht zog immer größere Kreise. Bald wusste ganz Kalifornien Bescheid. Auch die Landesgrenzen waren kein Hindernis. Als der Weg von Mund zu Mund nicht mehr weiterging, kam der Telegrafenmast zum Einsatz. So gelangte sie über Ozeane hinweg und wurde in die Welt verkündet. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Von überallher reisten die Menschen, überwanden größte Distanzen, um nach Kalifornien zu kommen. Zu wenig hatten sie in ihrer alten Heimat zu verlieren, zu groß war der Wunsch, den traditionellen Strukturen zu entfliehen und ein neues Leben zu beginnen. Die Nachricht versprühte einen suchterregenden Geruch von Freiheit und Reichtum.
Der spektakuläre Fund hatte sich im Januar 1848 ereignet. Während in San Francisco zu diesem Zeitpunkt ungefähr neunhundert Seelen lebten, waren bereits ein halbes Jahr später mehr als doppelt so viele Menschen hierher gezogen. Am Ende desselben Jahres war die Einwohnerzahl auf zwanzigtausend gestiegen. Täglich ankerten neue Schiffe in der Bucht. Mit den Passagieren gingen zumeist auch die Matrosen an Land und kehrten nie mehr zurück an Bord. Die Neuankömmlinge zogen weiter ins Landesinnere, entlang des American River, oder ließen sich direkt in San Francisco nieder. Denn wer nicht Gold suchen wollte, kam mit anderen Ideen, aus denen sich Geld machen ließ. Die vielen Goldsucher brauchten schließlich Zelte zum Wohnen, Kleidung, Lebensmittel – und jemanden, der ihnen das Gold abkaufen würde. In San Francisco entstanden Banken und Unternehmen wie Levi Strauss & Co. Die Stadt entwickelte sich zum wirtschaftlichen Zentrum Kaliforniens.
Während in den ersten Jahren nach der Entdeckung des Goldnuggets endlose Karawanen aus Reitern, Pferdewägen und Fußgängern von der Ostküste monatelang durch die Prärien zogen und sich mühsam über die Rocky Mountains kämpften, gab es für die besonders Ungeduldigen noch zwei andere Wege. Einer führte per Schiff um das Kap Horn, der andere über den Isthmus von Panama. Letztere Möglichkeit war deutlich schneller als die anderen Wege, dafür aber auch viel gefährlicher.
Als Heinrich Schliemann sich nach dem Tod seines Bruders Ludwig entscheidet, nach Kalifornien aufzubrechen, muss er nicht lange überlegen, auf welchem Weg er sein Ziel erreichen will.
*
Im Frühjahr 1850 ist es so weit. Schliemann verlässt St. Petersburg mit dem Gefühl, nicht viel verlieren zu können. Oder anders gesagt: Den Inhalt seines Lebens, sein Vermögen, nimmt er einfach mit. Verpflichtungen gegenüber anderen hat der Achtundzwanzigjährige nicht. Für Schröder arbeitet er mittlerweile auf eigene Rechnung, sodass er ihm bezüglich seiner Lebenspläne keine Rechenschaft mehr schuldig ist. Und seine Versuche, eine Ehefrau zu finden, sind bislang gescheitert. Nachdem Schliemann über Minna Meinckes Hochzeit informiert worden war, hatte er seine Suche innerhalb der St. Petersburger Gesellschaft fortgeführt. Zwei auserwählte Frauen hätte er sich tatsächlich als lebenslange Begleiterinnen vorstellen können. Sophie Hecker hieß eine von ihnen, eine gebürtige Deutsche, die mit ihren Eltern nach Russland gezogen war. Schliemann schätzte drei ihrer Talente ganz besonders: Sie beherrschte drei Sprachen, spielte Klavier und war bescheiden. Gekränkt musste Schliemann die Beziehung aufgeben, als er ihre unangemessene Offenheit gegenüber einem Offizier bemerkt hatte.
Dann war da noch eine andere Bekanntschaft, in der Schliemann Potenzial für eine gemeinsame Ehe zu erkennen glaubte: Jekaterina Lyshina, eine ebenfalls gebildete junge Dame aus einer einflussreichen russischen Familie. Seine Avancen lehnte sie allerdings bislang ab.
Schließlich kehrt Schliemann, frei von jeglichen Verpflichtungen vor Ort und mit der Aussicht auf noch mehr Freiheit, Russland den Rücken zu und bricht im Dezember 1850 mit fünfzigtausend Reichstalern in der Tasche auf nach Amerika.
Der erste Versuch, den Atlantik zu überqueren, misslingt. Mitten auf dem Ozean, tausendvierhundert Meilen von New York, tausendachthundert Meilen von Liverpool entfernt, gerät der Dampfer namens Atlantic, auf dem Schliemann reist, in einen Orkan. Die Maschinen funktionieren nicht mehr, die Mannschaft versucht, mit gehissten Segeln weiter Richtung Westen zu fahren. Aber gegen die Stürme kommen sie nicht an, sodass der Kapitän schließlich den Beschluss fasst, nach Europa zurückzukehren. Schliemann ist nicht allzu missgestimmt. Zum Glück gibt es genügend interessante Gestalten unter den Passagieren, mit denen er sich über viele Themen unterhalten kann. Nach etwa zwei Wochen, am 22. Januar 1851, sichten sie die irische Küste.
Am 2. Februar – nicht ohne zuvor in Liverpool ein Theater besucht, in Amsterdam einige Geschäfte erledigt und sich in Dover von einem Schiffsbauer Informationen über Kalifornien eingeholt zu haben –, startet Schliemann von Liverpool aus den nächsten Versuch, auf einem Schiff namens Africa nach Amerika zu gelangen. Diesmal klappt es. Am 15. Februar fährt das Schiff in die Bucht von New York ein. Während der Einfahrt lässt der Kapitän Raketen abfeuern, die Tausenden von Menschen, die gebannt am Ufer warten, eine verheißungsvolle Nachricht ankündigen sollen. Schließlich weiß bis dahin niemand von ihnen vom Schicksal des Vorgängerschiffs Atlantic, dessen Überquerung des Ozeans zwar missglückt war, dessen Passagiere jedoch alle überlebt haben.
Schliemann nutzt die Tage in New York, um sich in verschiedenen Handelshäusern vorzustellen und sich auf das geplante Geschäft in Kalifornien vorzubereiten. Nach sorgfältiger Überlegung überlässt er sein Vermögen einem Bankhaus, das ihm vertrauenswürdig erscheint. Neben der Arbeit erkundet er das kulturelle, kulinarische und weibliche Angebot der Stadt. Die Theaterhäuser gefallen ihm nicht, das Essen schmeckt ihm gut, die »Yankee-Ladies« findet er zu lebhaft und äußerlich verbraucht. Die amerikanischen Männer scheinen ihm mitteilsam und fleißig zu sein, von guter Konstitution, wenn auch etwas schwächlicher als Engländer.
Schliemann verweilt nicht lange in New York. Immerhin steht ihm noch die Umrundung des nordamerikanischen Kontinents bevor, um sein eigentliches Ziel zu erreichen. Mit der Eisenbahn fährt er nach Philadelphia. Von dort aus geht es Ende Februar weiter auf einem Schiff nach Chagres, den atlantischen Hafen am Isthmus von Panama. Je mehr er sich dem Äquator nähert, desto höher steigen die Temperaturen. Schliemann hasst es. Das tägliche Bad am Morgen hilft ihm kaum gegen die unerträgliche Hitze.
Am 9. März erreicht das Schiff Chagres – den erbärmlichsten Ort, den Schliemann bis zu diesem Zeitpunkt jemals gesehen haben will. Er und seine Reisegefährten fahren nun auf Booten weiter durch den Chagres-Fluss in Richtung Panama. Nach dem Anblick der heruntergekommenen Hütten von Chagres hält Schliemann die Landschaft, in die er nun eintaucht, wiederum für das Entzückendste, was er je gesehen hat. Die Ufer des Flusses sind von Zitronenbäumen und Kokospalmen gesäumt. Dennoch missfällt ihm auch vieles. In sein Tagebuch schreibt er regelmäßig und schildert seine Reiseerlebnisse: die reiche Vegetation, die feuchten Dünste der Sümpfe, der Gestank verwesender Tiere und Pflanzen, der warme Dauerregen. Und über allem die drückende Hitze. Gegen diese hilft gar nichts mehr, selbst völlig unbekleidet würde der Körper kaum abkühlen. Schliemann glaubt, in diesem Klima mit jedem Atemzug Gift einzusaugen.
Heinrich Schliemann in New York, ca. 1851
Das Trinkwasser ist lauwarm und meist voller Insektenlarven; nur mit Branntwein gemischt wird es genießbar; gegen das Durstgefühl hilft es trotzdem nur wenig. An den Abenden, wenn sie am Ufer ihr Nachtquartier aufgeschlagen haben, ist für Schliemann kaum an Schlaf zu denken. Selbst in den Hütten, die keine Wände haben und nur aus Laubdächern und vier Pfählen bestehen, hört er nicht auf zu schwitzen. Der Branntwein und das Klima machen ihn unangenehm träge, während die blutrünstigen Mücken ihn zu jeder Stunde terrorisieren.
Zu Land geht es weiter über Gebirge, mit steilen Abhängen und schmalen Pfaden, auf denen keine zwei Maultiere nebeneinander stehen können. Aus den Tälern klingt ein Konzert aus Vogelstimmen und Affengebrüll. Bunte Papageien kreischen in den Baumwipfeln. Überall flattern Schmetterlinge, in leuchtenden Farben, manche von ihnen so groß wie Tauben. Wenn Schliemann Hunger hat, kann er wortwörtlich einfach nach oben greifen: Schon hält er eine Orange oder eine andere Frucht in der Hand, die überall reif und schwer von den Ästen hängen. Die Eingeborenen passen seiner Meinung nach hervorragend in das Ambiente. Diese seien nämlich, so schreibt er es in sein Tagebuch, faul und völlig zufrieden, sofern sie nicht mehr zu tun haben als schlafen, essen und trinken. So müsse es im Garten Eden zugehen.
Doch die Reise durch das fremde Land hat noch eine andere Seite. Schliemann gewöhnt es sich an, die Begleiter der Reisegesellschaft aus dem Augenwinkel zu beobachten. Vor allem dann, wenn das Boot zur Fahrt losgemacht wird oder wenn der Weg durch den Tropenwald besonders unwegsam wird, schielt er unauffällig zu ihnen. Schauergeschichten haben sich herumgesprochen, über ahnungslose Passagiere, die von den Bootsleuten oder von Eingeborenen aus dem Hinterhalt ertränkt, erstochen oder erschossen und danach ausgeraubt worden waren. Dass das keine Märchen sind, bestätigen Geier und Insekten, die Schliemann über vereinzelten Stellen im Dickicht des Ufers oder etwas abseits vom Weg entdeckt. Sie fliegen über den Leichen der Opfer, die von den Tätern achtlos ins Gebüsch geworfen worden waren. Ihr Verwesungsgeruch vermischt sich mit dem von verendeten Maultieren und Leguanen. Manchmal unterscheidet sich der Geruch kaum von dem süßlichen Duft der überreifen Früchte in den Bäumen. Schliemann ist froh, wenn er das Fäulnis verströmende Paradies auf Erden endlich hinter sich lassen kann.
Mitte März 1851 erreicht er Panama, einen Ort mit rund zweitausend Einwohnern. Dem einzigen Theater stattet Schliemann einen Besuch ab, bevor er mit dem Schiff abreist. Das Gebäude findet er primitiv, die Schauspieler miserabel, und die weiblichen Besucher, zumeist spanischer Abstammung, scheinen in dem tropischen Klima ebenso schnell zu verblühen wie so ziemlich alles, was er von dieser Gegend bislang gesehen hat.
Die Brise, die Schliemann während des Auslaufens aus dem Hafen um die Nase weht und endlich die ersehnte Abkühlung bringt, hält nicht lange an. Bereits in der Nacht wird die Hitze in der kleinen Kabine wieder unerträglich und raubt ihm den Schlaf.
Im Hafen von Acapulco legt der Dampfer über Nacht an, bevor es weiter in Richtung Norden geht. Schliemann hat Zeit, um die Stadt anzusehen und sich am Markt mit einem ordentlichen Vorrat an Orangen und Ananas einzudecken. Am Vormittag, bevor der Dampfer den Hafen wieder verlässt, schwimmt eine Gruppe von jungen Einheimischen zum Schiff. Sie vollführen alle möglichen Kunststücke im klaren blauen Wasser, in der Hoffnung, von den Passagieren ein paar Münzen zu bekommen. An den braunen sehnigen Körpern der Jungen gleiten Fischschwärme vorbei, die blitzschnell an der Oberfläche auftauchen, um die Essensreste zu ergattern, die hin und wieder über Bord geworfen werden. Dann legt der Dampfer ab, fährt vorbei an den ungeheuren Felsgruppen der mexikanischen Küste, die immer undeutlicher wird. Schliemann ist beeindruckt von den Bergen, die teils bis in die Wolken reichen. Bis auf zwei Feuer, die er nachts in der Ferne erkennen kann und die vermutlich von Eingeborenen entzündet wurden, gibt es kaum noch Hinweise auf menschliches Leben. Einmal fährt ein Dampfer aus der entgegengesetzten Richtung an ihnen vorbei. Tagelang kann Schliemann kein Land sehen. Nur die zunehmende Kälte weist darauf hin, dass sie sich immer weiter im Norden befinden. Nach vielen Wochen muss er erstmals wieder seine Winterkleidung anziehen. Im Übrigen sind die Tage eintönig. Im Hafen von San Diego ankert der Dampfer für wenige Stunden; außer einem einzigen Passagier will niemand aussteigen.
Es ist Anfang April 1851, als der Dampfer in die Bucht von San Francisco einläuft. Noch am selben Morgen hatte es eine Seebestattung eines älteren Passagiers gegeben, der so kurz vor dem Ziel an Fieber gestorben war. Im dichten Nebel war der in ein Segeltuch eingenähte Körper nahezu geräuschlos im Ozean verschwunden. Am Nachmittag hat sich der Nebel längst verzogen und es ist, als ob die bevorstehende Ankunft dem Schiff wieder Leben einhaucht. Die Passagiere werden ungeduldig, jeder will zuerst von Bord. Vor lauter Drängen und Schubsen hat Schliemann Mühe, nicht über seinen eigenen Koffer zu stolpern. Trotzdem gelingt es ihm, zwischendurch den imposanten Anblick zu genießen: Hunderte Segelschiffe liegen dicht beieinander im Hafen. Wie die Stadt dahinter aussieht, kann er nur erahnen, da die vielen Masten die Sicht versperren.
Drei Monate hat Schliemann für seine Reise von St. Petersburg nach San Francisco benötigt. Wie lange er bleiben will, ob er Kalifornien jemals wieder verlassen wird, darüber will er nicht nachdenken – noch nicht. Ein starker Wind weht über die Abhänge zwischen den Holzhäusern. Egal, wohin man blickt, überall sind Menschen unterwegs, unterhalten sich oder kommen aus den Geschäften, in denen sie sich für die Weiterreise zu den Goldfundstellen mit dem Nötigsten versorgt haben. Schliemann hört im Vorbeigehen das Hämmern und Klopfen von den Bauarbeiten an neuen Unterkünften. Er schnappt Gesprächsfetzen auf in unterschiedlichsten Sprachen, von denen er zu seinem Erstaunen einige nur erraten kann. Nach den vielen Wochen auf See und der untätigen Warterei preschen die Neuankömmlinge ungestüm in die Stadt, witternd, dass man schnell sein muss, um eine günstige Gelegenheit beim Schopf zu packen. Wie ein emsiger Bienenstaat hatte sich San Francisco innerhalb von zwei Jahren von einem Dorf zu einer geschäftigen Stadt entwickelt. Das Knistern in der Luft macht Schliemann wieder munter.
*
An einem heißen Tag reiten zwei Männer durch die Frontstreet von Sacramento. Sie haben struppige Vollbärte, sind von der Sonne braun gebrannt und tragen zerschlissene Hosen, erdverkrustet bis zu den Schenkeln hoch. Sie sind auf zwei schwer beladenen Maultieren unterwegs, deren Hufe auf dem trockenen Boden kleine Staubwolken aufwirbeln. An der Ecke zur I-Street ziehen die Männer fest an den Zügeln und steigen ab. Die müden Tiere werden vor einem Wassertrog festgebunden, aus dem sie sogleich gierig saufen. Mit jeweils einem kleinen Säckchen in der Hand betreten die Männer das Bankgeschäft an der Straßenecke. Während draußen in der Mittagsglut nahezu niemand unterwegs ist, herrscht im Inneren des Hauses großes Gedränge. Noch im Türrahmen bleiben die Männer stehen und müssen erst einmal abwarten, bis genügend andere Personen den überfüllten Raum wieder verlassen haben.
Als sie endlich am Schalter ankommen, werden sie von einem Bankangestellten mit hartem Akzent begrüßt. Die Männer öffnen die beiden Säckchen und schütteln sie vorsichtig aus, bis es auf dem Tisch zu glitzern beginnt. Der Bankangestellte, ein Spanier, bewegt mit dem Zeigefinger vorsichtig die kleinen Steinchen hin und her, nimmt schließlich eines davon in die Hand und schaut es sich mit zusammengezogenen Augenbrauen genauer an. Während die Männer geduldig vor ihm warten, werfen sie sich für den Bruchteil einer Sekunde einen Blick zu. Der Spanier entschuldigt sich für einen kurzen Moment und verschwindet in einem Nebenraum. In Begleitung eines weiteren Mannes kehrt er wieder zurück. Offenbar handelt es sich um den Inhaber des Geschäfts. Recht jung sieht er aus, vor allem wegen seiner kindlichen Größe und den schmalen Schultern. Fast jede andere Person im Raum überragt ihn um einen ganzen Kopf. Er begrüßt die beiden Kunden freundlich und blickt ihnen fest in die Augen, bevor er sich den Steinchen auf dem Tisch widmet. Gold soll das also sein, meint er, wobei er eher zu sich selbst spricht als zu den beiden Besitzern. So, wie es der Spanier zuvor getan hat, bewegt auch er das vermeintliche Gold zunächst mit den Fingerspitzen hin und her, bevor er es einem prüfenden Blick unterzieht. Von dem ungeduldigen Stimmengewirr in der Warteschlange lässt er sich nicht beirren. Kurz darauf legt er die Steinchen wieder auf den Tisch und würdigt sie keines weiteren Blickes mehr. Der freundliche Ton ist verschwunden, als er den beiden Herren mitteilt, dass sie nicht miteinander ins Geschäft kommen werden. Wie zufällig blitzen für einen Augenblick ein Colt auf der einen und der Griff eines Jagdmessers auf der anderen Seite seines Gürtels auf, als er seine Jacke sorgfältig zurechtrückt. Die Männer sind zwar etwas verdutzt, aber nicht schwer von Begriff. Ohne Widerworte sammeln sie den Inhalt der Säckchen ein und verlassen den Raum.
Schliemann klopft seinem Angestellten kurz auf die Schulter, bevor er wieder in den Nebenraum geht und der nächste Kunde am Schalter empfangen werden kann.
Seit sechs Uhr früh hat Schliemann das Geschäft geöffnet, und sicherlich wird er es auch heute nicht vor zehn Uhr am Abend schließen – zu viele Kunden möchten noch bedient werden. Schliemann kauft ihnen das angebotene Gold weit unter dem Marktwert gegen Bargeld ab und verkauft es dann wiederum zum Marktwert weiter an einen Agenten des Bankhauses Rothschild in San Francisco. Geld und Gold verschließt er in einem feuer- und diebessicheren Safe. An manchen Tagen macht Schliemann einen Umsatz von zwanzigtausend Dollar. Sein Bankgeschäft wird von den Goldgräbern gerne aufgesucht; der Deutsche wirkt vertrauenerweckend, nicht zuletzt deshalb, weil sich die meisten Kunden mit ihm in ihrer eigenen Muttersprache unterhalten können – sofern sie nicht Chinesen sind. Aber selbst diese kommen gerne zu ihm und werden von Schliemann mit geringstem Misstrauen bedient. Er hält sie für weit ehrlicher und harmloser als die amerikanischen Kunden.
Er ist schon viele Monate in Kalifornien. Das Grab seines Bruders Ludwig suchte er bereits wenige Wochen nach seiner Ankunft auf. Dafür musste er zum Friedhof von Sacramento reisen. Nach längerer Suche glaubte Schliemann, endlich die richtige Stelle gefunden zu haben. Inmitten von unzähligen weiteren Kreuzen stehend, wirkte es erbärmlich. Schliemann ertrug den nichtssagenden Anblick nicht gut. An dieser Stelle musste etwas anderes stehen, etwas, das das Grab seines Bruders angemessen kennzeichnen würde. Er ließ in San Francisco einen marmornen Grabstein mit Inschrift in Auftrag geben.
Immer wieder muss er an die Worte denken, mit denen sein Bruder ihm in den letzten Briefen das Leben in Kalifornien beschrieben hatte. Ludwig betonte, wie schnell sich hier ein Vermögen machen ließe und wie schnell sich das Glück wieder wenden könne. Ständig hatte er sich vor Gaunern schützen müssen, gegen Raubüberfälle trug er, so wie jeder in diesem Land, eine Waffe bei sich. Letztendlich half ihm diese aber nicht: Eine Krankheit raffte ihn dahin. Nachdem er mit ehemaligen Geschäftskollegen Ludwigs gesprochen und die Umgebung mit eigenen Augen gesehen hat, glaubt Schliemann eine ungefähre Vorstellung davon zu haben, wie sich die letzten Wochen seines Bruders zugetragen haben müssen. Auf dem Weg zu einer Goldmine war er samt Pferd in einen Fluss gestürzt. Er konnte sich zwar retten, hatte aber keine trockene Ersatzkleidung dabei. In der Kälte der kommenden Nächte bekam Ludwig starkes Fieber. Er schaffte es noch mit eigener Kraft nach Sacramento und wurde von einem Arzt behandelt. Dennoch starb er zwei Wochen später. Wer ihm in seinen letzten Stunden beigestanden hatte, ob überhaupt jemand bei ihm am Sterbebett zugegen war, das weiß Schliemann nicht.
Auf einige Gefahren in Kalifornien hat sich Schliemann vorbereitet. Gegen Betrug und Pech gibt es für ihn, abgesehen von einem geladenen Colt am Gürtel, noch ein weiteres Mittel, das sich in der Vergangenheit bewährt hat: Information. Schon vor seiner Abreise aus Europa hatte er amerikanische Geschäftskollegen gebeten, ihm »so umständlich wie möglich« darüber zu berichten, wie sich Geld in Amerika am besten anlegen ließe und wie es sich mit dem Handel in San Francisco verhalte. Um genaueres Wissen über sein neues Umfeld, die geschäftlichen Möglichkeiten und die Gesellschaft zu erlangen, unternimmt er Ausflüge in die Gegend um Sacramento. Er schaut den Goldgräbern über die Schulter, wenn sie den Schlamm der Flüsse in Sieben waschen. Er besucht Distrikte, in denen sich die Menschen auf die Suche nach Quarz oder Blei spezialisiert haben. Die Täler scheinen vom edlen Metall nur so zu glänzen.
Vor der Gesellschaft, vor allem vor den Amerikanern, nimmt sich Schliemann in Acht. Ihre Strategie glaubt er zu durchschauen. Auf übertriebene Höflichkeit und freundliche Gesten folgt bei jeder neuen Bekanntschaft irgendwann der Wendepunkt: der Versuch, ihn übers Ohr zu hauen. Und dann, wenn das Gegenüber bei Schliemann auf Granit gestoßen ist, fängt das Spiel noch mal von vorne an. Erst wenn der zweite Versuch, ihn in eine Falle zu locken, nicht geklappt hat, belässt es der Betrüger dabei und geht seines Weges, um ein neues Opfer zu finden. Schliemann bewundert diese erstaunliche Hartnäckigkeit der Amerikaner in vielen anderen Situationen. Als er die große Feuersbrunst von San Francisco miterlebt, sieht er alle hoffnungslos neben den qualmenden Ruinen ihrer Häuser stehen – bis auf die Amerikaner. Diese sind bereits dabei, unversehrte Ziegelsteine für den Neubau ihrer Unterkünfte zu sammeln. Der Weg ihrer Vorfahren hat sie offenbar gelehrt, dass Aufgeben keine Option ist.
Durchtriebene Schurken abzuweisen, wie die beiden Männer, die ihm vergoldete Kupferstücke anzudrehen versuchen, gehört für Schliemann mittlerweile zur Routine. Kunden bleiben eben Kunden, und wohl nirgendwo auf der Welt kämpft man so sehr und mit allen Mitteln um sein eigenes Glück wie hier. Schliemann pflegt in Sacramento keine Freundschaften. Während sein Revolver ihn überallhin begleitet, wächst sein Heimweh nach St. Petersburg.
Als er ein halbes Jahr in Kalifornien lebt, erkrankt er schwer. Es beginnt eines Morgens damit, dass er sich übergeben muss. Dann folgen Schüttelfrost und Hitzegefühl im Wechsel. Am nächsten Tag entdeckt er gelbe Flecken über seinen ganzen Körper verteilt. Schliemann ist bereits zu geschwächt, um sein Bett zu verlassen. Die Ärzte verabreichen ihm hauptsächlich Chinin, doch er kriegt kaum etwas mit, weil das starke Fieber ihn in ein tagelanges Delirium versetzt. Wenn er zwischendurch das Bewusstsein erlangt, muss er sofort an Ludwig denken, der eineinhalb Jahre zuvor ebenfalls todkrank im Bett lag. Nach drei Wochen hat Schliemann die Krankheit überstanden und kann im Bankgeschäft wieder seine Kundschaft empfangen. Vor allem dem Chinin schreibt er von nun an heilende Kräfte zu. Aber die Ärzte warnen ihn: Ein zweites Fieber dieser Art würde er nicht überleben.
Etwa drei Monate später, im Januar 1852, tritt das Befürchtete ein. Schliemann hat erneut starkes Fieber. Diesmal versucht er es mit einem Klimawechsel und kommt gegen Bezahlung bei einem Bekannten in San José unter. Mit einem Arzt an der Seite und der guten Luft dieser Gegend ist Schliemann bereits nach einer Woche wieder gesund genug, um nach Sacramento zurückzukehren. Aber er spürt, dass er innerlich angeschlagen ist – wann ihn das Fieber wieder überfallen wird, scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Er investiert seine Energie in das Geschäft und verdient täglich ein Vermögen. Mitte März erkrankt er zum dritten Mal. Wie bei der ersten Erkrankung muss er sich ständig erbrechen, hat Fieber und ist übersät von gelben Flecken. Seine Angestellten hat er diesmal rechtzeitig instruiert. Sie wickeln ihn in Decken und sorgen dafür, dass der bewusstlose Schliemann wieder nach San José gebracht wird. Als er nach zwei Wochen aus dem Delirium erwacht, hat er seine Entscheidung gefällt: Schliemann wird mit dem nächsten Dampfer in die Heimat zurückkehren.
*
Er sitzt in einem großen Saal, der von Tausenden glitzernden Lichtern eines Kronleuchters erhellt ist. Eingesunken in einen dunkelroten Polstersessel aus weichem Samt lauscht er der zarten Melodie einer Arie. Weiter vor ihm, irgendwo zwischen den wohlfrisierten und ordentlich gescheitelten Hinterköpfen vornehmer Damen und edler Herren muss eine Bühne sein, auf der die Sängerin, die Besitzerin dieser überirdischen Stimme steht. Aber er bemüht sich gar nicht erst, sie zwischen den Reihen ausfindig zu machen. Er will sich nur zurücklehnen und zuhören. Die Stimme genügt ihm vollkommen, ihre Töne umhüllen ihn behaglich wie eine warme Decke, streicheln liebevoll seine Seele. Aber ihm fällt nach längerem Zuhören auf, dass die Arie ungewöhnlich klingt, vermutlich ist es keine der klassischen Art. Ein rhythmischer Takt liegt unter der Melodie, zunächst nur ganz schwach im Hintergrund. Dann wird der Takt immer deutlicher, übertönt schließlich die harmonischen Klänge, bis sie gar nicht mehr zu hören sind. Der Takt hat sich in ein aufdringliches Klopfen verwandelt, als würde jemand Schliemanns Stirn als Trommel benutzen. Unwillig, sich von dem weichen Polstersessel und dem hübschen Saal zu verabschieden, gibt er schließlich die behagliche Umgebung auf und öffnet die Augen.
Er blinzelt in den grauen Himmel, was eigentlich nicht sein dürfte. Doch das stümperhaft zusammengelegte Dach aus abgerissenen Palmenblättern hat dem Wind offenbar nicht standgehalten und liegt ringsum auf dem Boden verteilt. Regentropfen prasseln völlig ungehindert auf Schliemanns Gesicht. Mühsam quält er sich von seiner Bettstatt empor; sie besteht aus seinen Koffern und einer darüber ausgebreiteten Wolldecke, die nur noch einem nassen Lumpen gleicht. Während er die Reste seines Daches vom Boden zusammenklaubt, weicht das leicht beschwingte Gefühl, das ihm sein Traum geschenkt hatte, der altbekannten Verzweiflung, die ihn seit zehn Tagen jeden Morgen beim Aufwachen übermannt. So lange sitzt er bereits an der atlantischen Küste fest. Zusammen mit Tausenden anderen Passagieren wartet er darauf, dass sie endlich weiterreisen können. Bis dahin hatte alles gut geklappt: Schliemann war wohlbehalten in Panama angekommen und hatte sich für die Weiterfahrt über Fluss und Land mit anderen Passagieren zusammengetan. Schließlich hatten sie Navy Bay erreicht, von wo die Dampfer nach New York fahren. Doch sie waren zu spät gewesen: Die Crescent City hatte nur wenige Stunden zuvor abgelegt.
Wann der nächste Dampfer eintreffen würde, ist ungewiss. Seit zehn Tagen sucht Schliemann den Horizont ab, doch außer den Schiffen, die aus der anderen Richtung kommen und nur noch weitere Passagiere abladen, passiert nichts. Inzwischen sind mehr als zweitausend Menschen an der Küste gestrandet und warten auf die Weiterfahrt. In der Navy Bay gibt es keine Häuser. Schliemann und seine Leidensgenossen müssen im Freien unter Palmen schlafen. Es ist Ende April 1852, der Beginn der Regenzeit. Die Tage vergehen kaum ohne eine einzige Stunde, in der es nicht regnet. Wegen des Regens kann wiederum kein Feuer entfacht werden, weil es kein trockenes Holz zum Anzünden gibt. Schon am ersten Tag nach der Ankunft beginnen die Passagiere, die bereits völlig ausgehungert angekommen waren, nach essbaren Kleintieren Ausschau zu halten. Schließlich töten sie eine Eidechse und verzehren sie roh. Schliemann beobachtet sich selbst mit Entsetzen, wie er voller Appetit das Fleisch verschlingt. In der Navy Bay gehören Eidechsen, Schildkröten, Affen, Maultiere und Alligatoren zur Hauptnahrung der Gestrandeten. Das Unvorstellbare existiert an diesem Ort nicht, weder sichtbar an der Oberfläche noch in den Köpfen. Ekel, Moralvorstellungen und jegliche andere Grenzen werden mühelos überwunden. Hier wollen alle nur überleben – in den ersten Tagen zumindest. Der Regen prasselt und prasselt. Die Menschen sind völlig durchnässt, die ersten leiden an Fieber- und Durchfallerkrankungen. Dort, wo sie sich hingelegt haben, krampfen und winden sie sich, bis viele von ihnen schließlich verenden. Auch nach dem Tod bleiben sie an derselben Stelle liegen – niemand kann oder will die Kraft aufbringen, sie ordentlich zu begraben. Schliemann fühlt sich immer mehr wie ein Tier. Er isst wie ein Tier, er stinkt wie ein Tier, er schläft wie ein Tier. Er suhlt sich im Schlamm, um sich vor den stechenden Mücken zu schützen. Seine Habseligkeiten bewacht er wie ein Tier seinen eigenen Nachwuchs. Mit Messer und Revolver sitzt oder schläft er die meisten Stunden auf den Koffern. Schliemann wird den kostbaren Inhalt bis zum bitteren Ende verteidigen. Er denkt dabei nicht mehr nur an den Reichtum und die Mühen, mit denen er dieses Vermögen in Kalifornien gemacht hat. Das Gold mit einem Wert von sechzigtausend Dollar ist der einzige Beweis dafür, dass er vor diesem erbärmlichen Dasein ein Leben in der Zivilisation geführt hatte. Der Gedanke an das Gold lässt ihn in diesen Tagen das Leben von damals und das Leben, zu dem er zurückwill, nicht ganz vergessen.
Eine Wunde am Bein, die ihn bereits seit der Abreise in Kalifornien begleitet, wird in der dauernden Nässe immer schlimmer. Er versucht, die Schmerzen zu lindern, indem er etwas Quecksilber auf die Stelle streicht. Mit jedem Tag vergrößert sie sich. Bald kann Schliemann ein kleines Stück des Knochens erkennen. Die Schmerzen machen ihn bewegungsunfähig. Von nun an bleibt er auf seinen Koffern liegen. Sobald er im Gebüsch etwas rascheln hört, greift er sofort zum Messer. Viele Passagiere sind in den letzten Tagen von Schlangenbissen oder Giftstacheln der Skorpione getötet worden.
Das Unwissen über die Zukunft und die Qualen ihres Lebens in der Bucht lassen die Menschen immer mehr abstumpfen. Wenn nicht ein Tier oder eine Krankheit zur Gefahr wird, dann geht die Gefahr zunehmend von den Menschen selbst aus. Schliemann kann das, was er innerhalb der Schicksalsgemeinschaft sieht und erlebt, nicht einmal in sein Tagebuch schreiben. Zu schrecklich ist es, als dass er es in Worte fassen wollte.
Nach zwei Wochen hat das Martyrium ein abruptes Ende. Ein Kanonenschuss aus der Ferne weckt Schliemann am frühen Morgen des 8. Mai. Gleich vier Dampfer fahren in kurzen zeitlichen Abständen in die Bucht und nehmen die Passagiere auf. Er bezahlt hundertdreißig Dollar für eine Luxuskabine, wechselt seine Kleidung, lässt seine Wunde verarzten und kommt mit einer Rindfleischbrühe wieder zu Kräften. Die Abfahrt aus der Navy Bay verpasst er schlafend in seinem Bett.